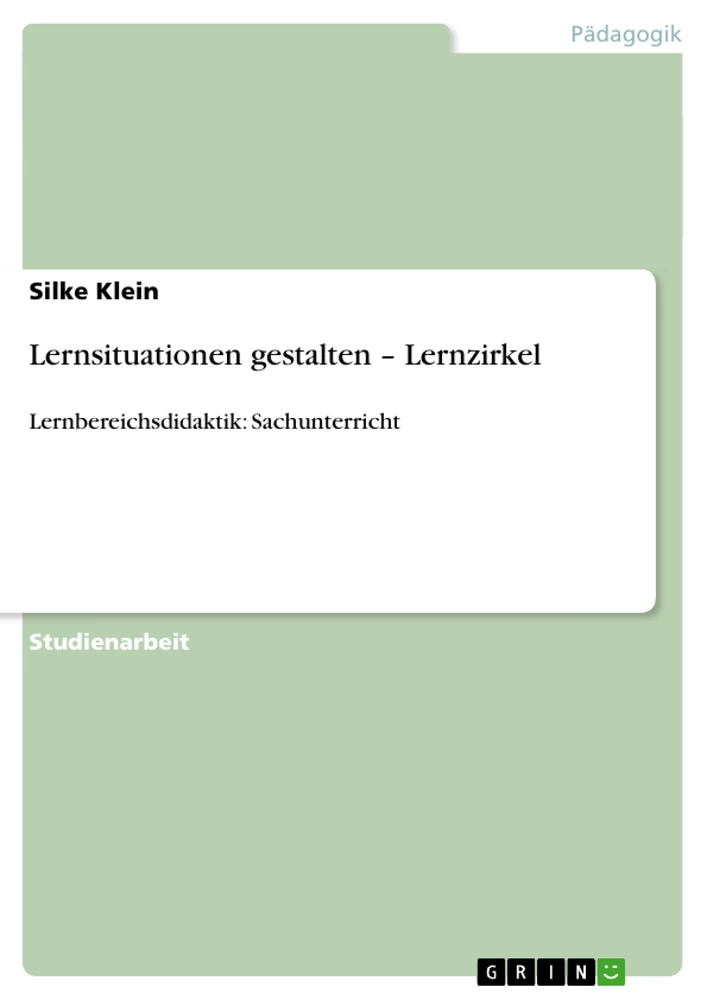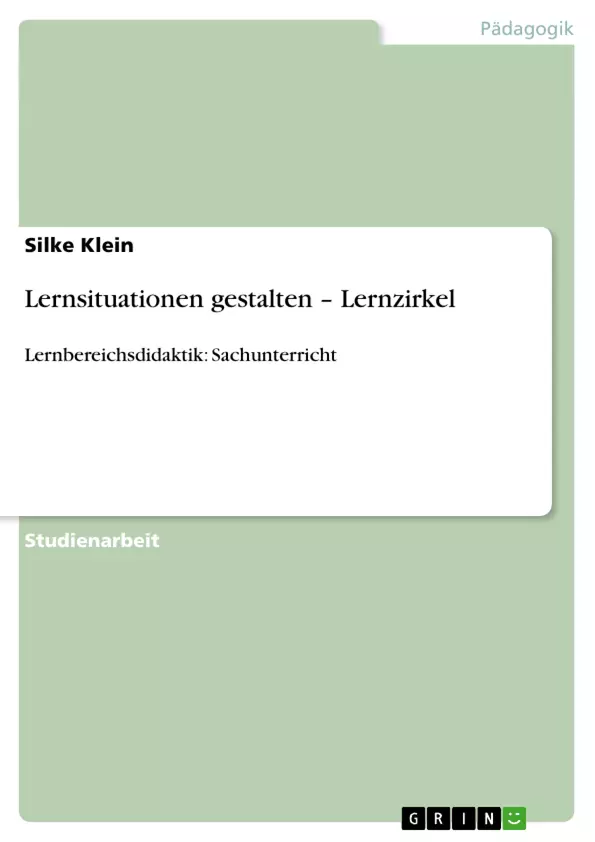Lernzirkel sind eine Unterrichtsform, die ein wahldifferenziertes, selbständiges Lernen zu einem Thema ermöglichen. Im Unterrichtsraum steht zu einem Thema eine größere Anzahl von Lernangeboten, welche selbständige, lehrerunabhängige und aktive Arbeit zulassen und fördern, bereit. Die Schüler müssen nicht alle Aufgaben bearbeiten und können weitgehend selbst über die Auswahl, die Reihenfolge und über die Zeit, die sie für die einzelnen Aufgaben verwenden möchten, entscheiden. Zudem sind in Lernzirkeln unterschiedliche Sozialformen möglich und die Unterrichtszeit ist verlängert. Häufig stehen mehrere Unterrichtsstunden, auch über einige Tage verteilt, bereit.
Eine Besonderheit des Lernzirkels als Unterrichtsform liegt vor allem darin, dass alle Schüler auf individuellen Wegen auf dasselbe Grobziel hinarbeiten.
„Denken, Lernen und Vergessen“ geschieht, „indem unser Gehirn punktuelle Eindrücke und Erfahrungen speichert und sich schließlich durch die Verflechtung sämtlicher Phänomene ein komplexes“ „Netzwerk des Lernens“(2) bildet“(1). Diese Anschauung hört man im Begriff „Lernzirkel“ deutlich heraus. Sie wird in dieser Unterrichtsform umgesetzt. Die Schüler lernen über möglichst viele unterschiedliche Zugänge, auch unter Benutzung vieler Sinne, ein Unterrichtsthema aus vielen Perspektiven kennen. Der Begriff „Lernzirkel“ stammt aus dem Leistungssport. >Circuit< bedeutet Kreislauf oder Umlauf . Bei diesem 1952 von Morgan und Adamson entwickelten Zirkeltraining werden nacheinander verschiedene Aufgabenstationen durchlaufen, wobei an jeder Station entweder die Übungszeit oder die Anzahl der Übungen vorgegeben ist. Die verschiedenen Einzeltrainingseinheiten sind durch ihren Abwechslungsreichtum motivierend und tragen insgesamt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bei.
Häufig werden auch die Begriffe „Stationenlernen“ („Lernen an Stationen“) und „Lernstraße“ für diese Form von Unterricht verwendet. Die Bezeichnung „Lernen an Stationen“ zeigt auf, dass hier ein Lernen gemeint ist, dass...
Inhaltsverzeichnis
- Lernzirkel: Kennzeichnung der Unterrichtsform
- Entscheidungsfreiheiten der Schüler
- Funktion des Lehrers
- Aspekte der Materialbeschaffenheit
- Unterrichtsablauf
- Lernpotentialen
- Selbsttätigkeit und Selbststeuerung in Lernzirkeln
- Weitere wichtige Lernpotentialen
- Probleme/Grenzen von Lernzirkeln
- Geschichtliche Entwicklung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Unterrichtsform des Lernzirkels und analysiert dessen Kennzeichen, Lernpotentialen, Probleme und die geschichtliche Entwicklung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für diese Unterrichtsform zu entwickeln und deren Einsatzmöglichkeiten im Sachunterricht zu beleuchten.
- Kennzeichnung der Unterrichtsform Lernzirkel
- Lernpotentialen von Lernzirkeln
- Probleme und Grenzen von Lernzirkeln
- Geschichtliche Entwicklung des Lernzirkels
- Einsatzmöglichkeiten im Sachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Kennzeichnung der Unterrichtsform Lernzirkel. Es werden die Entscheidungsfreiheiten der Schüler, die Funktion des Lehrers, die Aspekte der Materialbeschaffenheit und der Unterrichtsablauf im Detail erläutert. Dabei wird deutlich, dass Lernzirkel eine Form des selbstgesteuerten und wahldifferenzierten Lernens ermöglichen, die den Schülern ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit einräumt.
Das zweite Kapitel widmet sich den Lernpotentialen von Lernzirkeln. Es werden die Vorteile der Selbsttätigkeit und Selbststeuerung sowie weitere wichtige Lernpotentialen wie die Förderung der Sozialkompetenz, die Entwicklung von Problemlösungsstrategien und die Stärkung der Motivation beleuchtet.
Das dritte Kapitel behandelt die Probleme und Grenzen von Lernzirkeln. Es werden Herausforderungen wie die Planung und Organisation, die Materialbeschaffung, die Differenzierung und die Beurteilung der Schülerleistungen diskutiert.
Das vierte Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung des Lernzirkels. Es werden die Ursprünge dieser Unterrichtsform im Leistungssport sowie die Weiterentwicklung im Bildungsbereich dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Lernzirkel, Unterrichtsform, Selbstständigkeit, Selbststeuerung, Wahldifferenzierung, Lernpotentialen, Probleme, Grenzen, geschichtliche Entwicklung, Sachunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Lernzirkel im Unterricht?
Ein Lernzirkel ist eine Unterrichtsform, bei der Schüler selbstständig verschiedene Stationen zu einem Thema bearbeiten und dabei über Auswahl und Reihenfolge entscheiden können.
Woher stammt der Begriff „Lernzirkel“ ursprünglich?
Der Begriff stammt aus dem Leistungssport (Zirkeltraining), wo verschiedene Übungen nacheinander in einem Kreislauf absolviert werden.
Welche Rolle hat die Lehrkraft in einem Lernzirkel?
Der Lehrer fungiert weniger als Wissensvermittler, sondern eher als Lernbegleiter, Berater und Organisator der Lernumgebung.
Was sind die Vorteile von Stationenlernen?
Es fördert die Selbstständigkeit, ermöglicht unterschiedliche Zugangswege (Sinne) und stärkt die Sozialkompetenz durch Gruppenarbeit.
Gibt es Grenzen oder Probleme bei Lernzirkeln?
Herausforderungen liegen in der aufwendigen Vorbereitung, der Materialbeschaffung sowie der Schwierigkeit, alle Schülerleistungen individuell zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Silke Klein (Autor:in), 2006, Lernsituationen gestalten – Lernzirkel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129346