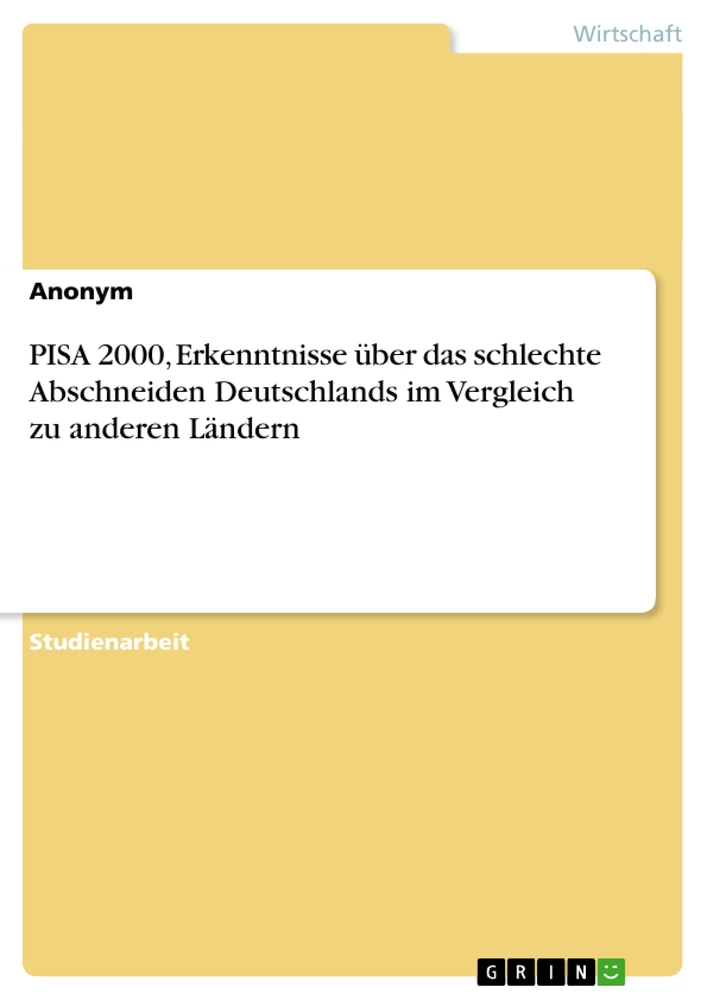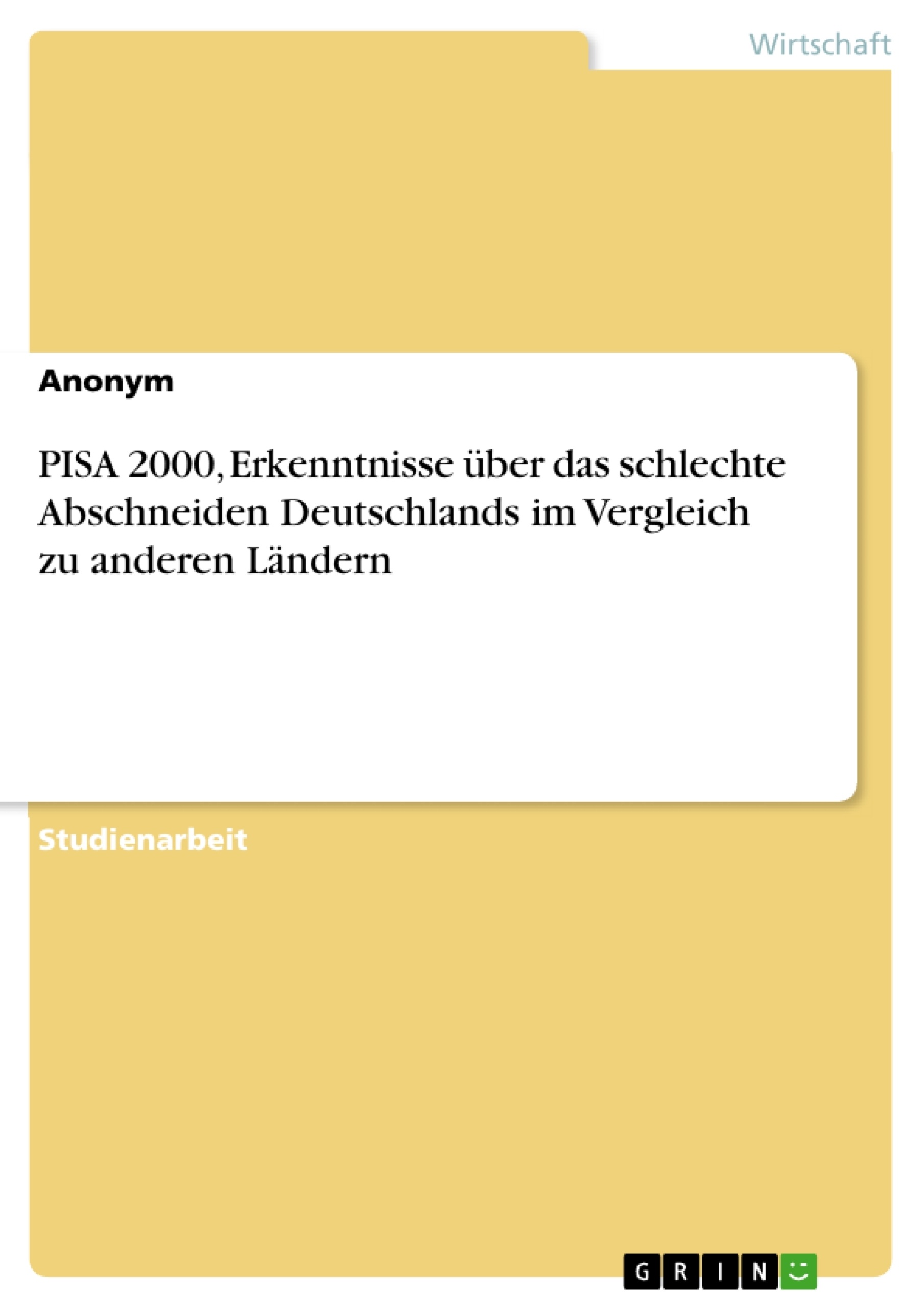Einleitung
Die Schulbildung eines jungen Menschen, wenn er die Schule verlässt, kann ausschlaggebend für sein weiteres Leben sein. Nicht nur die Tatsache, daß einem zum Beispiel mit Abitur mehr Möglichkeiten offen stehen, sondern viele auch automatisch als intelligenter als Schüler mit Hauptschulabschluss eingestuft werden, ist von entscheidender Bedeutung. Oft dient der schulische Werdegang auch dazu, die Schüler und Schülerinnen in einem gewissen Maß auf ihr zukünftiges Berufsleben vorzubereiten, sowie ihnen gesellschaftliche Normen näher zu bringen und unter anderem auch das Miteinander in der Gemeinschaft zu erproben. Doch ist es nicht möglich, daß einigen Kindern von vornherein versagt bleibt, auf eine bessere Schule zu gehen oder einen höheren Abschluss zu erlangen? Wie kommt es, daß manche Jugendliche oft auch überhaupt keinen Wert auf einen guten Abschluss legen und der Schule keine Bedeutung beimessen? Was ist der Grund dafür, daß Schüler und Schülerinnen es nicht schaffen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren? Dies kann sich ja auch negativ auf die schulische Leistung ausüben. Und was bewegt Eltern dazu , ihre Kinder trotz guter Leistungen in der Grundschule nicht auf das Gymnasium zu schicken?
Kann es sein, daß oft auch finanzielle oder familiäre Hintergründe eine wichtige Rolle bei der Schulbildung eines Menschen spielen, verbunden mit dem durch das Bildungssystem eines Landes gegebenen Voraussetzungen?
Diese und weitere Fragen zu den Hintergründen der schulischen Leistungen sollen diskutiert werden, sowie der Versuch zur Beantwortung dieser Fragestellungen angestrebt wird.
Eingegangen wird dabei auf die PISA-Studie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unterschiede zwischen den Schulleistungen der teilnehmenden Länder aufzudecken und die Einflussfaktoren dafür zu ermitteln. Im Vordergrund steht dabei auch das Problem der Beeinflussung solcher Faktoren durch das Schulsystem und -umfeld eines Landes und die damit verbundene Auswirkung auf die Qualifikation eines Menschen.
Oft werden soziale und ökonomische Faktoren genannt, denen eine Bedeutung beigemessen wird, doch konnten diese nie belegt werden. Dies sollte anhand der PISA-Studie geändert werden. Man erhoffte sich aus dem Vergleich von mehreren Ländern mit unterschiedlichen Gestaltungen der Schulpolitik zu erfahren, welche Konstellation der schulpolitischen Maßnahmen zum Erfolg führt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollen im Folgenden dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. PISA - die Schulstudie im Überblick
- 2.1. PISA international
- 2.2. PISA Deutschland
- 2.3. PISA Ziele
- 2.4. PISA Durchführung
- 2.5. PISA Methoden
- 3. Aufgaben
- 3.1. Lesekompetenz
- 3.2. Mathematische Grundbildung
- 3.3. Naturwissenschaftliche Grundbildung
- 3.4. Fächerübergreifende Kompetenzen
- 4. Ergebnisse des 1. Zyklus
- 4.1. Ergebnisse nach Ländern
- 4.2. Allgemeine Erkenntnisse der Studie
- 4.3. PISA-Ergebnisse im Bezug auf Deutschland
- 5. Einflussfaktoren auf die schulische Leistung
- 5.1. Familiärer Hintergrund und Soziales Umfeld
- 5.1.2. Familiärer Wohlstand
- 5.1.3. Kommunikation über soziale und kulturelle Fragen
- 5.1.4. Integration von Kindern anderer Herkunft
- 5.1.5. Schlussfolgerung
- 5.2. Individuelle Unterschiede zwischen den Schülern und Schülerinnen
- 5.2.1. Motivation im Bezug auf die Schule
- 5.2.2. Fachbezogenes Interesse
- 5.2.3. Allgemeine Schulzufriedenheit
- 5.2.4. Schlussbetrachtung
- 5.3. Das Lernumfeld und die Schulorganisation
- 5.3.1. Schul- und Unterrichtsklima
- 5.3.2. Investitionen in das Bildungswesen
- 5.3.3. Methoden der Verwaltung und Finanzierung der Schulen
- 5.3.4. Schlussbetrachtung
- 5.4. Vergleich der Schulsysteme im Bezug auf das deutsche System
- 5.4.1. Bildungsbeteiligung im Alter von 3 bis unter 6 Jahre
- 5.4.2. Selektion durch Schulform
- 5.4.3. Abschlussquoten im Sekundarbereich
- 5.4.4. Ganztagsschule
- 5.4.5. Anzahl der Schulstunden
- 5.4.6. Öffentliche Ausgaben für Bildungseinrichtungen
- 5.1. Familiärer Hintergrund und Soziales Umfeld
- 6. Beispiele anhand der „Gewinner“
- 6.1. Finnland
- 6.2. Kanada
- 6.3. Japan
- 7. Konsequenzen und Reaktionen aus der PISA-Studie
- 7.1. Deutsche Bevölkerung
- 7.2. Bund und Länder
- 8. Resume
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie, um das schlechte Abschneiden Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern zu verstehen. Die Studie untersucht die Leistungen von 15-jährigen Schülern in den Bereichen Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften und analysiert die Einflussfaktoren auf die schulische Leistung.
- Die PISA-Studie und ihre Ergebnisse
- Der Vergleich von Schulsystemen und Bildungspolitik
- Einflussfaktoren auf die schulische Leistung: Familiärer Hintergrund, individuelles Lernen und Schulorganisation
- Beispiele von erfolgreichen Bildungssystemen in anderen Ländern
- Konsequenzen und Reaktionen auf die PISA-Studie in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt die PISA-Studie ein und stellt die Relevanz der schulischen Leistungen im Hinblick auf die Zukunft junger Menschen in den Vordergrund. Die Studie will die Unterschiede in den Schulleistungen von teilnehmenden Ländern und deren Einflussfaktoren aufdecken. Es werden Fragen nach der Bedeutung von sozialen und ökonomischen Faktoren und dem Einfluss des Schulsystems auf die Qualifikation eines Menschen aufgeworfen.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die PISA-Studie, ihre Ziele und Methoden. Die Studie wird international von der OECD durchgeführt und umfasst die Leistungen von 15-Jährigen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Darüber hinaus werden fächerübergreifende Kompetenzen erfasst, um die Anwendung von Wissen im Alltag zu beurteilen. Das Kapitel beschreibt auch die nationale Durchführung der PISA-Studie in Deutschland.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der PISA-Studie, einschließlich der Unterschiede in den Leistungen verschiedener Länder und der allgemeinen Erkenntnisse. Die Studie zeigt die Bedeutung von Faktoren wie Familienhintergrund, individuelles Lernen und Schulorganisation auf.
Kapitel 5 geht detailliert auf die Einflussfaktoren auf die schulische Leistung ein. Es untersucht den Zusammenhang zwischen dem familiären Hintergrund und den Lernmöglichkeiten von Schülern. Die Kapitel analysieren verschiedene Aspekte wie den familiären Wohlstand, die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund und die Kommunikation über soziale und kulturelle Themen. Weiterhin beleuchtet Kapitel 5 individuelle Unterschiede zwischen Schülern, wie Motivation, Interessen und Schulzufriedenheit. Das Lernumfeld und die Schulorganisation werden ebenfalls untersucht, einschließlich des Schul- und Unterrichtsklimas, der Investitionen in das Bildungswesen und der Verwaltung und Finanzierung von Schulen. Abschließend wird ein Vergleich des deutschen Schulsystems mit anderen Schulsystemen durchgeführt.
Kapitel 6 analysiert Beispiele von "Gewinner"-Ländern, die in der PISA-Studie besonders gute Leistungen zeigten. Die Beispiele von Finnland, Kanada und Japan beleuchten die Erfolgsfaktoren der jeweiligen Bildungssysteme.
Schlüsselwörter
Die PISA-Studie, Bildungspolitik, Schulsystem, Schulische Leistung, Einflussfaktoren, Familienhintergrund, Individualität, Lernumfeld, Schulorganisation, Vergleich von Schulsystemen, Bildungsbeteiligung, Abschlussquoten, Ganztagsschule, Öffentliche Ausgaben für Bildung, Bildungsqualität, internationaler Vergleich, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum hat Deutschland in der PISA-Studie 2000 schlecht abgeschnitten?
Die Arbeit analysiert Faktoren wie den starken Einfluss des familiären Hintergrunds, soziale Selektion durch das Schulsystem und mangelnde individuelle Förderung.
Welche Kompetenzbereiche wurden bei PISA untersucht?
Untersucht wurden Lesekompetenz, mathematische Grundbildung, naturwissenschaftliche Grundbildung sowie fächerübergreifende Kompetenzen.
Welche Länder gelten als "Gewinner" der Studie?
Als erfolgreiche Beispiele werden in der Arbeit Finnland, Kanada und Japan näher beleuchtet.
Spielt der familiäre Wohlstand eine Rolle für den Schulerfolg?
Ja, die Studie belegt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem sozialen Umfeld, dem Wohlstand der Eltern und der schulischen Leistung der Kinder.
Was sind die Konsequenzen aus PISA für Deutschland?
Die Arbeit diskutiert Reaktionen von Bund und Ländern, wie etwa den Ausbau von Ganztagsschulen und Änderungen in der Bildungspolitik.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2002, PISA 2000, Erkenntnisse über das schlechte Abschneiden Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12938