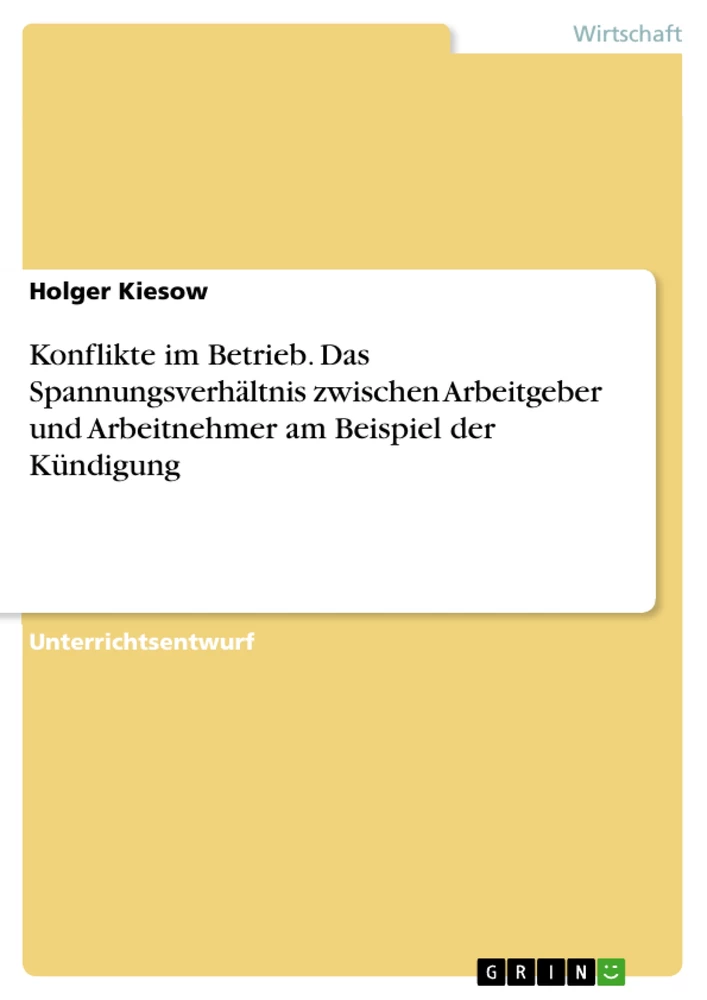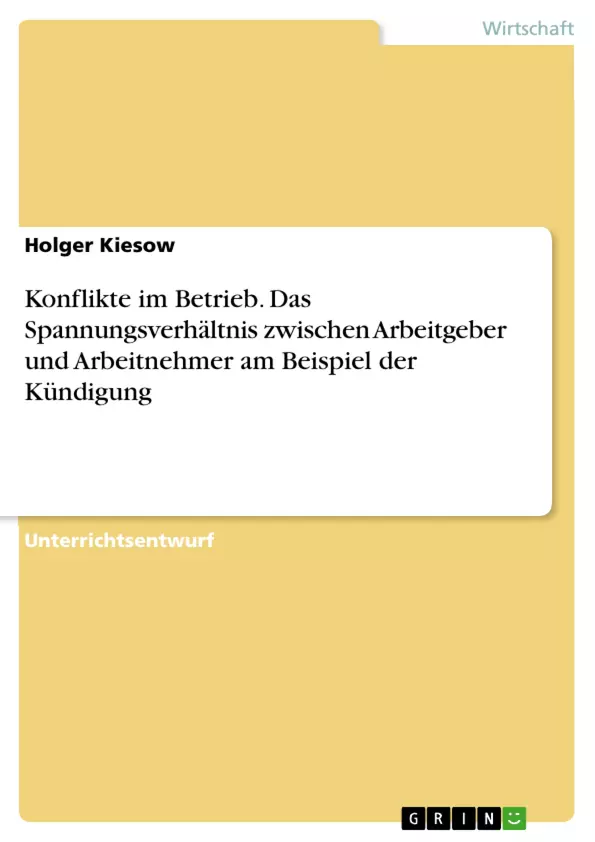Diese Unterrichtsstunde wurde als Prüfungsstunde in der Einheit "Das Unternehmen als wirtschaftliches Aktionszentrum" in einer neunten Klasse im Fach Politik/Wirtschaft gehalten. Die Unterrichtsstunde ist größtenteils als Rollenspiel konzipiert, in dem die Schüler in der Rolle eines Unternehmers gezwungen werden, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Sie müssen sich zwischen mehreren Personen entscheiden, wem sie kündigen wollen.
Dazu werden ihnen unterschiedliche fiktive Personen vorgestellt.
Der Entwurf enthält zudem alle nötigen Materialien.
Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung der Lerngruppe
- Einordnung in den Unterrichtszusammenhang
- Sachanalyse
- Didaktische Überlegungen
- Lernziele
- Methodische Überlegungen
- Zeitplan
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtsstunde befasst sich mit dem Thema der betriebsbedingten Kündigung im Kontext des Unternehmens als wirtschaftliches und soziales Aktionszentrum. Ziel ist es, die Schüler in die Lage zu versetzen, die Kriterien zu verstehen, nach denen ein Unternehmer bei betriebsbedingten Kündigungen Entscheidungen trifft. Dabei sollen sie die betriebswirtschaftlichen Aspekte dieser Entscheidungen analysieren und bewerten.
- Betriebsbedingte Kündigung als Instrument der Unternehmensführung
- Gewinnmaximierung und soziale Verantwortung im Spannungsfeld
- Kriterien der Auswahl bei betriebsbedingten Kündigungen
- Rolle des Betriebsrates und des Kündigungsschutzgesetzes
- Interdependenz von Wirtschaft und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unterrichtsstunde beginnt mit einer Nachrichtenmeldung, die die Schüler mit der Thematik der betriebsbedingten Kündigung konfrontiert. Die Schüler sollen die Fragestellung der Stunde formulieren, welche an der Tafel fixiert wird. Anschließend werden die Schüler in Gruppenarbeit mit Rollenkarten konfrontiert, die verschiedene Mitarbeiter eines Bäckereibetriebs darstellen. Die Schüler sollen sich in die Rolle des Unternehmers versetzen und entscheiden, welchen Mitarbeiter sie aufgrund der betriebsbedingten Kündigung entlassen würden. Dabei sollen sie die Kriterien der Auswahl diskutieren und hierarchisieren. Die Schüler sollen erkennen, dass die Auswahl und die Gewichtung der Kriterien nicht einfach sind und dass sowohl wirtschaftliche als auch soziale Aspekte berücksichtigt werden müssen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die betriebsbedingte Kündigung, das Unternehmen als wirtschaftliches und soziales Aktionszentrum, die Gewinnmaximierung, die soziale Verantwortung, die Kriterien der Auswahl bei betriebsbedingten Kündigungen, die Rolle des Betriebsrates und des Kündigungsschutzgesetzes sowie die Interdependenz von Wirtschaft und Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine betriebsbedingte Kündigung?
Eine Kündigung, die durch dringende betriebliche Erfordernisse (z.B. Auftragsmangel oder Standortschließung) bedingt ist, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen.
Welche Kriterien spielen bei der Sozialauswahl eine Rolle?
Nach dem Kündigungsschutzgesetz müssen Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und eine etwaige Schwerbehinderung berücksichtigt werden.
Welche Aufgabe hat der Betriebsrat bei Kündigungen?
Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat vor jeder Kündigung anhören. Eine Kündigung ohne diese Anhörung ist unwirksam.
Wie stehen Gewinnmaximierung und soziale Verantwortung im Konflikt?
Unternehmer müssen oft zwischen der wirtschaftlichen Sanierung des Betriebs (Kosten senken) und der sozialen Absicherung ihrer langjährigen Mitarbeiter abwägen.
Was ist das Ziel des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG)?
Es soll Arbeitnehmer vor willkürlichen Kündigungen schützen und sicherstellen, dass Entlassungen sozial gerechtfertigt und nachvollziehbar sind.
- Quote paper
- Holger Kiesow (Author), 2008, Konflikte im Betrieb. Das Spannungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Beispiel der Kündigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129455