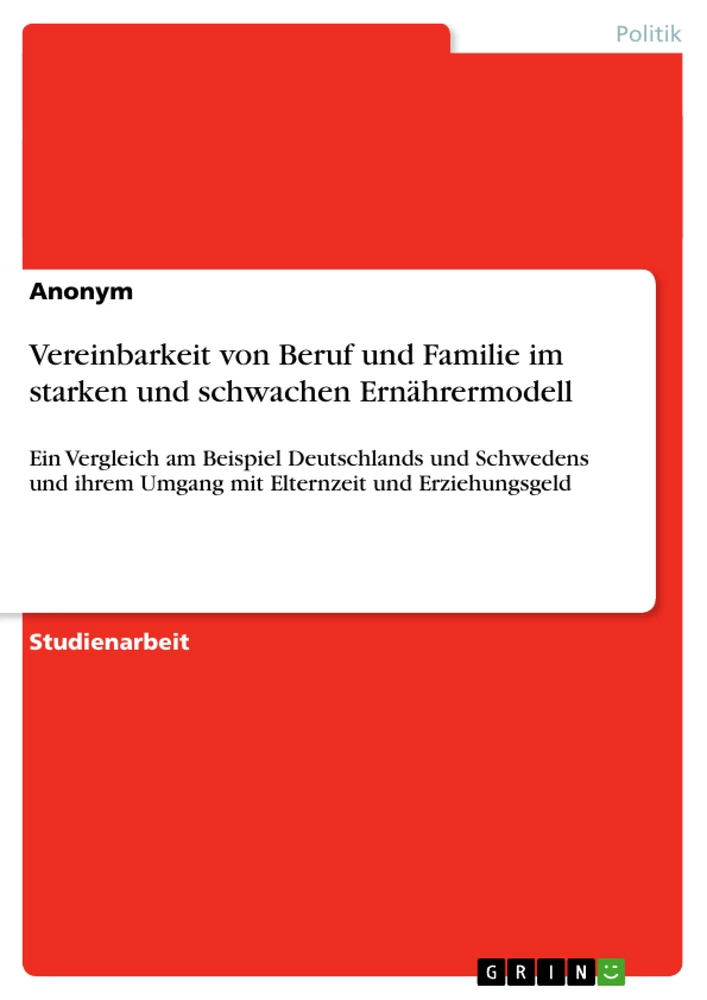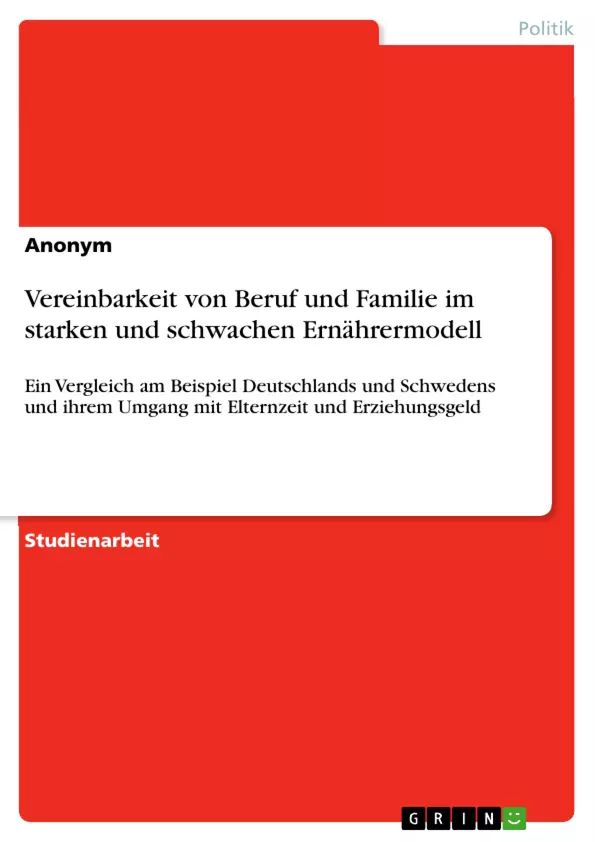Bereits in den siebziger Jahren begann Schweden als erstes europäisches Land, seine Sozialpolitik zugunsten mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auszurichten. Als Resultat dessen gilt Schweden heute in der Forschung als Musterbeispiel eines so genannten „schwachen Ernährermodells“. Das Gegenstück dazu, das „starke Ernährermodell“, wird unter anderem von Deutschland verkörpert.
Ausgangspunkt für diese Klassifizierung bildet die wohlfahrtsstaatliche Sozialpolitik, die in ihrer Gestaltung qualitativ variieren kann. So sorgt sie dafür, dass die geschlechterspezifische Arbeitsteilung im starken Modell gefestigt oder im schwachen Modell verringert wird.
Das Konzept der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung wiederum beruht zumeist auf einem traditionellen Leitbild, welches Frauen primär die unbezahlte Reproduktions- und Sorgearbeit und Männern die marktvermittelte Lohnarbeit zuweist. Eine derartige Arbeitsteilung ist ein Grund, weshalb es zum Auftreten von Geschlechterungleichheit kommt.
Im Zentrum dieser Arbeit soll nun die Überlegung stehen, inwiefern es möglich ist, durch Übertragung bestimmter sozialpolitischer Elemente eines schwachen auf ein starkes Ernährermodell, im starken Modell mehr Gleichberechtigung zu erzielen.
Da ein wichtiges Element in der Vermittlung zwischen Familie und Beruf die Elternzeit- und Erziehungsgeldregelung ist, erscheint es interessant, den Umgang Schwedens (als Beispiel eines schwachen Ernährermodells) dem Umgang Deutschlands mit dieser Problematik (als Beispiel eines starken Ernährermodells) gegenüberzustellen.
Im Folgenden werden zunächst in einem kurzen Abriss die Grundzüge der beiden Modelle erläutert. Anschließend wird die konkrete Ausgestaltung der Elternzeit- und Erziehungsgeldregelung in Deutschland betrachtet, bevor diese der schwedischen Elternversicherung gegenübergestellt wird. Danach wird der Vergleich nach ausgewählten Kriterien fortgesetzt. Bevor aus der Auswertung des Vergleichs Schlussfolgerungen für Deutschland gezogen werden, wird darüber diskutiert, inwiefern der Staat überhaupt Möglichkeiten bietet, durch Gesetze in die individuelle Lebensgestaltung seiner Bürger einzugreifen und diese zu regulieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erläuterungen zur Klassifizierung des „Männlichen Ernährermodells“
- 3 Vergleich von Elternzeit und Erziehungsgeld im starken und schwachen Ernährermodell am Beispiel Deutschlands und Schwedens
- 3.1 Ausgestaltung der Elternzeit und des Erziehungsgeldes
- 3.1.1 Deutschland – Beispiel eines starken Ernährermodells
- 3.1.2 Schweden - Beispiel eines schwachen Ernährermodells
- 3.2 Vergleich nach ausgesuchten Kriterien
- 3.2.1 Väterbeteiligung und Arbeitsteilung
- 3.2.2 Frauenerwerbsquote
- 3.2.3 Geburtenrate
- 3.2.4 Geldleistungen contra Dienstleistungen
- 3.2.5 Leitbilder
- 3.1 Ausgestaltung der Elternzeit und des Erziehungsgeldes
- 4 Theoretisches zur Arbeitsteilung
- 5 Ableitungen für Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im starken und schwachen Ernährermodell, anhand eines Vergleichs zwischen Deutschland und Schweden. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit sozialpolitische Elemente des schwedischen Modells (schwaches Ernährermodell) auf das deutsche Modell (starkes Ernährermodell) übertragen werden können, um mehr Gleichberechtigung zu erreichen. Die Fokussierung liegt dabei auf den Regelungen zur Elternzeit und zum Erziehungsgeld.
- Vergleich des starken (Deutschland) und schwachen (Schweden) Ernährermodells
- Analyse der Elternzeit- und Erziehungsgeldregelungen in Deutschland und Schweden
- Untersuchung der Auswirkungen der unterschiedlichen Modelle auf Väterbeteiligung, Frauenerwerbsquote und Geburtenrate
- Bewertung der Rolle staatlicher Eingriffe in die individuelle Lebensgestaltung
- Ableitung von Schlussfolgerungen für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein und stellt Schweden als Beispiel eines schwachen und Deutschland als Beispiel eines starken Ernährermodells vor. Sie begründet die Wahl dieser Länder für den Vergleich und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Rolle der sozialpolitischen Maßnahmen, insbesondere Elternzeit und Erziehungsgeld, bei der Gestaltung der Geschlechterrollen und der Arbeitsteilung.
2 Erläuterungen zur Klassifizierung des „Männlichen Ernährermodells“: Dieses Kapitel erläutert die Klassifizierung von Wohlfahrtsstaaten in starke, moderate und schwache Ernährermodelle nach Lewis und Ostner. Es konzentriert sich auf den Vergleich des starken und schwachen Modells, wobei das starke Modell durch eine niedrige Müttererwerbstätigkeit, abgeleitete Sozialleistungen für Frauen und die Priorisierung der privaten Fürsorgearbeit durch Frauen gekennzeichnet ist. Das schwache Modell hingegen zeichnet sich durch hohe Frauen- und Müttererwerbsquoten, geschlechtsneutrale Sicherungssysteme und umfassende Sozialleistungen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus.
3 Vergleich von Elternzeit und Erziehungsgeld im starken und schwachen Ernährermodell am Beispiel Deutschlands und Schwedens: Dieses Kapitel vergleicht die Ausgestaltung der Elternzeit und des Erziehungsgeldes in Deutschland und Schweden. Es analysiert die Unterschiede in den jeweiligen Systemen und beleuchtet die Auswirkungen auf verschiedene Indikatoren wie Väterbeteiligung, Frauenerwerbsquote und Geburtenrate. Der Vergleich soll Aufschluss darüber geben, wie die unterschiedlichen sozialpolitischen Ansätze die Geschlechterrollen und die Arbeitsteilung beeinflussen.
4 Theoretisches zur Arbeitsteilung: Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen für die Analyse der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und untersucht die Zusammenhänge zwischen den betrachteten sozialpolitischen Maßnahmen, der Arbeitsteilung und der Geschlechtergleichstellung.
Schlüsselwörter
Männliches Ernährermodell, starkes Ernährermodell, schwaches Ernährermodell, Elternzeit, Erziehungsgeld, Geschlechtergleichstellung, Arbeitsteilung, Schweden, Deutschland, Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaat, Väterbeteiligung, Frauenerwerbsquote, Geburtenrate.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vergleich des starken und schwachen Ernährermodells in Deutschland und Schweden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht das starke Ernährermodell Deutschlands mit dem schwachen Ernährermodell Schwedens, fokussiert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Elternzeit- und Erziehungsgeldregelungen und deren Auswirkungen auf Geschlechterrollen, Arbeitsteilung und demografische Indikatoren.
Welche Länder werden verglichen und warum?
Deutschland repräsentiert das starke Ernährermodell, Schweden das schwache. Diese Länder wurden ausgewählt, da sie deutlich unterschiedliche sozialpolitische Ansätze in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aufweisen, die einen aussagekräftigen Vergleich ermöglichen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ausgestaltung der Elternzeit und des Erziehungsgeldes in beiden Ländern, analysiert die Auswirkungen auf die Väterbeteiligung, die Frauenerwerbsquote und die Geburtenrate. Sie untersucht die Rolle staatlicher Eingriffe in die individuelle Lebensgestaltung und bietet einen theoretischen Rahmen zur Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern.
Wie werden die Modelle "starkes" und "schwaches Ernährermodell" definiert?
Die Arbeit erläutert die Klassifizierung nach Lewis und Ostner. Das starke Modell zeichnet sich durch niedrige Müttererwerbstätigkeit, abgeleitete Sozialleistungen für Frauen und die Priorisierung der privaten Fürsorgearbeit durch Frauen aus. Das schwache Modell hingegen zeigt hohe Frauen- und Müttererwerbsquoten, geschlechtsneutrale Sicherungssysteme und umfassende Sozialleistungen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit leitet Schlussfolgerungen für Deutschland ab, inwieweit sozialpolitische Elemente des schwedischen Modells auf das deutsche Modell übertragen werden können, um mehr Gleichberechtigung zu erreichen. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel 5 ("Ableitungen für Deutschland") detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Männliches Ernährermodell, starkes Ernährermodell, schwaches Ernährermodell, Elternzeit, Erziehungsgeld, Geschlechtergleichstellung, Arbeitsteilung, Schweden, Deutschland, Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaat, Väterbeteiligung, Frauenerwerbsquote, Geburtenrate.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Klassifizierung des männlichen Ernährermodells, ein Kapitel zum Vergleich von Elternzeit und Erziehungsgeld in Deutschland und Schweden, ein Kapitel zu theoretischen Aspekten der Arbeitsteilung und ein Kapitel mit Schlussfolgerungen für Deutschland.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse, inwieweit sozialpolitische Elemente des schwedischen Modells auf das deutsche Modell übertragen werden können, um mehr Gleichberechtigung zu erreichen. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen der unterschiedlichen Systeme auf Väterbeteiligung, Frauenerwerbsquote und Geburtenrate.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Vereinbarkeit von Beruf und Familie im starken und schwachen Ernährermodell , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129533