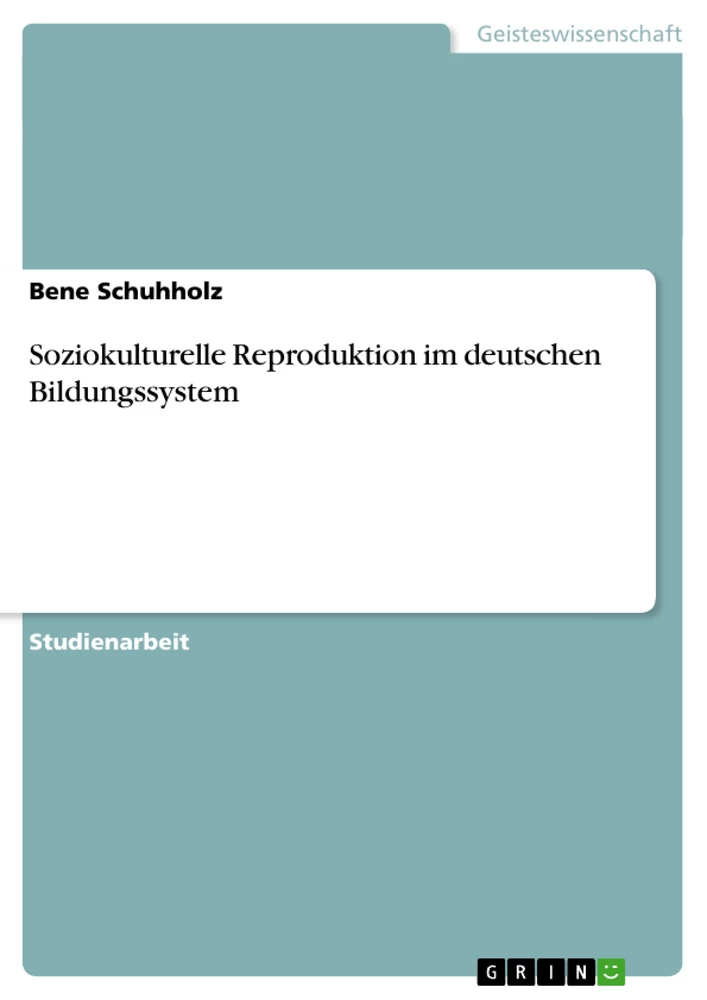Einleitung
Die Bildungsexpansion kann als die wichtigste Veränderung im Bildungswesen der letzten Jahrzehnte gewertet werden. Zielsetzung dieser Bildungsexpansion war unter anderem, die Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten zu verbessern. Eine Chancengleichheit besteht jedoch nur formal, wie die PISA-Studie bestätigt hat. Theoretisch ist es jedem möglich, die Schulbildung zu erhalten, zu der er befähigt ist. So gilt hierbei das Leistungsprinzip, d.h. dass jeder nach der tatsächlich erbrachten Leistung bewertet und eingestuft wird und aufgrund dieser weitere Zulassungen erhält. Eine Selektion nach wirtschaftlicher Situation oder Schichtzugehörigkeit wird öffentlich dementiert, der Zugang zur Bildung stehe jedem gleichermaßen offen. Unterzieht man das deutsche Bildungssystem nur einer oberflächlichen Betrachtung, wird dieser Schein gewahrt. Eine tiefergehende Untersuchung zeigt jedoch deutlich, dass dadurch einige einflussreiche Faktoren, die den Zugang zur Bildung ebenfalls bedingen, außen vor gelassen werden und unberücksichtigt bleiben. Solche Faktoren sind zum Beispiel die soziale Stellung der Eltern, deren wirtschaftliche Lage und die Einbindung in das soziale Netzwerk. Unter anderem ergab die PISA-Studie, dass das deutsche Bildungssystem im Bezug auf die soziale Vererbung bzw. die Weitergabe des sozialen Status das selektivste ist. Dies zeigt, dass der Begriff der Chancengleichheit bei einer tiefer greifenden Betrachtung nicht haltbar ist. Statistiken weisen zum Beispiel deutlich nach, dass der Anteil der Kinder aus Arbeiterfamilien in höheren Bildungsgängen deutlich niedriger ist als beispielsweise der Anteil der Kinder der Freiberuflichen und Führungskräften. Der Anteil der Arbeiterkinder an Universitäten in Deutschland beläuft sich auf nur etwa 2 %. Dies lässt sich sicherlich nicht auf eine geringere naturgegebene Begabung der Kinder in unteren Schichten zurückführen. Es müssen im Gegenteil andere Gründe hierfür in Betracht gezogen werden.
In dieser Arbeit sollen mögliche direkte und indirekte Faktoren, die den Zugang zur Bildung beeinflussen herausgearbeitet werden. Die daraus entstandenen Modelle sollen, anhand des im Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Konstanz und Zürich von Herrn Prof. Dr. Helmut Fend und Herrn Prof. Dr. Werner Georg erhobenen Datensatz überprüft werden...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Einführung
- Bourdieu/Passeron: „Die Illusion der Chancengleichheit“
- Der Kapitalbegriff in den Sozialwissenschaften
- Pierre Bourdieu: „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“
- Das kulturelle Kapital
- Das soziale Kapital
- Die Kapitalumwandlung
- Paul DiMaggio: „Cultural capital and school success: the impact of status culture participation on the grades of u.s. high school students“
- Empirische Phase
- Deskripitve Statistik
- Formulierung der Hypothesen
- Nominaldefinition der Begriffe und Variablen
- Faktorenanalyse: Kulturelles Kapital
- Regressionsanalysen
- Überprüfung der Hypothesen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der soziokulturellen Reproduktion im deutschen Bildungssystem. Ziel ist es, die direkten und indirekten Faktoren zu beleuchten, die den Zugang zur Bildung beeinflussen. Die Arbeit stützt sich auf die von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron entwickelten Theorien und analysiert die Daten des Gemeinschaftsprojekts der Universitäten Konstanz und Zürich.
- Die Illusion der Chancengleichheit im Bildungssystem
- Der Einfluss von Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales) auf den Bildungserfolg
- Soziale Selektion und die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem
- Empirische Überprüfung der Theorien anhand von Daten aus dem Gemeinschaftsprojekt Konstanz/Zürich
- Analyse der Faktoren, die die Bildungsbeteiligung verschiedener Schichten beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Bildungsexpansion und den scheinbaren Widerspruch zur fehlenden Chancengleichheit dar. Sie führt die PISA-Studie als Beispiel für die Selektivität des deutschen Bildungssystems an.
Kapitel 2.1 widmet sich der Theorie von Bourdieu/Passeron „Die Illusion der Chancengleichheit“, wobei die Ergebnisse auf die Situation in Frankreich in den 60er und 70er Jahren basieren.
Kapitel 3 beleuchtet den Kapitalbegriff in den Sozialwissenschaften, insbesondere die drei Kapitalformen von Pierre Bourdieu: ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital und soziales Kapital. Außerdem wird die Kapitalumwandlung erläutert.
Kapitel 4 fasst die Arbeit von Paul DiMaggio „Cultural capital and school success“ zusammen, die den Einfluss von kulturellem Kapital auf den Schulerfolg untersucht.
Kapitel 5 beschreibt die empirische Phase der Hausarbeit, die die Daten des Gemeinschaftsprojekts Konstanz/Zürich einbezieht. Es werden Methoden wie deskriptive Statistik, Hypothesenformulierung, Variablendefinition, Faktorenanalyse und Regressionsanalysen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die soziokulturelle Reproduktion, Bildungsungleichheit, Chancengleichheit, Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales), Bildungstrichter, soziale Selektion, Schichtzugehörigkeit, Bildungsbeteiligung, PISA-Studie, Gemeinschaftsprojekt Konstanz/Zürich.
Häufig gestellte Fragen
Besteht im deutschen Bildungssystem wirklich Chancengleichheit?
Die Arbeit zeigt auf, dass Chancengleichheit oft nur formal besteht, während soziale Herkunft und wirtschaftliche Lage den Zugang faktisch stark einschränken.
Was bedeuten ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital?
Nach Pierre Bourdieu umfasst Kapital nicht nur Geld (ökonomisch), sondern auch Bildung und Wissen (kulturell) sowie Netzwerke und Beziehungen (sozial).
Was besagt die Theorie der „sozialen Vererbung“?
Sie beschreibt, dass der soziale Status der Eltern oft an die Kinder weitergegeben wird, was das deutsche Bildungssystem laut PISA-Studien besonders stark prägt.
Wie hoch ist der Anteil von Arbeiterkindern an Universitäten?
Laut der Arbeit beläuft sich der Anteil der Kinder aus Arbeiterfamilien an deutschen Universitäten auf nur etwa 2 %.
Welchen Einfluss hat kulturelles Kapital auf den Schulerfolg?
Kulturelles Kapital (z. B. Teilnahme an Hochkultur) wirkt sich laut Studien wie der von Paul DiMaggio positiv auf Schulnoten und Bildungserfolg aus.
- Quote paper
- Bene Schuhholz (Author), 2003, Soziokulturelle Reproduktion im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12954