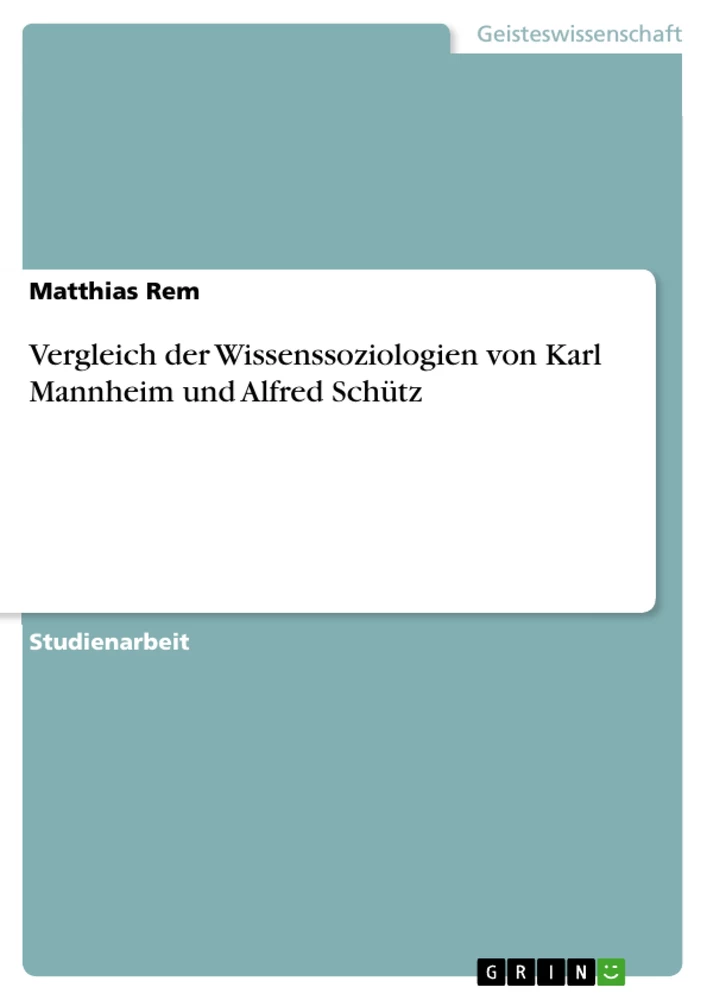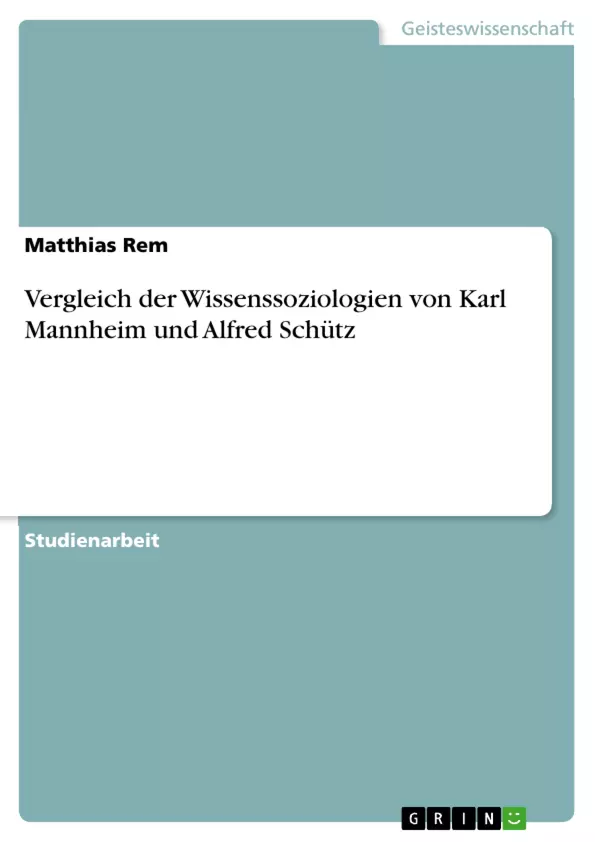Wir leben heute in einer multimedial geprägten Welt. Es sollte mit der fortschreitenden Technik immer einfacher werden, Antworten zu finden. Mussten vor einigen Jahren noch Bibliotheken durchforstet werden, reicht heute ein Computer mit Internetanschluss aus, um an riesige Wissensbestände heranzukommen. Bei der Suche nach einer eindeutigen Antwort zu gewissen Fragen tauchen dann aber schnell mehrere Antworten auf. Ein Philosoph wird die Frage nach dem Sinn des Lebens zum Beispiel mit dem Begriff „Erfahren“ beantworten, während ein Biologe die Fortpflanzung als den Sinn des Lebens betrachtet. Selbst ein Wahnsinniger sieht seine in „normalen Augen“ wahnsinnige Welt als Wirklichkeit an. Oder betrachten wir nur einmal die verschiedenen Weltkonstruktionen jeglicher Religionen. Selbst bei einfacheren Fragen werden je nach Perspektive die Antworten unterschiedlich ausfallen. Es liegt daher nahe, dass es nicht eine richtige Wahrheit gibt. Vielmehr gibt es viele Wahrheiten, welche sich durchaus unterscheiden können. Die soziologische Disziplin der Wissenssoziologie beschäftigt sich mit diesem Problem. Wie entsteht Wissen? Wer bestimmt, welches das „richtige Wissen“ ist? Und wie wird dieses entstandene Wissen konserviert oder transformiert? Möglich wurde diese neue Sicht der Dinge durch die Entdeckung des Beobachters, welcher bildlich einen Schritt zurückgeht, um das Ganze von „ausserhalb“ zu betrachten. Dabei kommt die Disziplin zum Schluss, „[…]dass Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert ist – und – dass die Wissenssoziologie die Prozesse zu untersuchen hat, in denen dies geschieht“ (Berger und Luckmann 1969: V).
Diese Disziplin kann nicht einem einzelnen Autor zugeschrieben werden. Diese Arbeit konzentriert sich auf den deutschen Raum. Als einige der wichtigsten Mitbegründer dürften Alfred Schütz und Karl Mannheim zählen. Entstanden ist die Wissenssoziologie in den 1920er Jahren (Berger und Luckmann 1969: 3f).
Es gilt nun, das theoretische Konstrukt der Wissenssoziologie von Schütz und Mannheim zu verstehen. Es erscheint dabei am einfachsten, jeden von ihnen zuerst einzeln unter die Lupe zu nehmen.
Die Herangehensweise an das Problem der Wissenssoziologie ist bei beiden Autoren ziemlich unterschiedlich. Es wird versucht, ihre Wissenssoziologien anhand der wesentlichsten Punkte verständlich zu machen. Am Ende folgt ein Vergleich, welcher zeigen wird, dass trotz der Unterschiede ein gemeinsamer Nenner existiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissenssoziologie Alfred Schütz
- Biografie
- Wissenssoziologie
- Sinnprovinzen
- Alltagswelt
- Phantasiewelt
- Theoretisch-wissenschaftliche Welt
- Entstehung von subjektivem Wissen
- Drei Wissensarten
- Entstehung des gesellschaftlichen Wissens
- Sinnprovinzen
- Wissenssoziologie Karl Mannheim
- Biographie
- Wissenssoziologie
- Ideologie
- Transformierung von Wissen
- Vergleich
- Ziele der Wissenssoziologie
- Das subjektive Wissen
- Das gesellschaftliche Wissen
- Fazit des Vergleichs
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Wissenssoziologie von Alfred Schütz und Karl Mannheim. Ziel ist es, die theoretischen Konstrukte beider Autoren zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden die Entstehung und Transformation von Wissen sowie die unterschiedlichen Perspektiven auf die Alltagswelt und die wissenschaftliche Welt beleuchtet.
- Die Entstehung von Wissen aus unterschiedlichen Perspektiven
- Die Rolle der Alltagswelt und der wissenschaftlichen Welt in der Wissensproduktion
- Die Bedeutung von Sinnprovinzen für die Konstruktion von Wissen
- Die Transformation von Wissen in der Gesellschaft
- Der Einfluss von Ideologie auf die Wissensproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Wissenssoziologie in der heutigen multimedialen Welt aufzeigt. Anschließend wird die Biografie von Alfred Schütz beleuchtet, um seinen Einfluss auf die Wissenssoziologie zu verstehen. Im zweiten Kapitel wird Schützs Wissenssoziologie anhand seiner drei Sinnprovinzen (Alltagswelt, Phantasiewelt, theoretisch-wissenschaftliche Welt) sowie der Entstehung von subjektivem und gesellschaftlichem Wissen erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Wissenssoziologie von Karl Mannheim. Hier werden seine Konzepte von Ideologie und der Transformation von Wissen vorgestellt. Im vierten Kapitel erfolgt ein Vergleich der beiden Wissenssoziologien, wobei die Ziele, das subjektive und gesellschaftliche Wissen sowie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wissenssoziologie, Alfred Schütz, Karl Mannheim, Sinnprovinzen, Alltagswelt, Phantasiewelt, theoretisch-wissenschaftliche Welt, subjektives Wissen, gesellschaftliches Wissen, Ideologie, Transformation von Wissen, Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptanliegen der Wissenssoziologie?
Sie untersucht die Prozesse, in denen Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert wird, und fragt, wie Wissen entsteht, konserviert und transformiert wird.
Was versteht Alfred Schütz unter „Sinnprovinzen“?
Schütz unterscheidet verschiedene Erfahrungsbereiche wie die Alltagswelt, die Phantasiewelt und die theoretisch-wissenschaftliche Welt, die jeweils eigene Logiken haben.
Welche Rolle spielt die Ideologie bei Karl Mannheim?
Mannheim analysiert, wie das Denken von der sozialen Lage und politischen Interessen (Ideologien) beeinflusst wird und wie dies die Wahrnehmung von Wahrheit prägt.
Wie entsteht subjektives Wissen nach Alfred Schütz?
Es entsteht durch individuelle Erfahrungen und die Einordnung neuer Informationen in bereits bestehende Wissensvorräte.
Gibt es laut der Wissenssoziologie eine einzige „richtige“ Wahrheit?
Nein, die Disziplin geht davon aus, dass es je nach Perspektive und sozialem Kontext viele verschiedene Wahrheiten geben kann.
Was ist der gemeinsame Nenner von Schütz und Mannheim?
Trotz unterschiedlicher Ansätze betonen beide, dass Wissen nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Realität und der Position des Beobachters existiert.
- Quote paper
- Matthias Rem (Author), 2008, Vergleich der Wissenssoziologien von Karl Mannheim und Alfred Schütz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129569