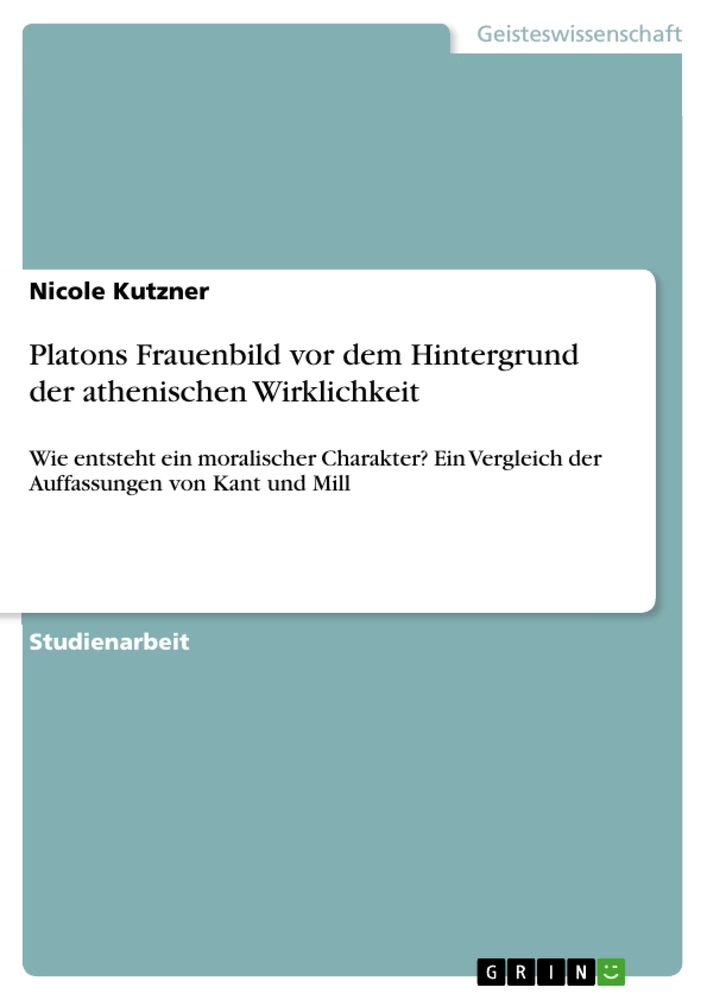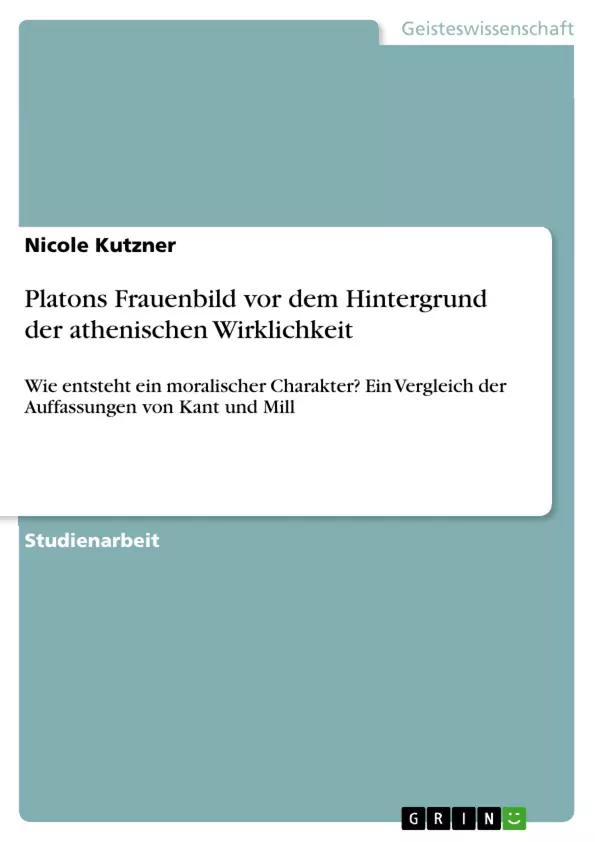Diese Hausarbeit soll das von Platon in seiner Politeia geschilderte, Frauenbild als Schwerpunkt haben. Als Textgrundlage dient hierfür das Fünfte Buch der Politeia.
Zu beachten ist, dass die Politeia um ca. 387 v. Chr. geschrieben wurde und demnach in der klassischen Zeit der Antike (500-300 v. Chr.) anzusiedeln ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es sich bei Platons Schilderungen in der Politeia um eine Utopie handelt, welche mit der athenischen Wirklichkeit nicht verglichen werden kann. Gerade das macht aber den Reiz einer Schilderung des Platonischen Frauenbildes aus.
Im Schlussteil erfolgt schließlich eine kurze Zusammenfassung der platonischen Gedanken bei Gegenüberstellung der athenischen Wirklichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Erziehung der Frau
- 2.1 Die Erziehung der Frau nach dem platonischen Vorbild
- 2.2 Frauenbildung im antiken Athen
- III. Die soziale Stellung der Frau
- 3.1 Die Natur von Mann und Frau
- 3.1.1 Die Gleichheit der Natur von Mann und Frau
- 3.1.2 Die Eignung der Natur der Frau für alle Berufe
- 3.2 Geschlechtersegregation der Frau im klassischen Athen
- 3.2.1 Das Bürgergesetz
- 3.2.2 Der oikos und die damit verbundenen Pflichten
- IV. Die Frauen- und Kindergemeinschaft
- 4.1 Frauen und Kinder als Gemeingut
- 4.1.1 Regelung der Hochzeiten
- 4.1.2 Kindererziehung und Kinderzeugung
- 4.2 Das Privatleben im klassischen Athen
- 4.2.1 Ehe und Familie
- 4.2.2 Eigentum und Besitz
- 4.2.3 Kindererziehung im antiken Athen
- V. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Platons Frauenbild in der Politeia, insbesondere im fünften Buch, vor dem Hintergrund der athenischen Realität der klassischen Zeit (500-300 v. Chr.). Ziel ist es, Platons utopische Vorstellungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten des antiken Athen zu vergleichen und die Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die Neuartigkeit von Platons Thesen im Kontext seiner Zeit.
- Platons Konzept der Frauen-Erziehung und -Ausbildung im Vergleich zur athenischen Praxis.
- Die soziale Stellung der Frau im antiken Athen und in Platons Utopie.
- Die Rolle der Natur von Mann und Frau in Platons Argumentation.
- Die Frauen- und Kindergemeinschaft in Platons Politeia und ihre gesellschaftlichen Implikationen.
- Die Analyse verschiedener Quellen zur Darstellung des Frauenbildes im antiken Athen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, welche darin besteht, Platons Frauenbild in der Politeia im Kontext der athenischen Wirklichkeit zu untersuchen. Es wird die Politeia als utopische Schrift eingeordnet und die Schwierigkeit der Quelleninterpretation im Hinblick auf die idealisierende Darstellung der damaligen Gesellschaft betont. Die Einleitung beschreibt auch die verschiedenen Quellenarten, die für die Arbeit herangezogen werden, und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen in Bezug auf die Darstellung der sozialen Stellung der Frau im antiken Athen. Die unterschiedlichen Quellengattungen wie Tragödie, Komödie, Gerichtsreden und die Werke von Historikern und Philosophen werden hinsichtlich ihrer Aussagekraft bezüglich der Geschlechterverhältnisse analysiert.
II. Die Erziehung der Frau: Dieses Kapitel vergleicht Platons Ansatz zur Frauen-Erziehung mit der Realität im antiken Athen. Platon argumentiert, basierend auf dem Beispiel weiblicher Hunde, für eine gleichberechtigte Erziehung von Frauen und Männern, da beide die gleichen Aufgaben im Staat erfüllen sollten. Er plädiert für eine militärische Ausbildung der Frauen, obwohl er sich der kontroversen Natur dieser Idee bewusst ist. Im Gegensatz dazu wird die athenische Frauenbildung dargestellt, die sich auf die Hauswirtschaft beschränkte, wie aus Xenophons Ökonomischen Schriften hervorgeht. Der stark eingeschränkte Zugang von Frauen zu Bildung und die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten werden gegenübergestellt.
III. Die soziale Stellung der Frau: Dieses Kapitel beleuchtet die soziale Stellung der Frau im antiken Athen und in Platons Philosophie. Platon hinterfragt zunächst die Natur von Mann und Frau, um die Möglichkeit gleicher Aufgaben zu begründen. Er betont die Gleichheit der Natur, welche die gleiche Eignung für verschiedene Berufe ermöglicht. Demgegenüber steht die Geschlechtersegregation im klassischen Athen, mit den gesetzlichen Beschränkungen und den im oikos verankerten Pflichten der Frauen. Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen und die daraus resultierenden Konsequenzen werden hier im Detail verglichen.
IV. Die Frauen- und Kindergemeinschaft: Das Kapitel befasst sich mit Platons radikaler Idee der Frauen- und Kindergemeinschaft in der Politeia. Hierbei werden die Regelungen bezüglich Ehen, Kindererziehung und Kinderzeugung in Platons Utopie dargestellt und mit den familiären Strukturen und Eigentumsverhältnissen im klassischen Athen verglichen. Der Fokus liegt auf den grundlegenden Unterschieden in den gesellschaftlichen Organisationsformen und den daraus resultierenden Konsequenzen für Frauen und Kinder.
Schlüsselwörter
Platon, Politeia, Frauenbild, antikes Athen, Frauenbildung, soziale Stellung der Frau, Geschlechtersegregation, oikos, Utopie, Quellenkritik, Xenophon, Erziehung, Natur von Mann und Frau, Kindergemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Platons Frauenbild in der Politeia und die athenische Realität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht Platons Frauenbild, insbesondere in Buch fünf der Politeia, und vergleicht es mit der sozialen Realität im klassischen Athen (500-300 v. Chr.). Es wird analysiert, wie Platons utopische Vorstellungen von der Stellung der Frau von den tatsächlichen Gegebenheiten im antiken Athen abweichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Platons Konzept der Frauen-Erziehung und -Ausbildung im Vergleich zur athenischen Praxis, die soziale Stellung der Frau in beiden Kontexten, die Rolle der Natur von Mann und Frau in Platons Argumentation, die Frauen- und Kindergemeinschaft in Platons Politeia und deren gesellschaftliche Implikationen sowie die Analyse verschiedener Quellen zur Darstellung des Frauenbildes im antiken Athen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht verschiedene Quellen mit ein, darunter Tragödien, Komödien, Gerichtsreden sowie die Werke von Historikern und Philosophen wie Xenophon. Die unterschiedlichen Quellengattungen werden hinsichtlich ihrer Aussagekraft bezüglich der Geschlechterverhältnisse analysiert und ihre Stärken und Schwächen in Bezug auf die Darstellung der sozialen Stellung der Frau im antiken Athen bewertet.
Wie wird Platons Frauenbild dargestellt?
Platon argumentiert, basierend auf dem Beispiel weiblicher Hunde, für eine gleichberechtigte Erziehung von Frauen und Männern, da beide die gleichen Aufgaben im Staat erfüllen sollten. Er plädiert für eine militärische Ausbildung der Frauen. Seine Vorstellung einer Frauen- und Kindergemeinschaft ist radikal und unterscheidet sich stark von den familiären Strukturen und Eigentumsverhältnissen des klassischen Athen.
Wie wird die soziale Stellung der Frau im antiken Athen dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die stark eingeschränkte soziale Stellung der Frau im antiken Athen. Der Zugang zu Bildung war begrenzt, und Frauen waren durch Gesetze und gesellschaftliche Normen (z.B. die Organisation des *oikos*) in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt. Ihre Rolle beschränkte sich weitgehend auf die Hauswirtschaft.
Wie werden Platons Ideen mit der athenischen Realität verglichen?
Die Arbeit stellt einen detaillierten Vergleich zwischen Platons utopischen Ideen und der athenischen Realität dar. Die Unterschiede in der Frauen-Erziehung, der sozialen Stellung, den Geschlechterrollen und den familiären Strukturen werden herausgearbeitet und analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Platon, Politeia, Frauenbild, antikes Athen, Frauenbildung, soziale Stellung der Frau, Geschlechtersegregation, *oikos*, Utopie, Quellenkritik, Xenophon, Erziehung, Natur von Mann und Frau, Kindergemeinschaft.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Erziehung der Frau, zur sozialen Stellung der Frau, zur Frauen- und Kindergemeinschaft und eine Schlussfolgerung. Jedes Kapitel vergleicht Platons Ideen mit den Gegebenheiten im antiken Athen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Platons Philosophie und der Geschichte der Frauen im antiken Athen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Text dient lediglich als Zusammenfassung und Übersicht.
- Arbeit zitieren
- Nicole Kutzner (Autor:in), 2007, Platons Frauenbild vor dem Hintergrund der athenischen Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129584