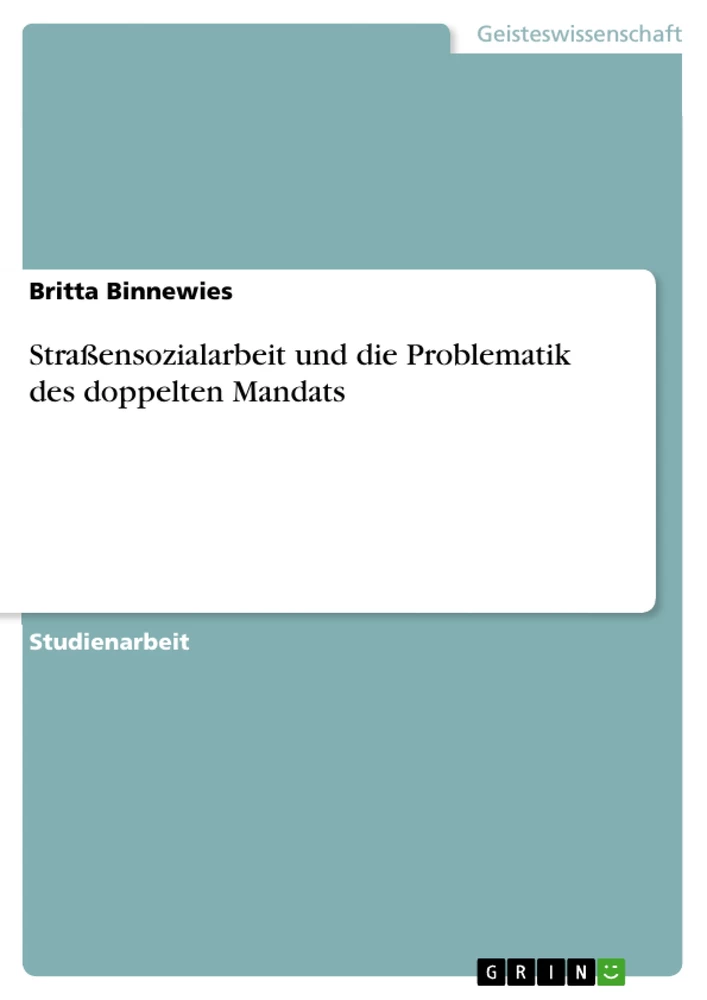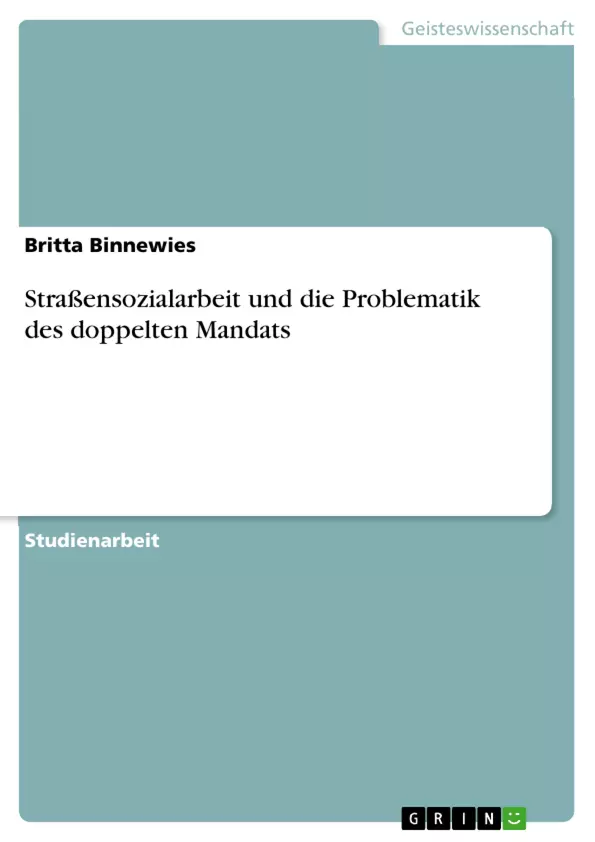Teil dieser Ausarbeitung wird es sein, dem „Begriffsdschungel“ entgegenzuwirken und das Arbeitsfeld Streetwork genau zu definieren. Weiterhin fällt bei dem Begriff des Streetwork auch meist die Problematik des doppelten Mandats auf, welches in der Fachliteratur sowie von StreetworkerInnen oft diskutiert und hervorgehoben wird. Die Fragestellung, die hier bearbeitet werden soll, beschäftigt sich also mit der sogenannten Last der Sozialarbeiter in Bezug auf die Straßensozialarbeit zwischen zwei Stühlen zu sitzen und sich zwischen Klient und Arbeitgeber hin und her gerissen zu fühlen. Thematisiert werden sollen hierbei die rechtlichen Hintergründe sowie die Einstellung von Trägern und Arbeitgebern zur Zielgruppe sowie die der Streetworker zum Klientel.
Einführend wird vorerst die Begrifflichkeit Streetwork genauer definiert. Darauf folgend wird ein Blick auf die Entwicklung des Arbeitsfeldes geworfen, von den Beginnen im Ausland bis hin zur Entwicklung in Deutschland und die Professionalisierung des Berufes.
Der wichtigste Punkt in Bezug auf die Arbeit des Streetworkers wird von der Zielgruppe geprägt. Verschiedene Adressaten bilden unterschiedliche Arbeitsfelder, die im vierten Kapitel erklärt und deren Problematik aufgeschlüsselt wird. Weiterhin wird aufgeführt, welche Rahmenbedingungen die Straßensozialarbeit braucht, um erfolgreich zu sein. Diese werden hier in allgemeine und rechtliche Bedingungen unterteilt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Streetwork
- 3. Geschichte
- 4. Zielgruppe
- 5. Wirkung und Ziele der Straßensozialarbeit
- 6. Rahmenbedingungen
- 6.1 Allgemeine Rahmenbedingungen
- 6.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 7. Arbeitsprinzipien
- 8. Methoden und Angebotsformen von Streetwork
- 8.1 Initialphase
- 8.2 Aufsuchende Arbeit/Streetwork
- 8.3 Einzelfallhilfe
- 8.4 Gruppenarbeit
- 8.5 Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit
- 9. Kritische Auseinandersetzung mit Straßensozialarbeit in Bezug auf das Doppelte Mandat
- 10. Resümee
- 11. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung zielt darauf ab, das Arbeitsfeld Streetwork präzise zu definieren und die Problematik des doppelten Mandats in der Straßensozialarbeit zu beleuchten. Es wird untersucht, wie Streetworker zwischen den Anforderungen des Arbeitgebers und den Bedürfnissen ihrer Klienten navigieren.
- Definition und Begriffsklärung von Streetwork
- Historische Entwicklung und Professionalisierung der Straßensozialarbeit
- Zielgruppen und deren spezifische Problematiken
- Rahmenbedingungen und Arbeitsprinzipien
- Methoden und Angebotsformen der Straßensozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Straßensozialarbeit ein und beschreibt den Begriffsdschungel, der eine klare Definition erschwert. Sie hebt die Problematik des doppelten Mandats hervor und kündigt die weitere Struktur der Arbeit an, die von der Definition des Begriffs Streetwork über die historische Entwicklung bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit dem doppelten Mandat reicht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Herausforderungen von Streetworkern, die zwischen den Interessen ihrer Klienten und den Erwartungen ihrer Arbeitgeber balancieren müssen.
2. Definition von Streetwork: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von Streetwork aus der Fachliteratur und zeigt die Schwierigkeit auf, eine eindeutige Definition zu finden. Es werden zwei Definitionen verglichen, eine ältere, die sich auf die Modifizierung von delinquenten Verhaltensweisen konzentriert, und eine neuere, die einen niedrigschwelligen Ansatz betont und auf die materielle Grundversorgung, den Aufbau von Vertrauen und qualifizierte Beratung fokussiert. Der Vergleich verdeutlicht die Entwicklung des Ansatzes von der Problembewältigung hin zur Prävention.
3. Geschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Ursprünge von Streetwork in den USA in den 1920er Jahren, initiiert durch die Arbeit mit delinquenten Jugendlichen. Es verfolgt die Ausbreitung der Methode nach Schweden und England und schließlich nach Deutschland in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Es betont die Verbindung zwischen dem Aufkommen von Streetwork in Deutschland und den sozialen Problemen der damaligen Rezession, die durch bestehende Institutionen nicht mehr aufgefangen werden konnten. Die Adaption ausländischer Modelle und die Ausweitung auf verschiedene Zielgruppen wie Wohnungslose werden ebenfalls beleuchtet.
4. Zielgruppe: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Zielgruppen der Straßensozialarbeit und ihren spezifischen Herausforderungen. Es analysiert die unterschiedlichen Arbeitsfelder, die sich aus den unterschiedlichen Adressaten ergeben und die Komplexität der jeweiligen Problematiken. Obwohl der konkrete Inhalt nicht im Auszug ersichtlich ist, lässt sich vermuten, dass es sich um eine detaillierte Betrachtung der spezifischen Bedürfnisse und Probleme unterschiedlicher Klientengruppen handelt.
Schlüsselwörter
Straßensozialarbeit, Streetwork, Doppeltes Mandat, Zielgruppe, Rahmenbedingungen, Arbeitsprinzipien, Methoden, Aufsuchende Arbeit, Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Soziale Arbeit, Delinquenz, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Straßensozialarbeit
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Straßensozialarbeit (Streetwork), insbesondere mit der Definition des Begriffs, der historischen Entwicklung, den Zielgruppen, den Rahmenbedingungen, den Arbeitsmethoden und der zentralen Problematik des „Doppelten Mandats“. Sie analysiert die Herausforderungen für Streetworker, die zwischen den Bedürfnissen ihrer Klienten und den Erwartungen ihrer Arbeitgeber vermitteln müssen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel: Einleitung, Definition von Streetwork, Geschichte, Zielgruppe, Wirkung und Ziele der Straßensozialarbeit, Rahmenbedingungen (allgemein und rechtlich), Arbeitsprinzipien, Methoden und Angebotsformen von Streetwork (einschließlich Initialphase, aufsuchender Arbeit, Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit), kritische Auseinandersetzung mit dem Doppelten Mandat, Resümee und Quellenverzeichnis.
Was wird unter dem „Doppelten Mandat“ verstanden?
Das „Doppelte Mandat“ beschreibt die schwierige Situation von Streetworkern, die gleichzeitig den Interessen ihrer Klienten gerecht werden und den Anforderungen ihres Arbeitgebers entsprechen müssen. Die Arbeit untersucht, wie Streetworker diesen Konflikt bewältigen und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
Welche Zielgruppen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Zielgruppen der Straßensozialarbeit und deren spezifische Herausforderungen und Problematiken. Obwohl die konkreten Zielgruppen im Auszug nicht detailliert genannt werden, wird deutlich, dass die Arbeit die Vielfältigkeit der Klientenschaft und deren individuelle Bedürfnisse berücksichtigt.
Welche Methoden und Angebotsformen von Streetwork werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden und Angebotsformen von Streetwork, darunter aufsuchende Arbeit, Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit. Es wird auch die Initialphase der Kontaktaufnahme mit Klienten thematisiert.
Welche historische Entwicklung von Streetwork wird dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Ursprünge von Streetwork in den USA in den 1920er Jahren und verfolgt seine Ausbreitung nach Schweden, England und schließlich Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren. Sie betont den Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Streetwork und den sozialen Problemen der jeweiligen Zeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Struktur der Arbeit erläutert. Es folgen Kapitel zur Definition, Geschichte, Zielgruppe, Rahmenbedingungen und Methoden von Streetwork. Ein Kapitel widmet sich kritisch dem Doppelten Mandat, bevor die Arbeit mit einem Resümee und einem Quellenverzeichnis abschließt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Straßensozialarbeit, Streetwork, Doppeltes Mandat, Zielgruppe, Rahmenbedingungen, Arbeitsprinzipien, Methoden, Aufsuchende Arbeit, Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Soziale Arbeit, Delinquenz, Prävention.
Welche Definitionen von Streetwork werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht ältere Definitionen von Streetwork, die sich auf die Modifizierung von delinquenten Verhaltensweisen konzentrierten, mit neueren Definitionen, die einen niedrigschwelligen Ansatz mit Fokus auf materielle Grundversorgung, Vertrauensaufbau und qualifizierte Beratung betonen. Dieser Vergleich zeigt die Entwicklung des Ansatzes von der Problembewältigung hin zur Prävention.
- Quote paper
- Britta Binnewies (Author), 2008, Straßensozialarbeit und die Problematik des doppelten Mandats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129595