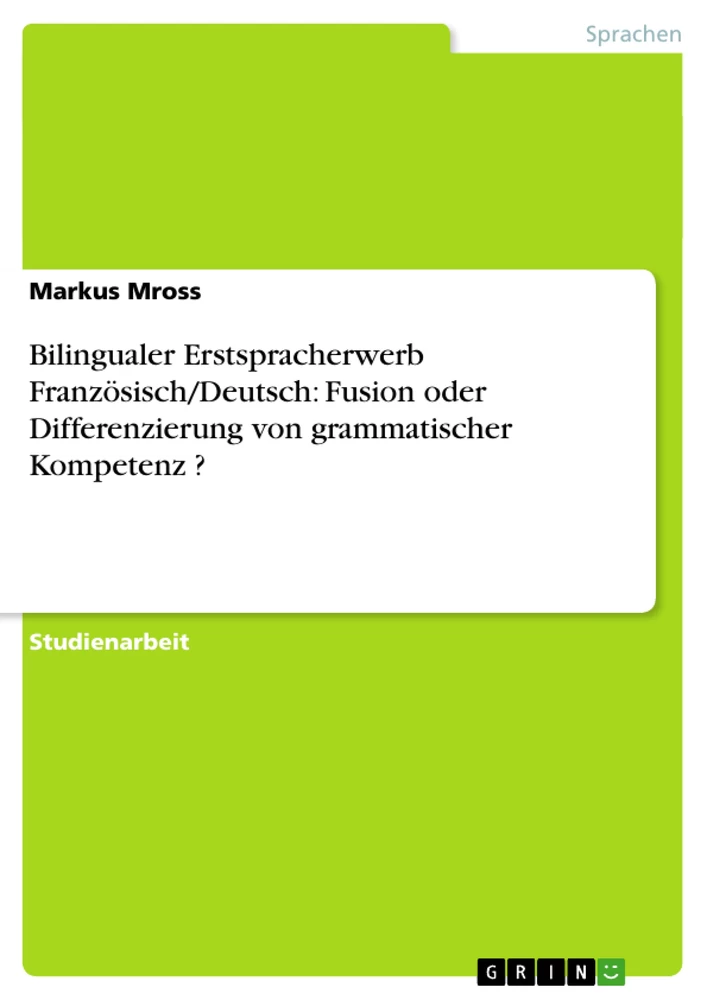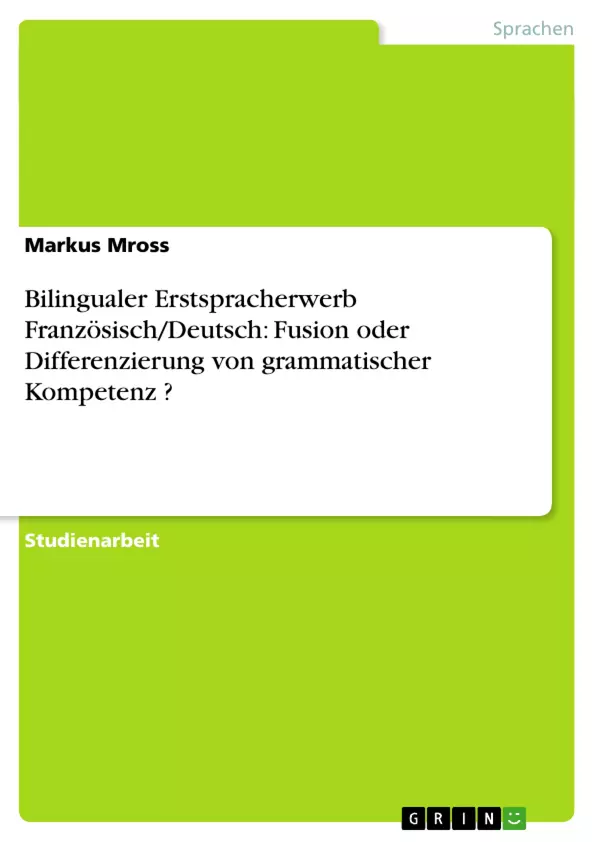Ich werde in meiner Hausarbeit die von Volterra & Taeschner (1978) vertretene „Unitary Language System“-Hypothese und die von Meisel (1989) und Paradis & Genessee (1996) vertretene „Two-System“-Hypothese als Erklärungsansätze für den bilingualen Erstspracherwerb untersuchen. Ich werde dabei die Erklärungskraft beider Hypothesen durch eine Überprüfung an sprachlichen Daten des Französischen testen. Aufgrund dieser Analyse werde ich versuchen, die Überlegenheit einer Theorie gegenüber der anderen hinsichtlich der Erklärungskraft für den bilingualen Erstspracherwerb zu ermitteln. Dabei läßt es sich nicht umgehen, daß sich Anschlußfragen ergeben, die offen gelassen werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundzüge der ausgewählten Positionen
- Volterra & Taeschner (1987)
- Meisel (1989) und Paradis & Genesee (1996)
- Diskussion der Ansätze
- Konzeptuale Probleme der „ULS“-Hypothese
- Unzureichende Evidenz für drei Erwerbsstufen
- Unzureichende Evidenz für die zweite Erwerbsstufe
- Zirkularität in der Argumentation
- Code-Switching als Evidenz für ein zugrundeliegendes einheitliches System
- Konzeptuale Vorteile der „Two-System“-Hypothese
- Syntaktische Abgrenzungskriterien für bilinguale Erwerbsstufen
- Der pragmatische und der syntaktische Modus von Sprachverarbeitung
- Guilfoyle & Noonans (1992) „Structure Building Hypothesis“
- Der syntaktische Modus von Sprachverarbeitung und Code-Switching
- DiSciullo, Muysken & Singhs (1986) „Government Constraint“
- Die autonome Entwicklung von grammatischen Systemen beim simultanen Erwerb des Deutschen und Französischen
- Der Erwerb der Wortstellung und der Subjekt-Verb-Kongruenz beim simultanen Erwerb des Deutschen und Französischen
- Der Erwerb der Wortstellung
- Der Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz
- Der Erwerb von syntaktischen Beschränkungen für Code-Switching beim simultanen Erwerb des Deutschen und Französischen
- Der Erwerb von syntaktischen Beschränkungen für Code-Switching
- Der Erwerb der Wortstellung und der Subjekt-Verb-Kongruenz beim simultanen Erwerb des Deutschen und Französischen
- Eine erste Evaluation der „ULS“-Hypothese und der „Two-System“-Hypothese
- Eine Analyse des simultanen Erstspracherwerbes zweier Erstsprachen durch die „ULS“-Hypothese und die „Two-System“-Hypothese
- Die Aufzeichnungen I (2;00,29) und I (2;04,09)
- Eine Analyse der Aufzeichnungen I (2;00,29) und I (2;04,09) durch die „ULS“-Hypothese
- Eine Analyse der Aufzeichnungen I (2;00,29) und I (2;04,09) durch die „Two-System“-Hypothese
- Die Aufzeichnung I (3;01,02)
- Eine Analyse der Aufzeichnung I (3;01,02) durch die „ULS“-Hypothese
- Eine Analyse der Aufzeichnung I (3;01,02) durch die „Two-System“-Hypothese
- Die Aufzeichnungen I (2;00,29) und I (2;04,09)
- Konzeptuale Probleme der „ULS“-Hypothese
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht konkurrierende Hypothesen zum bilingualen Erstspracherwerb: die „Unitary Language System“-Hypothese (ULS) und die „Two-System“-Hypothese. Ziel ist es, die Erklärungskraft beider Hypothesen anhand sprachlicher Daten des Französischen zu überprüfen und deren Vor- und Nachteile herauszustellen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Überlegenheit einer Hypothese im Hinblick auf die Erklärung des bilingualen Erstspracherwerbs zu ermitteln.
- Vergleich der ULS- und der Two-System-Hypothese
- Analyse der konzeptuellen Stärken und Schwächen beider Hypothesen
- Untersuchung des Einflusses von Code-Switching auf den Spracherwerb
- Anwendung der Hypothesen auf empirische Daten des Französischen
- Bewertung der Erklärungskraft beider Hypothesen für den bilingualen Erstspracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden konkurrierenden Hypothesen zum bilingualen Erstspracherwerb, die „Unitary Language System“-Hypothese und die „Two-System“-Hypothese, vor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Es wird erläutert, dass die ULS-Hypothese von einer anfänglichen Fusion grammatischer Kompetenz ausgeht, während die Two-System-Hypothese von einer frühzeitigen autonomen Entwicklung unterschiedlicher Systeme ausgeht. Die Arbeit beabsichtigt, durch den Vergleich beider Hypothesen deren Vor- und Nachteile aufzuzeigen und anhand empirischer Daten des Französischen deren Erklärungskraft für den bilingualen Erstspracherwerb zu bewerten. Der Fokus liegt auf der Analyse des Erwerbs grammatischer Wohlgeformtheitsbedingungen und deren Bedeutung für die Differenzierung grammatischer Kompetenzen.
Grundzüge der ausgewählten Positionen: Dieses Kapitel präsentiert detailliert die theoretischen Grundlagen der „Unitary Language System“-Hypothese (Volterra & Taeschner, 1987) und der „Two-System“-Hypothese (Meisel, 1989; Paradis & Genesee, 1996). Es werden die zentralen Argumente und Annahmen beider Theorien gegenübergestellt und analysiert, um die unterschiedlichen Ausgangspositionen und methodischen Ansätze deutlich zu machen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der jeweils zugrundeliegenden Annahmen über den Aufbau und die Entwicklung grammatischer Kompetenz im bilingualen Erstspracherwerb. Diese detaillierte Darstellung dient als Grundlage für die spätere kritische Auseinandersetzung und die empirische Überprüfung beider Hypothesen.
Diskussion der Ansätze: Dieses Kapitel bietet eine eingehende kritische Auseinandersetzung mit den beiden Hypothesen. Es werden konzeptuelle Probleme der „ULS“-Hypothese, wie die unzureichende Evidenz für bestimmte Erwerbsstufen und die Zirkularität in der Argumentation, herausgearbeitet. Gleichzeitig werden die konzeptuellen Vorteile der „Two-System“-Hypothese, insbesondere im Hinblick auf syntaktische Abgrenzungskriterien und den pragmatischen und syntaktischen Modus der Sprachverarbeitung, diskutiert. Die Integration von relevanten Studien wie die „Structure Building Hypothesis“ von Guilfoyle & Noonan (1992) und DiSciullo, Muysken & Singhs (1986) „Government Constraint“ ermöglicht eine differenzierte Bewertung beider Ansätze. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Erwerbs von grammatischen Systemen und syntaktischen Beschränkungen für Code-Switching im simultanen Erwerb von Deutsch und Französisch.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse der sprachlichen Daten des Französischen. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorgestellten Hypothesen interpretiert und diskutiert. Es wird eine abschließende Bewertung der Erklärungskraft der „ULS“-Hypothese und der „Two-System“-Hypothese gegeben, wobei die Stärken und Schwächen beider Ansätze im Hinblick auf die Erklärung des bilingualen Erstspracherwerbs zusammengefasst werden. Die Schlussfolgerungen stützen sich auf die im vorhergehenden Kapitel durchgeführte detaillierte Analyse. Eine definitive Entscheidung für eine der beiden Hypothesen wird hier präsentiert.
Schlüsselwörter
Bilingualer Erstspracherwerb, Französisch, Deutsch, „Unitary Language System“-Hypothese, „Two-System“-Hypothese, Code-Switching, grammatische Kompetenz, syntaktische Entwicklung, Sprachmischung, Spracherwerbstheorien, empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Bilingualer Erstspracherwerb von Französisch und Deutsch
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht und vergleicht zwei konkurrierende Hypothesen zum bilingualen Erstspracherwerb: die „Unitary Language System“-Hypothese (ULS) und die „Two-System“-Hypothese. Der Fokus liegt auf dem simultanen Erwerb von Französisch und Deutsch und der Analyse des Einflusses von Code-Switching auf den Spracherwerbsprozess.
Welche Hypothesen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die „Unitary Language System“-Hypothese (ULS), die von einem anfänglich einheitlichen Sprachsystem ausgeht, mit der „Two-System“-Hypothese, die von der frühzeitigen autonomen Entwicklung zweier separater Sprachsysteme ausgeht. Die jeweiligen theoretischen Grundlagen werden detailliert dargestellt und kritisch analysiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine theoretische Analyse der beiden Hypothesen mit einer empirischen Untersuchung. Konzeptuelle Stärken und Schwächen beider Hypothesen werden herausgearbeitet. Die empirische Analyse basiert auf sprachlichen Daten des Französischen, um die Erklärungskraft beider Hypothesen für den bilingualen Erstspracherwerb zu evaluieren.
Welche Aspekte des Spracherwerbs werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Erwerb grammatischer Wohlgeformtheitsbedingungen, insbesondere die Wortstellung und die Subjekt-Verb-Kongruenz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Code-Switching und den damit verbundenen syntaktischen Beschränkungen im bilingualen Spracherwerb.
Welche Studien werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Studien, darunter Volterra & Taeschner (1987) für die ULS-Hypothese, Meisel (1989) und Paradis & Genesee (1996) für die Two-System-Hypothese sowie Guilfoyle & Noonan (1992) ("Structure Building Hypothesis") und DiSciullo, Muysken & Singh (1986) ("Government Constraint").
Wie werden die Daten analysiert?
Die empirische Analyse beinhaltet die detaillierte Untersuchung von ausgewählten Sprachdaten des Französischen (Aufzeichnungen I (2;00,29), I (2;04,09) und I (3;01,02)). Diese Daten werden im Kontext beider Hypothesen interpretiert, um deren Vor- und Nachteile hinsichtlich der Erklärung des bilingualen Erstspracherwerbs zu beurteilen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse und eine abschließende Bewertung der Erklärungskraft der ULS- und der Two-System-Hypothese. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze werden im Hinblick auf den bilingualen Erstspracherwerb zusammengefasst und eine definitive Schlussfolgerung wird gezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter: Bilingualer Erstspracherwerb, Französisch, Deutsch, „Unitary Language System“-Hypothese, „Two-System“-Hypothese, Code-Switching, grammatische Kompetenz, syntaktische Entwicklung, Sprachmischung, Spracherwerbstheorien, empirische Analyse.
- Quote paper
- Markus Mross (Author), 2000, Bilingualer Erstspracherwerb Französisch/Deutsch: Fusion oder Differenzierung von grammatischer Kompetenz ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12961