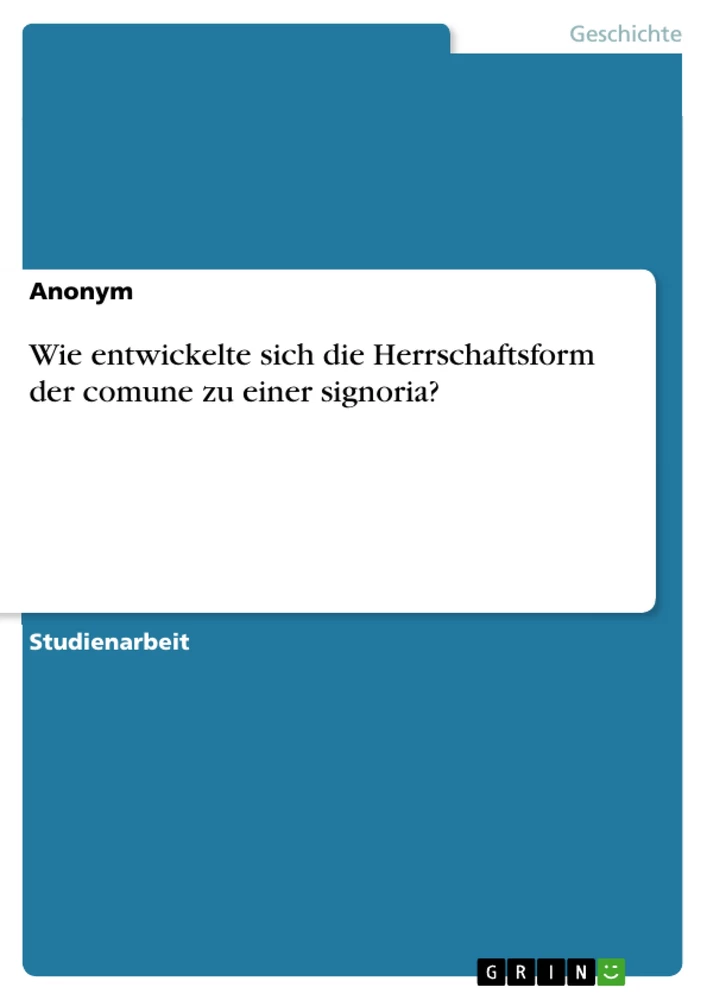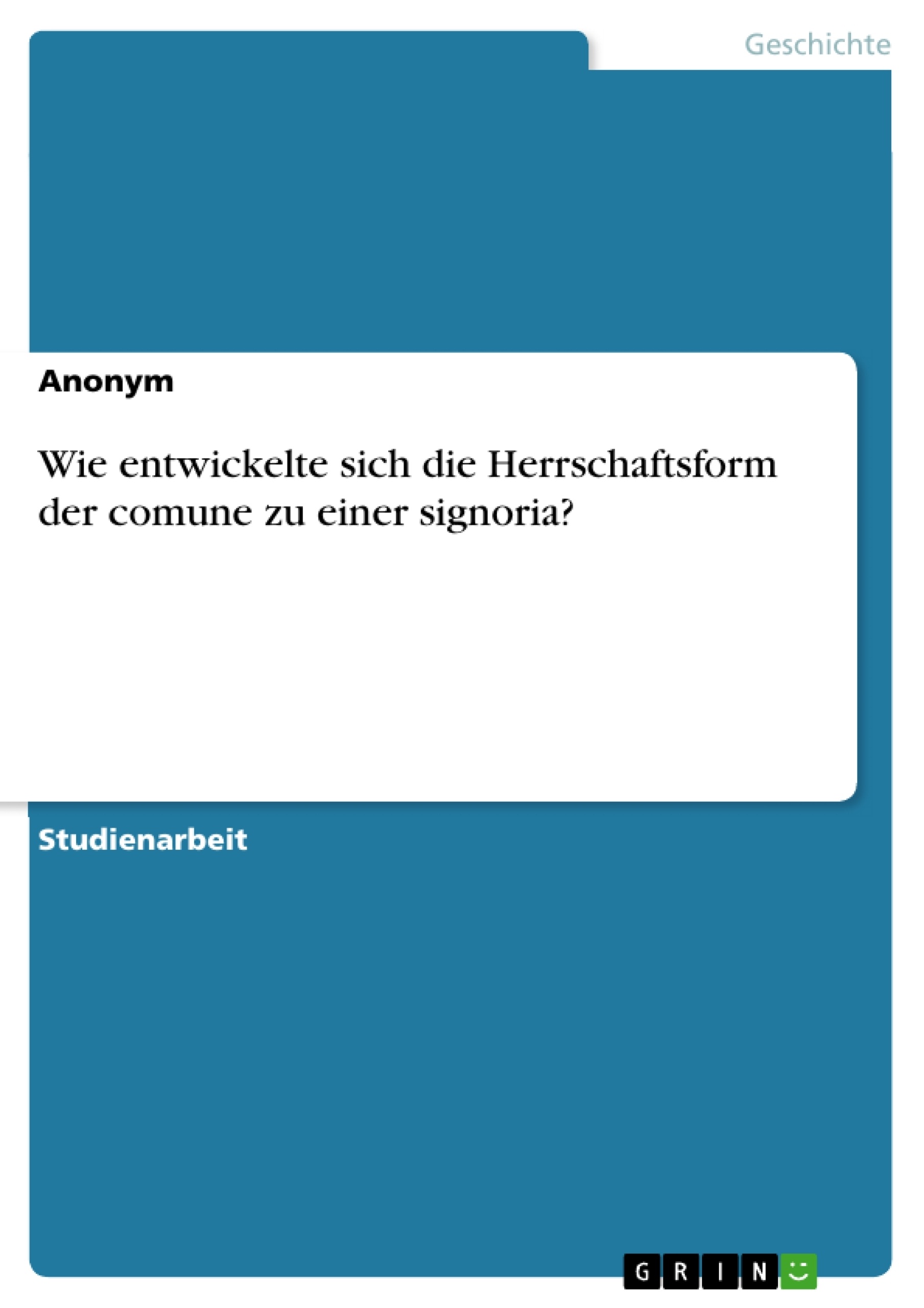In dieser Arbeit wird die norditalienische Stadt Verona und ihre Herrschaftsformen im Mittelalter, besonders zwischen dem elften und vierzehnten Jahrhundert, skizziert und analysiert. Dabei stellt sich folgende Frage: Welche Gründe und Einflüsse waren entscheidend für den Herrschaftsformwechsel und wie wirkte sich diese Entwicklung aus?
Zu Beginn wird eine kurze einleitende Passage allgemeiner Informationen über Verona dargeboten. Weiter werden die mittelalterlichen Herrschaftsformen der Kommune comune und der Signorie signoria erläutert und auf die damaligen Verhältnisse bezogen.
Im Anschluss darauf wird der Übergang von der comune zu einer signoria fokussiert und dahingehend besonders auf die Machtergreifung der Dynastie der Familie Della Scala eingegangen. Auch von hoher Bedeutung hierbei sind Beziehungen der verschiedenen Herrscher, Kaiser und Könige des Heiligen-Römischen-Reiches zu den jeweils Regierenden. Diese und ihre Beziehung zu der Familie Della Scala beziehungsweise zu der gesamten Stadtbevölkerung Verona werde ich aufzeigen.
Mithilfe von Urkunden, Regesten, Briefen und weiteren historischen Quellen werde ich die genannten Herrschaftsformen auf Verona anwenden und ihre Entwicklungen darstellen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Verona
3. Die Kommune
4. Die Signorie
5. Die Dynastie der Della Scala
6. Quellenanalyse
7. Abschließendes Fazit
9. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
„Da die Herrschaft der Vielen keinen Erfolg brachte, versuchte man es nun mit der alleinigen Gewalt eines Einzelnen oder einer Familie.“ 1
In der folgenden Arbeit werde ich die norditalienische Stadt Verona und ihre Herrschaftsformen im Mittelalter, besonders zwischen dem elften und vierzehnten Jahrhundert, nachskizzieren und analysieren.
Um den Verlauf meiner Arbeit Folge leisten zu können, werde ich zu Beginn eine kurze einleitende Passage allgemeiner Informationen über Verona darbieten. Weiter werden die mittelalterlichen Herrschaftsformen der Kommune comune und der Signorie signoria erläutert und auf die damaligen Verhältnisse bezogen. Im Anschluss darauf wird der Übergang von der comune zu einer signoria fokussiert und dahingehend besonders auf die Machtergreifung der Dynastie der Familie
Della Scala eingegangen. Auch von hoher Bedeutung hierbei sind Beziehungen der verschiedenen Herrscher, Kaiser und Könige des Heiligen-Römischen-Reiches zu den jeweils Regierenden. Diese und ihre Beziehung zu der Familie Della Scala beziehungsweise zu der gesamten Stadtbevölkerung Verona werde ich aufzeigen. Mit Hilfe von Urkunden, Regesten, Briefen und weiteren historischen Quellen werde ich die genannten Herrschaftsformen auf Verona anwenden und ihre Entwicklungen darstellen. Abschließend werde ich anhand der Quellen und der davor aufgestellten chronologischen Abfolge die grundlegende Frage klären, welche Gründe und Einflüsse entscheidend für den Herrschaftsformwechsel waren und wie sich diese Entwicklung auswirkt. In einem Fazit werde ich dann gewonnene Inhalt zusammenfassen und festhalten.
Hauptsächlich werde ich mich auf die Werke von Karl Bosl „Europa im Aufbruch“ und Elke Gotz‘ „Geschichte Italiens im Mittelalter“ stützen. Weitere Literarische Werke, wie Walter Goetz‘ „Italien im Mittelalter“, Johannes Frieds „Das Mittelalter“ und Paul Oldflieds „City and Communication in Norman Italy“ führe ich zu gegebenen Zeiten an. Während der Bearbeitung der Zeit der Dynastie der Familie Della Scala verwende ich „Die großen Familien Italiens“ von Volker Reinhardt. Genutzte Literatur sind in den Fußnoten entsprechend gekennzeichnet.
Um meine literarische Recherche unterlegen zu können, stützte ich mich auf die „Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1272-1313“ (Herausgegeben von J.F. Böhmer), „Die Urkunden Friedrichs II.“ (Bearbeitet von Walter Koch) und „Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Friedrichs I.“ (Herausgegeben von Heinrich Appelt) sowie „Die Briefe der deutschen Kaiserzeit“ (Bearbeitet von Fritz Weigle).
Der derzeitige Forschungsstand der Herrschaftsformen im mittelalterlichen Verona ist sehr weit. Ziemlich genaue Datierungen von Ereignissen können durch beispielsweise Urkunden und Belegen festgemacht werden. Innerhalb meiner Recherchen ist mir keine nennenswerte Forschungslücke unterlaufen.
2. Verona
Verona liegt im Norden Italiens und ist durch die Lage bereits im Mittelalter eine beliebte Stadt gewesen. Durch die allgemeine hohe Mobilität in Norditalien2 wurden die Verkehrswege Veronas sehr geschätzt. Denn die Verkehrswege nach Deutschland waren leicht zu erreichen, so auch verlief der Handel mit Tirol flussabwärts3 über den Fluss Etsch. Die Nähe zum Brenner sowie zum Gardasee ermöglicht eine Vielzahl von Wegen und Möglichkeiten des Transports. Verona stellte somit den wichtigsten Handels- und Verkehrspunkt zwischen dem italienischen Festland und den Alpen dar.
Besonders erfolgreich und wirtschaftlich ertragsreich wurde die Stadt durch ihren Wollhandel.4 In Zeiten des wirtschaftlichen Höhepunkts, zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert, wurde Verona dadurch zu einem begehrten Handelspartner. Tausende zog es von dem italienischen Umland contado rein in die Stadt. Das Phänomen der Landflucht lässt sich damit verbinden.5 Die Effektivität sowie die Arbeitsmöglichkeiten lockten die Bauern in die Städte und diese leisteten somit ihren Beitrag zu der wirtschaftlichen Blüte.
Durch die breitgefächerten Bevölkerungsgruppen entstand ein facettenreiches heterogenes Volk. Die Stadtgemeinde Veronas wurde durch jede soziale Schicht und finanzielle Lage verkörpert. Die allumfassende Bewegung in ganz Europa stieß einen Kultur- und Lebenswandel an. Bosl beschreibt Italien sogar als „Geburtsland einer neuen Gesellschaft und Kultur“.6 Der ökonomische Wandel sowie der kulturelle Aufschwung lies Verona zu einer der einflussreichsten Städte Italiens im Hochmittelalter werden.
Obgleich Shakespeare in seinem Stück „Romeo und Julia“ eine drastische Art der Familienrivialitäten aufzeigt, ist dieses nicht weit entfernt von den wahrhaftigen Begebenheiten. Blutige Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern7 und auch brutale Brudermorde innerhalb der Adelsfamilien fanden einst in Verona statt. Unter der Führung der Della Scala entstand jedoch eine erfolgreiche Expansionspolitik8, welche Veronas politischen Höhepunkt illustriert.
Tyrannische und gewaltsame Herrschaft war jedoch nicht alles. Andererseits wurden Kunst und Kultur jederzeit großgeschrieben und wurden auch durch ihre herrschaftlichen Regierenden gefördert. Durch diese Mischung wurde Verona auch für Durchreisende interessant. Besonders9 Heinrich der Siebte und Friedrich der Zweite prägten die Geschichte Veronas maßgeblich. Aber dieses wird an einem anderen Punkt meiner Arbeit nochmals verdeutlich.
Die „italienische Renaissance“10, so wie es Walter Goetz benennt, zeugt von einer Einführung in die Geisteswissenschaften11, indem die Bevölkerung geistig und intellektuell agiert. Dieses Aufblühen eines „Wirklichkeitssinnes“12 stößt die revolutionäre Bewegung der Gesellschaft weiter an und lässt den antiken Geist wieder aufflammen13. Selbstreflektion und autonomes Handeln wird zu dieser Zeit immer beliebter und wurde gerne umgesetzt. Auch an dem Wachstum der Universitäten, beispielsweise Bologna, und an der Vielzahl der Fakultäten ist dieses Ereignis zu verzeichnen.
Festzuhalten ist, dass Verona während des Hochmittelalters eine allzeit beliebte Stadt war. Ihr ökonomisches und gesellschaftliches Aufsteigen spiegelt sich auch in ihrer politischen Historie wider.
3. Die Kommune
Obwohl Verona bereits vor dem 11. und 12. Jahrhundert für viele Herrscher attraktiv erschien, entstand ihre Blütezeit erst unter der politischen Struktur einer Kommune (im Folgenden als comune bezeichnet). Was genau unter der Herrschaftsform comune zu verstehen ist und wie es diese zur beliebtesten politischen Ordnung ihrer Zeit schafft, erläutere ich im Weiteren.
Unter dem allgemeinen Begriffe comune versteht sich ein „network of individuals“.14 Durch den gesellschaftlichen Wandel wird das Selbstbewusstsein der Gemeinde gefördert und endet letztlich mit dem Wunsch der Selbstverwaltung. Das Bürgertum setzt auf rechtliche, wirtschaftliche und politische Emanziptation.15 Comune wird zunächst als „Schutz- und Friedensverband“16 sowie als „Gerichtsverband“17 beschrieben.
Die Stadtgemeinde tritt kollektiv gegen den vorhergegangenen Feudalismus und das Lehenswesen auf. Insgesamt wehrt sich das Volk gegen die Fremdherrschaft. Italienweit machen Aufstände und kleine Rebellionen den Zerfall des Hofsystems deutlich.18 Auch wird die Gegenwehr gegen Bischof und Kaiser immer klarer. Das Hauptziel der comune war „Frieden, Ordnung, Ende feudaler Anarchie und Tyrannis“.19
Der Aufbau der comune entstand allmählich im Prozess und nicht normgebend. Im 12. Jahrhundert verbündeten sich Handwerker und Kaufleute, paupers, zu einer Art Genossenschaft.20 Ab ungefähr 1090 wurde das Amt des podestá eingeführt.21 Diejenigen, die für das Amt des podestá in Frage kam, mussten stets einen guten Ruf aufweisen, adelig und dennoch neutral sein.22 Um seine Neutralität garantieren zu können, lebte der podestá isoliert.23 Der podestá sollte in wichtigen politischen Entscheidungen für die comune eine objektive Meinung vertreten und als Schiedsrichter in Streitigkeiten und Konflikten agieren. Außerdem war der podestá darauf angesetzt die Machtverhältnisse fair zu teilen und ein Monopol der Macht zu vermeiden. Durch die Autonomie der Volksgemeinschaft wurde jene städtische Ordnung mitsamt dem Amte des podestá notwendig.24 Die Ämter der comune agierten immer repräsentativ. Widerspiegeln sollten diese auch die neue urbane Mittelschicht25, welche sich durch den ökonomischen und gesellschaftlichen Wandel formte.
Die konsulare Rechtsaristokratie war nun die politische Führungsschicht.26 Sich selbst verstand die comune als organisatorisches urbanes Kollektiv. Neben dem Amt des podestá vertrat das consul, quasi von der comune selbst erwählte Beamte, eine wichtige Rolle.27 Rechtsentscheidungen wurden in Stadtversammlungen beschlossen und sollten durch Präsenz der Vertretung der gesamten Stadtgemeine neutral und dennoch zugunsten der Stadt getroffen werden.
Dies verlief jedoch nicht immer nach Plan. Friedrich der Erste, König Barbarossa, beispielsweise lies Anfang des 12. Jahrhunderts zwar eine freie Konsulwahl zu, stellte jedoch das Amt des podestás.28 Das bedeutet, dass Friedrich der Erste sich die Person des podestás aussuchen konnte und somit jemanden erwählen konnte, welcher nach seinen Maßstäben handelte und Rechtsentscheidungen ihm zugunsten traf. Natürlich stieß diese Maßnahme auf Nicht-Akzeptanz der comune. Das Autonomiebestreben der comune wuchs fortlaufend.29
Der Frieden von Konstanz 1183 sicherte der comune diese Autonomie und akzeptierte die comune als rechtseigene Gemeinde.30 So kam es letztlich zu einer Vermischung des Stadtrechts und der generellen kommunalen Entwicklung. Mitte des 12. Jahrhunderts, nachdem der Rückschlag Barbarossas entkräftig wurde, gab es kein Aufhalten der comune mehr.31 Das neue Arbeitsethos sowie das Mitbestimmungsrecht und Teilhabe aller mündigen Bürger ließ die Herrschaftsform der comune aufblühen. Durch den Wirtschaftsaufschwung und Veronas Stellung im Textilhandel blühte die Stadt auch ökonomisch neu auf. Die Urbanisierung nahm weiter ihren Lauf. Feudalherren wurden der comune unterstellt. Die Herren mussten für einige Monate in der Stadt leben. Das bedeutet auch, dass sie dort ein Haus kaufen, Steuer zahlen und weitere Abgaben leisten mussten.32
Von diesen Abgaben waren die führenden Adelsfamilien jedoch befreit.33 Durch stetige Konflikte und Rivalitäten zwischen den einzelnen Städten kam es oft zu brutalen Kämpfen. Der Dauerstreit zwischen den verschiedenen Städten und den dazugehörigen Familien wurde durch den Wechsel der Herrschaftsform und der Ablösung der comune gelöst.34 Immer eindeutiger setzt sich eine alleinige Gewalt beziehungsweise die einer Familie durch Veronas Herrschaft wandelt sich von einer comune zu einer signoria.35
4. Die Signorie
Der wirtschaftliche Aufschwung des 11. und 12. Jahrhunderts bekam langsam eine Abschwächung. Durch die zunehmende Unzufriedenheit, besonders bei den sozial schwächeren Unterschichten der Gesellschaft, entstanden weitere Unruhen. Es entstand eine neue Gesellschaftsschicht: popolo.36 Anzumerken hierbei ist, dass popolo nicht das ganze Volk darstellt, sondern in der Regel aus Handwerkern und Kaufleute besteht.37 Eben aus denen, welche bereits in Zeiten der kommunalen Bewegung genossenschaftlich als Gruppe zusammen agierten. So kann gesagt werden, dass popolo aus „Zünften und Berufsverbänden“38 bestand. Während eine Genossenschaft den paupers die Möglichkeit bot sich politisch zu emanzipieren, waren Zünfte arti jedoch eher eine organisatorische Gesellschaftsschicht des urbanen popolo.39
Die signoria stand für Traditionen. Politische Entscheidungen wurden konservativ und dem Adel zugunsten getroffen.40 Aus dem losen Konzept zwischen mehreren einzelnen Familien als Rat der comune, rückten die Interessen der Stadtgemeinde immer weiter in den Hintergrund und die Entscheidungen konzentrierten sich eher auf die neu entstehende Oberschicht. Diese erschließt sich aus einer Mischung von Geburtsrecht und Besitz.41 Genaue Termini gab es für die signoria zunächst nicht. Auch die Entstehungen und Durchführungen der verschiedenen Signorien in vor allen Dingen Italien wichen voneinander ab.42 Oft waren Familien an der Macht, welche bereits im Feudalismus erfolgreiche Dynastien darstellten. Söldnertruppen erhielten die Machtpositionen für diese Dynastien im Kampf gegen rivalisierte Familien.43
Auch europäische Söldnertruppen wurden beauftragt diese Familienkonflikte auszutragen. Kommando über diese Truppen hatten die sogenannten condottieri.44 Unter Führung dieser wurden die Truppen oft zu einer mächtigen Anzahl von Kämpfern. Durch Heirat in eine der dynastischen Familien wurde beispielsweise von John Hawkwood versucht an eine höhere Machtposition zu gelangen.45 Jedoch war dies meist ein Misserfolg, denn „nur selten gelang [es] den Condottieri de[n] Sprung in die Signorie.“46
Castruccio Castracani allerdings schaffte es im für signoria -untypischen Teil Italiens, der Toskana, ein vom Kaiser legitimiertes Fürstentum aufzubauen.47 Gelungen ist ihm jenes durch aufopfernde Kriegshilfe für Ludwig den Bayern. Dieses gilt wiederum als Ausnahme.
In der allgemeinen signoria spielt die Bevölkerung politisch betrachtet keine tragende Rolle mehr. Die Handwerker und Kaufleute wurden damit zufrieden gestellt, dass ihnen gute Umsätze versprochen wurden.48 Lediglich der Adel litt unter diesen neuen Bestimmungen und Gesellschaftsformen. Dennoch war diese „Entmachtung der Oberschicht“49 ein Ziel und ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Der Frieden der Stadt sollte in der signoria stets gewahrt werden. Fremdherrschaft war äußerst unerwünscht. Die Städte im 13. Jahrhundert standen als Machtrepräsentation dar. Die Familien, welche im Hintergrund der Stadt die Entscheidungen und Verhältnissen klärten, standen für die Stadt ein.
Im nächsten Beispiel wird jedoch aufgeführt, dass eine der mächtigsten Familien Norditaliens, die Della Scala, es schafften – wenn auch für kurze Zeit - mehrere Städte unter ihrer signoria zu verwalten.
5. Die Dynastie der Della Scala
Die Familie Della Scala wurde bereits 1096 unter Guido Della Scala das erste Mal erwähnt.50 Dieser wurde als einer der führenden Bürger in Verona beschrieben. Weiter wurde Balduino als consule 1147 gewählt.51
Ezzelino da Romano ebnete den Della Scala den Weg zur führenden signoria. Nachdem Veronas Versuch einer autonomen comune missglückt war, sehnte sich die Gesellschaft nach einer gradlinigen Alleinherrschaft. Ezzelino da Romano ging in die Geschichte ein als tyrannischer und gewaltsamer Herrscher. Zunächst verbündete sich dieser mit seinem Schwiegervater Friedrich dem Zweiten.52 Ezzelino schaffte es Vicenza, Padua, Feltre, Trient, Treviso und Bassano einzunehmen.53 Seine Kampf- und Herrscherart war äußerst brutal. So wird von einem Massaker gebrochen, welches bei dem Widerstand von Padua geschah.54 Erzählungen zufolge soll er mehrere Tausend erwürgt haben, um damit andere Widerstandskämpfer abzuschrecken. Lediglich Mailand hielt dem Angriff von Ezzelino stand – dort verstarb er auch 1259 an seinen Verletzungen.55 Nach seinem Tod wird Mastino zum podestá von Verona. Dieser wird jedoch 1277 ermordet.56 Erst Alfredo (ca. 1245-1301) wird erneut signore von Verona.57
In den fortlaufenden Jahren wird die signoria der dynastischen Familie immer weitergegeben. Verschiedene Bündnisse werden eingegangen, Kinder miteinander verheiratet um den Frieden bewahren zu können.58
Zu erwähnen ist weiter, dass Francesco, genannt Cangrande, ein enges Verhältnis zu Heinrich dem Siebten pflegte.59 Durch gegenseitige Hilfestellungen wurde Cangrandes Expansionspolitik zu einem Erfolg.
Er schaffte es alleiniger Herrscher über Verona und Vicenza zu werden.60 Heinrich der Siebte sagte ihm sogar dessen Vikariat zu.61 Weiter eroberte Cangrande auch Belluno, Feltre, Padua und Treviso.62 Seine Nachfolger konnten seinen Erfolg jedoch nicht halten. Zwar schaffte es Mastino der Zweite wiederholt zu einer Expansion der Dynastie, jedoch wurde diese ab 1337 von der immer größer werdenden Kraft von Venedig und den Visconti zurückgedrängt.63 Obgleich die Della Scala nicht weiterhin territorial breit aufgestellt waren, blieben sie weitgehend bedeutsam und stellten einen wichtigen Anhaltspunkt für Kunst und Kultur dar.
Nach Konflikten innerhalb der Familie, der Brudermord von Cangrande dem Zweiten 1359,64 löste Gian Galeazzo Visconti letztlich die signoria der Della Scala auf. Antonio, der letzte signore seiner Linie, verstrickte sich in Streitigkeiten mit Padua und Mailand und verlor diese schlussendlich Anhand der Della Scala Dynastie lässt sich die politische und gesellschaftliche Wandlung Veronas nach der Zeit der comune gut nachvollziehen.65 Der Wunsch nach Struktur anhand eines alleinigen Herrschers wird deutlich. Gleichzeitig wird die tyrannische Expansionspolitik vor allen Dingen durch Ezzelino da Romano und Cangrande dem Zweiten deutlich. Dass jene so erfolgreich sein konnten, lag auch an der engen Bindung zum Kaiser beziehungsweise König. Der Untergang der Della Scala spiegelt wider, wohin sich das Machtmonopol im 14. Jahrhundert wandte.
6. Quellenanalyse
Im Folgenden werde ich verschiedene Regester untersuchen und diese auf die Herrschaftsformen Veronas sowie die Bindung zum Heiligen-Römischen-Reich und deren Herrschenden beziehen.
Zunächst befasse ich mich mit den Regestern von Friedrich dem 1. Dieser sprach Verona nämlich am 26. Oktober im Jahr 1152 in Form einer Abschrift das öffentliche Recht zu.66 Zusätzlich verspricht Friedrich diesen die Immunität und die Freiheit vom Stadtzoll.67 In einem darauffolgenden Schreiben stimmt Friedrich auch dem Bischof Theobald von Verona die Rechte und verleihenden Besitzungen ihm und seiner Kirche zu.68 Während der Herrschaft von König Friedrich Barbarossa wird die Verbundenheit zu Italien sowie die Machtverhältnisse in den Städten deutlich. Obgleich der Versuch den podestá der comune selbst zu ernennen, misslang, ist die politische Position von Friedrich dem Ersten in den Urkunden nach zu skizzieren.69 Durch die Notwendigkeit der Stadt Verona und auch ihrem Bischof und der Kirche ihre Rechte schriftlich bestätigen zu lassen wird deutlich, wie viel der Macht tatsächlich dem König gehörte.
Auch zuvor wurde in Briefen des Bischofs Rather von Verona die Machtverhältnisse verdeutlicht. Dieser bittet beispielsweise den damaligen römisch-deutschen Kaiser Otto den Großen, Otto den Ersten, eine Entnahme der Bischofsgüter nicht zuzulassen und diese zu schützen.70 Der Brief wird zwischen Augst und September 965 datiert.71 Verona wurde erst kurz davor von Otto dem Großen gegründet. Hier deutlich zu sehen, dass sich die weltliche und geistliche Bevölkerung hilfesuchend an den Kaiser wendet. Der Kaiser scheint somit zu diesem Zeitpunkt die größtmögliche Machtinstanz zu sein.
Die Urkunden von Friedrich dem Zweiten (zwischen 1220-1222)72 weisen auf ähnliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse hin. Am 27. November 1220 wurde ein Rundschreiben veranlasst, welches an die „geistlichen und weltlichen Amtsträger und der gesamten Bevölkerung der Lombardei, Romagna, Tuszien und ganz Italien“73 gerichtet war. In diesem ist geschrieben. dass Friedrich der Zweite sich wegen der vielen Missstände künftig vertreten lässt.74 Nachdem seine Kaiserkrönung vollzogen ist werden seine „Legaten a latere“ ihn in seinen kaiserlichen Angelegenheiten vertreten.75 Friedrich zeigt sein politisches Interesse und Mitgefühl dadurch, dass er zugibt, dass es nach dem Tod seines Vaters Heinrich dem Siebten einige Komplikationen gab und er anscheinend keine Aktionen dagegen erwirkt hatte. Die Zusprechung von Unterstützung durch Gesandte und Vertraute lässt darauf schließen, dass die Bevölkerung der Lombardei darauf ausgelegt war Unterstützung vom Kaiser zu erlangen und auch auf diese angewiesen war. Auf diesen Entschluss lässt sich auch die notarielle Abschrift von 1311 beziehen, welche den 21. November 1220 dokumentiert.76 In dieser verleiht beziehungsweise bestätigt Friedrich der Zweiten dem inneren Klerus von Verona alle Besitzungen, welche von Friedrich Barbarossa verliehen wurden und nimmt sie zusätzlich in seinen Schutz.77 Klar wird hier, dass Friedrich der Zweite versucht die Beziehungen und Machtverhältnisse zum Klerus, wie sein Großvater halten möchte, und verspricht ihnen deshalb die Besitztümer und ihren Schutz. Auch hier wird der Anschein gewahrt, dass der kaiserliche Schutz gewünscht und nötig ist.
Wie bereits erwähnt war Heinrich der Siebte zu seiner Machtzeit eng verbündet mit der Dynastie der Della Scala. Durch deren Sitz in Verona reist auch Heinrich in die norditalienische Stadt. Der Wandel von comune zur signoria geschah unter Cangrande dem Ersten, welcher zur Herrschaftszeit Heinrichs agierte. Durch Hilfestellungen des Königs konnte Cangrande seine Macht expandieren, festigen und letztlich zu einer erfolgreichen signoria ausbauen. In „Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313.“ wird Verona als comune mehrfach erwähnt.78 So wird eine Versammlung der politischen Spitze Veronas auf den 15. November 1310 datiert.79 Berichtet wird, dass der podestá Gentile Filippeschi aus Orvieto80 sowie die beiden Brüder der Della Scala Familie, Albino der Erste und Cangrande der Erste, als „Generalkapitane von Kommune und Popolo“81, die Ratsleute und die allgemeine comune von Verona ihren „rechtlichen Stellvertreter“82 Bonmesio Paganotti auserkoren haben. Alle Versammelten schworen ihm die Treue. Bonmesio Paganotti sollte als Stellvertreter für den Kaiser dienen. Seine „Befehle und Wünsche“83 sind zu befolgen. Hierbei sind mehrere Informationen zu beachten. Zunächst wird deutlich, dass sich die comune von Verona auch im Jahr 1310 weiter versammelt, um wichtige Entscheidungen für Stadt und Volk zu fällen. Auch wird die Präsenz der Della Scala Dynastie betont. Beide Brüder, Albino und Cangrande, pflichten dem Treffen bei und kommen ihren politischen Pflichten damit nach.
Interessant ist, dass Bailardino da Nogarole als Zeuge aufgelistet wird.84 Dieser agiert als Ratgeber Cangrandes und ist obendrein mit ihm verwandt. Wie stark die Della Scala also in politischen Entscheidungen involviert waren, wird hieraus deutlich. Betont wird auch, wie stark die Bindung Veronas zu Heinrich dem Siebten war. Denn die comune gibt seinem Gesandten Vorschriften, wie dem König gezeigt werden soll, dass ihm die comune gehorsam und treu ist.85 Die Treue und Nähe zum König wird auch im nächsten Regester eindeutig aufgezeigt. Datiert ist jenes auf den 2. Dezember 1310.86 In diesem Regester wird beschrieben, wie der Rechtsgelehrte Bommesio dei Paganotti zum Boten beglaubigt wird.87 Dieses geschieht „vor König Heinrich, zahlreiche Prälaten, Fürsten und Vornehmen sowie den Notaren“88. Bomessio dei Paganotti schwört im Namen vom Volk von Verona, in Namen der Della Scala Dynastie beziehungsweise der beiden Kapitane Albino und Cangrande, dass der „wahre, rechtmäßige und ausschließliche Herr von Kommune und Popolo der Stadt Verona und ihres ganzen Gebietes“89 König Heinrich ist. Er leistet den Treueeid und verpflichtet sich somit dem Gehorsam gegenüber dem König und seiner Nachfolger. Sobald König Heinrich um seine Macht oder seinen Besitz bangt, wird die comune ihm helfen. Auch bei Verlust wird die comune dem König helfen dieses wiederzuerlangen.90 Zusätzlich verpflichtet Bomessio dei Paganotti sich im Namen der comune das Ansehen und die Ehre des Königs und des Reiches zu wahren.91 Sehr deutlich wird bei diesem Regester, wie nah das Volk von Verona dem König stand und wie auch die Della Scala weiter an der Beziehung zu Heinrich dem Siebten arbeiteten. Ewige Treue und Ehre wird ihm geschworen. Die comune scheint ihren Standpunkt zu verdeutlichen, indem sie die als geschlossene und einheitliche Gesellschaft beziehungsweise Gemeinde auftritt und sich dennoch ganz klar unter die Macht des Königs und des Reiches stellt. Die Signorie der Della Scala wird in den Regestern durch die Präsenz und Entscheidungskraft der Familie abgebildet. Auch wird die Beziehung zu Heinrich dem Siebten nochmals klarer und im besonderen Licht manifestiert.
In den Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451 lässt sich beispielsweise ein Regester über Karl den Vierten finden, welches davon handelt, dass verschiedene Gemeinden zur Hilfestellung aufgerufen werden.92 Im September 1363 wird zunächst die Waffenruhe mit Herzog Rudolf von Österreich bestätigt.93 In dem Schreiben geht es vor allen Dingen um die tatsächliche und wirkliche Hilfe bei der Kirche von Aquileia. Verona, Padua, Ferrara, Dukats von Venedig und Triest sollen gemeinsam dieser Kirche die Hilfe anbieten und auch vollbringen.94 In diesem Regester ist bemerkenswert, dass der Kaiser Karl der Vierte um Hilfe bittet. Zwar wird die Hilfe ausdrücklich verlangt, dennoch steht es im Kontrast zu den vorherigen Herrschaftsschreiben. Denn Karl der Vierten benötigt die Hilfe beziehungsweise möchte für eine Problemsituation, während beispielsweise Friedrich der Zweite seinen Schutz anbietet. Die besondere Betonung, dass diese Hilfe nicht nur zugesichert werden soll, sondern auch tatsächlich in Kraft treten soll unterstreicht die Dringlichkeit der Bitte von Karl nochmals deutlicher.
7. Abschließendes Fazit
Letztlich möchte ich meine Arbeit kurz zusammenfassend abschließen und die voran getragene Fragestellung, inwiefern sich die Herrschaftsform Veronas im Hochmittelalter wandelte und welche Gründe es dafür gegeben hat, eingehend erläutern. Anfang des 11. Jahrhunderts wurde die Gemeinde Veronas fortlaufend autonomer. Der allgemeine Umschwung in das selbstbestimmte und selbstkritische Menschenbild sowie die Einführung in Geisteswissenschaften lassen sich darin erkennen. Das Volk hinterfragt Entscheidungen der Herrschenden und fasst mehr und mehr den Entschluss eigene Beschlüsse zu ziehen beziehungsweise sehnt sich nach politischer Emanzipation und Mitspracherecht.
Durch vielerlei Fremdherrschaft wurden häufig Maßnahmen getroffen, mit welchen sich der durchschnittliche Bürger nicht identifizieren konnte. Weiter wächst das Autonomiebestreben, da Kaiser und Könige obendrein rein geographisch weit entfernt von den realen Begebenheiten liegen. Das antike Flair und die mittelalterliche Renaissance lassen die Bevölkerung erneut an einem gemeinschaftlichen Herrschaftsdelikt glauben. Der wirtschaftliche Aufschwung, welcher zwar in ganz Europa standfand, Verona jedoch zu einer wirtschaftlich relevanten Stadt im Wollhandel werden ließ, förderte die Emanzipationsfähigkeit der Bevölkerung. Auch die damit verbundene Landflucht spielt eine bedeutsame Rolle. Durch die intellektueller handelte Stadt wuchs das Interesse am politischen Mitspracherecht und dem Willen am Mitwirken für die Gesellschaft. Ein Sprichwort besagt „Stadtluft macht frei“ und lässt sich anhand dieses Beispiels nur belegen. Den Bürgern in und um Verona drängte es nach einer grundlegenden Veränderung.
Anhand der Quellen kann sich ablesen lassen, inwiefern sich das Verhältnis zu den Königen und Kaisern geändert hat. Während der Brief vom Bischof Rather ganz deutlich die Abhängigkeit und das Schutzverhältnis aufzeigt, wird bei Karl dem Vierten eher deutlich, dass der Rang des Kaisers innerhalb von Verona geschrumpft ist. Klar wird hierbei, dass die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches der italienischen Stadt Verona zugeneigt waren und diese politisch und gesellschaftlich förderten. Die Zusprechung gegenseitigen Vertrauens, Treue und Gehorsam macht dieses deutlich. Friedrich Barbarossas misslungener Versuch die Grundidee der comune mit einem von ihm gewählten podestá ließ die Autonomiebestrebungen der Bewohner von Verona nur weiterwachsen. In den Urkunden von Heinrich dem Siebten wird die enge Bindung zu den Bürgern und auch zu der Dynastie der Familie Della Scala sehr deutlich.
Den Wandel in die signoria geschieht schleichend. Während Ezzelino da Romano als Alleinherrscher äußerst erfolgreich agiert und Verona expandieren lässt, wird das Vertrauen in eine alleinige Herrschaftsform wieder stärker. Durch die nicht eindeutigen und ständigen Positionswechsel innerhalb der comune ist keine klare Linie zu vermerken. Die Politik der comune darf keinesfalls gleichgestellt werden mit der neuartigen Demokratie.
Das „Versagen“ der Herrschaftsform der comune kann zusätzlich daran festgemacht werden, dass obgleich Entscheidungen innerhalb großer Volksversammlungen geschahen, der Adel beziehungsweise die einflussreichen Dynastien weiterhin im Hintergrund für schwerwiegende Entscheidungen stehen.
Der Wechsel der Herrschaftsformen im mittelalterlichen Verona lässt sich an verschiedensten Stellen aufzeigen. Der Wandel in Ökonomie und im Gesellschaftsdenken führt somit auch zu einem Wandel in der Politik.
9. Literatur- und Quellenverzeichnis
Elke Goetz - Geschichte Italiens im Mittelalter, Gebundene Ausgabe, 2010, Primus in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), Darmstadt
Fritz Weigle (Bearbeiter) – Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, 1. Die Briefe des Bischofs Rather von Verona, 2003, Monumenta Germaniae Historica, Unveränderter Nachdruck, Böhlau, 1949
Hagen Keller – Einwohnergemeinde und Kommune: Probleme der italienischen Stadtverfassung im 11. Jahrhundert, 2014, De Gruyter, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/hzhz.1977.224.jg.561/html, Stand: 24.05.2021, 14:15 Uhr
Heinrich Appelt (Herausgeber) unter Mitwirkung von Rainer Maria Herkenrath, Walter Koch - Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158, Teil 1, Hahnsche Buchhandlung, 2008, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1975
Johann Friedrich Böhmer - Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1272-1313, Herausgegeben und ergänzt von Oswald Redlich, 1898, Verlag der Wagner’schen Universtitäts-Buchhandlung, Innsbruck,Regesta Imperii, https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00009252/images/ , Stand: 28.05.2021, 21:30 Uhr
Johannes Fried – Das Mittelalter: Geschichte und Kultur, Gebundene Ausgabe, 2009, C.H. Beck, München
Karl Bosl - Europa im Aufbruch, Gesellschaft, Kultur, vom 10. und 14. Jahrhundert, 1980, C.H. Beck, München
Paul Oldfield - City and Communication in Norman Italy, 2011, Cambridge University Press, Cambridge
Volker Reinhardt - Die großen Familien Italiens, Gebundene Ausgabe, 1992, Kröner, Leipzig
Walter Goetz – Italien im Mittelalter, 1942, Koehler & Amelang, Leipzig
Walter Koch (Bearbeiter) unter Mitwirkung von Klaus Höflinger, Joachim Spiegel, Christian Riedel – Die Urkunden Friedrichs II.: Teil 4: 1220-1222, Band 14, Texte und Register, Monumenta Germaniae Historica, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden
[...]
1 Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 192
2 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 44
3 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 205
4 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 205
5 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 162
6 Bosl, Europa im Aufbruch, S.43
7 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 199
8 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 214
9 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 216
10 Goetz and Communication in Norman Italy, S. 185
11 Goetz, Italien im Mittelalter, S.146
12 Goetz, Italien im Mittelalter, S.146
13 Goetz, Italien im Mittelalter, S.146
14 Oldfield, City vgl. Fried, Das Mittelalter, S.195
15 Italien im Mittelalter, S.146
16 Fried, Das Mittelalter, S. 190
17 Fried, Das Mittelalter, S. 191
18 vgl. Bosl, Europa im Mittelalter, S.268
19 vgl. Keller, Einwohnergemeinde und Kommune, S.563
20 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 107
21 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S.169
22 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S.169
23 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S.169
24 vgl. Goetz, Italien im Mittelalter, S.119
25 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 50
26 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S.48
27 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S.51
28 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S.102
29 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 168
30 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 102
31 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 112
32 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 112
33 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 112
34 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 173
35 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 173
36 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 114
37 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 114
38 Bosl, Europa im Aufbruch, S. 122
39 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 116
40 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 16
41 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S. 113
42 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 193
43 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 194
44 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 193
45 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 194
46 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 196
47 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 196
48 Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 197
49 Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S. 197
50 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 220
51 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.220
52 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 220
53 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S.197
54 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S.197
55 vgl. Goetz, Geschichte Italiens im Mittelalter, S.197
56 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 212
57 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S. 212
58 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.213
59 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.214
60 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.215
61 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.215
62 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.216
63 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.216
64 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.216
65 vgl. Reinhardt, Die großen Familien Italiens, S.217
66 vgl. Appelt, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158, S. 141
67 vgl. Appelt, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158, S. 141
68 vgl. Appelt, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158, S. 143
69 vgl. Bosl, Europa im Aufbruch, S.102
70 vgl. Die Briefe des Bischofs Rather v. Verona, S. 115
71 vgl. Die Briefe des Bischofs Rather v. Verona, S. 115
72 vgl. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Band 14, Teil 4: Die Urkunden von Friedrich II, S.196
73 Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Band 14, Teil 4: Die Urkunden von Friedrich II, S.196
74 vgl. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Band 14, Teil 4: Die Urkunden von Friedrich II, S.196
75 Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Band 14, Teil 4: Die Urkunden von Friedrich II, S.196
76 vgl. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Band 14, Teil 4: Die Urkunden von Friedrich II, S.230
77 vgl. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Band 14, Teil 4: Die Urkunden von Friedrich II, S.230
78 Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313
79 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.1
80 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.1
81 Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.1
82 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.1
83 Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.1
84 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.2
85 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.2
86 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.16
87 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.16
88 ⁸⁸ Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.16
89 Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.17
90 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.17
91 vgl. Böhmer, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313, S.17
92 vgl. Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Die Zeit Karls IVs 1360-1368, S. 292
93 vgl. Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Die Zeit Karls IVs 1360-1368, S. 292
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über Verona?
Diese Arbeit skizziert und analysiert die norditalienische Stadt Verona und ihre Herrschaftsformen im Mittelalter, insbesondere zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert. Sie behandelt die Herrschaftsformen der Kommune (comune) und der Signorie (signoria), den Übergang von der Comune zur Signoria, die Machtergreifung der Familie Della Scala sowie die Beziehungen zwischen den Herrschern des Heiligen-Römischen-Reiches und Verona.
Wo liegt Verona und welche Bedeutung hatte ihre Lage?
Verona liegt im Norden Italiens und war aufgrund ihrer strategischen Lage bereits im Mittelalter eine bedeutende Stadt. Ihre Verkehrswege nach Deutschland und die Nähe zum Brenner und Gardasee machten sie zu einem wichtigen Handels- und Verkehrspunkt zwischen dem italienischen Festland und den Alpen.
Was war die Kommune und welche Ziele verfolgte sie?
Die Kommune (comune) war eine Herrschaftsform, die sich durch ein "network of individuals" auszeichnete. Das Bürgertum strebte nach rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer Emanzipation und die Gemeinde trat kollektiv gegen den Feudalismus und das Lehenswesen auf. Hauptziele der Kommune waren Frieden, Ordnung und das Ende feudaler Anarchie und Tyrannis.
Was war die Signorie und wie unterschied sie sich von der Kommune?
Die Signorie war eine Herrschaftsform, die Traditionen betonte und politische Entscheidungen konservativ und dem Adel zugunsten traf. Im Gegensatz zur Kommune, in der das Bürgertum nach Mitbestimmung strebte, spielte die Bevölkerung in der Signorie politisch keine tragende Rolle mehr. Die Macht lag in den Händen einer einzelnen Familie oder eines Herren.
Wer waren die Della Scala und welche Rolle spielten sie in Verona?
Die Familie Della Scala war eine bedeutende Dynastie in Verona. Sie ebneten sich den Weg zur führenden Signorie, nachdem Veronas Versuch einer autonomen Kommune gescheitert war. Cangrande della Scala pflegte enge Beziehungen zu Heinrich dem Siebten und konnte seine Macht durch dessen Unterstützung erweitern.
Welche Quellen wurden für diese Arbeit verwendet?
Diese Arbeit stützt sich auf verschiedene literarische Werke, darunter "Europa im Aufbruch" von Karl Bosl und "Geschichte Italiens im Mittelalter" von Elke Goetz. Darüber hinaus wurden historische Quellen wie Urkunden, Regesten und Briefe analysiert, um die Herrschaftsformen in Verona zu untersuchen.
Welche Bedeutung hatte das Heilige Römische Reich für Verona?
Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches spielten eine wichtige Rolle in der Geschichte Veronas. Sie gewährten der Stadt Rechte und Privilegien und unterstützten die herrschenden Familien, wie die Della Scala. Die Beziehung zwischen Verona und dem Reich war durch ein Zusammenspiel von Treue, Gehorsam und gegenseitiger Unterstützung geprägt.
Was waren die Gründe für den Wechsel von der Kommune zur Signorie in Verona?
Der Wechsel von der Kommune zur Signorie in Verona war ein schleichender Prozess, der durch verschiedene Faktoren bedingt war. Dazu gehörten der allgemeine Umschwung in das selbstbestimmte Menschenbild, die Unzufriedenheit mit der Fremdherrschaft, das Streben nach politischer Emanzipation und der Wunsch nach einer stabileren Herrschaftsform.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Wie entwickelte sich die Herrschaftsform der comune zu einer signoria?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1296605