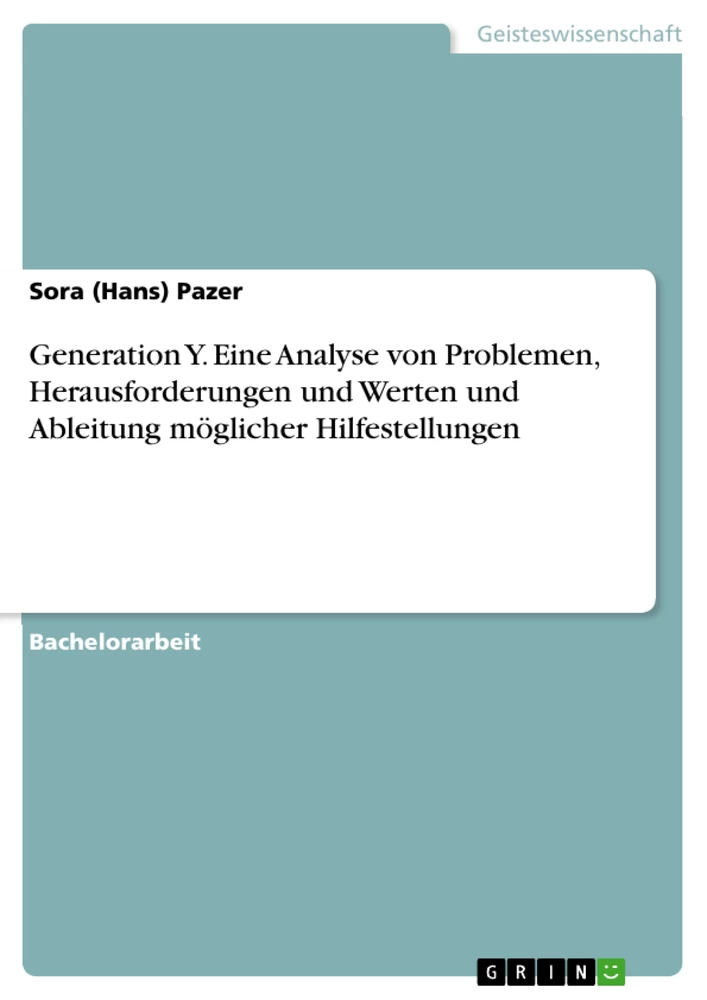Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Probleme, Herausforderungen und Werte genauer zu analysieren und darzustellen. Nachdem ein Bild der Generation gezeichnet wurde, wird verstärkt auf psychische Herausforderungen Bezug genommen und mögliche Lösungsansätze für die Soziale Arbeit aus den Erkenntnissen abgeleitet.
Um die Forschungsfrage zu beantworten ist eine ausführliche Literaturrecherche angewandt worden. Um jedoch nicht nur auf Literatur zurückzugreifen, sondern auch die Generation selbst zu befragen, wurden fünf qualitative Interviews mithilfe eines Interview-Leitfadens durchgeführt.
Dadurch wurden Werte, Herausforderungen und insbesondere mögliche Lösungsansätze herausgearbeitet. Die Auswertung der Interviews ergaben, dass sich die Soziale Arbeit stärker auf Themen der Persönlichkeitsentwicklung, beruflichen Erfahrung/Praktika und persönlichen Begleitung fokussieren muss. Konkrete Ausführungen sind an das Ende der Arbeit aufgeführt und könnten unterschiedlich aussehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Was ist eine Generation?
- 1.2. Gründe und Sinn der Generationeneinteilung.
- 1.3. Kontext der Generation Y – Analyse der vorherigen Generationen
- 1.3.1 Babyboomer
- 1.3.2. Generation X
- 2. Besonderheiten und Merkmale der Generation Y in der Sozialisation.
- 2.1 Gesellschaftliche Perspektive
- 2.1.1 Leben in der Krise....
- 2.1.2 Politische Krise..
- 2.1.3 Wirtschaftliche Krise...
- 2.1.4 Bildungskrise.
- 2.2. Veränderung der Lebenswelt - Individuelle Perspektive
- 2.2.1 Leben im digitalen Zeitalter.
- 2.2.2 Entgrenzung und Verdichtung ..
- 2.2.3 Individualisierung in der Risikogesellschaft..
- 2.2.4 Familienformen in Veränderung..
- 2.2.5 Erziehungsstil........
- 3. Werte und Einstellungen der Generation Y..
- 3.1. Zentrale Werte nach Schulenburg.........
- 3.2 Vier Typen der Generation Y nach Hurrelmann und Albrecht.
- 4. Psychische Herausforderungen der Generation Y.
- 4.1 Gründe und Ursachen für die psychischen Erkrankungen........
- 4.2 Lösungsstrategien gegen äußere Herausforderungen .....
- 5. Untersuchung von Werten, Herausforderungen und Lösungen .....
- 5.1 Theoretische Fundierung: Qualitative Sozialforschung
- 5.2 Gütekriterien qualitativer Forschung.
- 5.3 Leitfadengestützte Interviews...
- 5.3.1 Vor- und Nachteile des Forschungssetting.
- 5.3.2 Auswahl der Interviewpartner
- 5.3.3 Art und Weise des Interviews
- 5.3.4 Durchführung der Interviews...
- 5.4 Die Auswertungsmethode........
- 5.5 Forschungsergebnisse.......
- 5.5.1 Gemeinsame Werte.
- 5.5.2 Herausforderungen und Probleme.........
- 5.5.3 Lösungsansätze......
- 6. Interpretation mit Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
- 6.1 Gegen den Leistungsdruck.……………………….
- 6.2. Ausrichtung nach Innen und berufliche Praxis.
- 6.3 Beratung und Begleitung
- 6.4 Fazit und Appell.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Generation Y und deren Besonderheiten in der heutigen Gesellschaft. Sie zielt darauf ab, die Probleme, Herausforderungen und Werte dieser Generation zu analysieren und daraus mögliche Hilfestellungen für die Soziale Arbeit abzuleiten. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, wie die gesellschaftlichen und individuellen Lebensbedingungen der Generation Y, sowie deren psychische Herausforderungen und die Auswirkungen auf die Soziale Arbeit.
- Analyse der Generation Y im Kontext gesellschaftlicher und individueller Entwicklungen
- Identifizierung der Werte und Einstellungen der Generation Y
- Bewertung der psychischen Herausforderungen, denen die Generation Y begegnet
- Entwicklung von Lösungsansätzen für die Soziale Arbeit im Umgang mit der Generation Y
- Empfehlungen für die Gestaltung der Sozialen Arbeit im Sinne der Generation Y
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Generation Y ein und erläutert die Bedeutung der Generationeneinteilung im Kontext der Sozialen Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Besonderheiten und Merkmale der Generation Y in der Sozialisation, sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus individueller Perspektive. Es werden die Einflüsse des digitalen Zeitalters, die Veränderungen in der Lebenswelt und die Individualisierungsprozesse diskutiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Werten und Einstellungen der Generation Y. Es werden verschiedene Studien und Perspektiven zur Werteorientierung dieser Generation aufgezeigt. Kapitel 4 analysiert die psychischen Herausforderungen der Generation Y, die mit den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen zusammenhängen. Es werden Gründe und Ursachen für die psychischen Erkrankungen, sowie Lösungsstrategien gegen äußere Herausforderungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Generation Y, ihren Werten, Herausforderungen und Problemen. Zentrale Themen sind die Auswirkungen des digitalen Zeitalters, die Individualisierungsprozesse, die psychischen Herausforderungen und die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit dieser Generation. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: Sozialisation, Wertewandel, Krisenbewältigung, Lösungsansätze, qualitative Forschung, Interviewanalyse, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Werte der Generation Y?
Die Generation Y legt Wert auf Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit in der Arbeit, Flexibilität und eine ausgewogene Work-Life-Balance, oft geprägt durch Individualisierungsprozesse.
Vor welchen psychischen Herausforderungen steht diese Generation?
Häufige Probleme sind hoher Leistungsdruck, Orientierungslosigkeit in einer Welt voller Optionen sowie psychische Belastungen durch Entgrenzung und Verdichtung der Lebenswelt.
Wie beeinflusst das digitale Zeitalter die Sozialisation der Generation Y?
Das Aufwachsen mit digitalen Medien führt zu einer ständigen Verfügbarkeit von Informationen, aber auch zu einem sozialen Vergleichsdruck und einer Veränderung der Kommunikation.
Welche Lösungsansätze bietet die Soziale Arbeit für die Generation Y?
Die Soziale Arbeit sollte sich verstärkt auf Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Begleitung und individuelle Beratung fokussieren, um dem Leistungsdruck entgegenzuwirken.
Welche methodische Grundlage nutzt die vorliegende Analyse?
Die Arbeit kombiniert eine ausführliche Literaturrecherche mit qualitativen, leitfadengestützten Interviews, um ein authentisches Bild der Generation zu zeichnen.
- Arbeit zitieren
- Drs. Soziale Arbeit Sora (Hans) Pazer (Autor:in), 2021, Generation Y. Eine Analyse von Problemen, Herausforderungen und Werten und Ableitung möglicher Hilfestellungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1296771