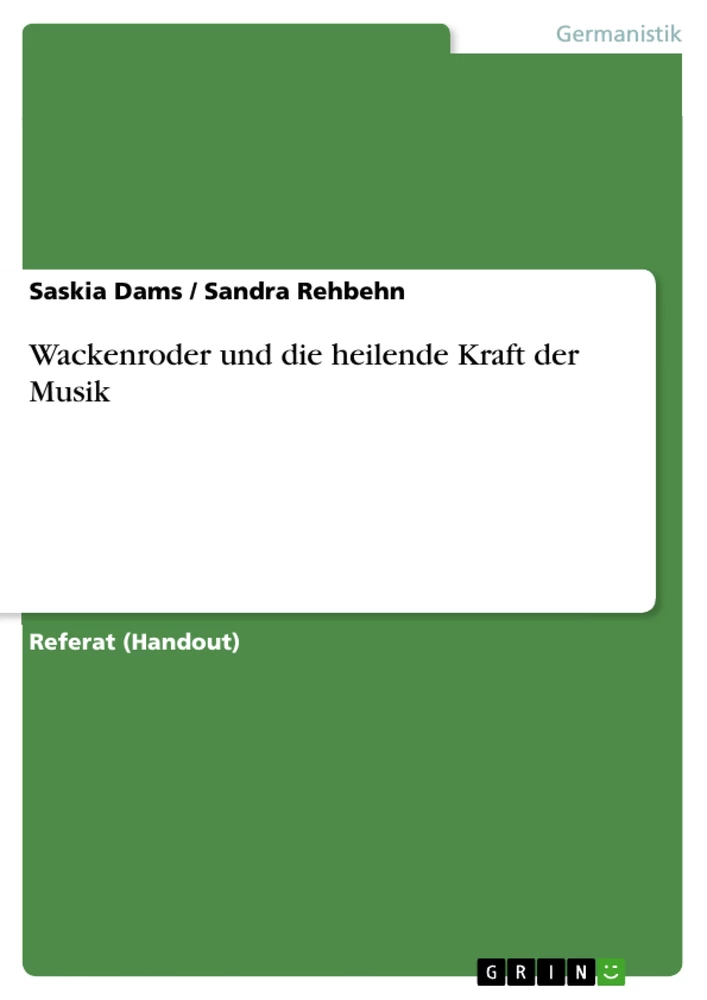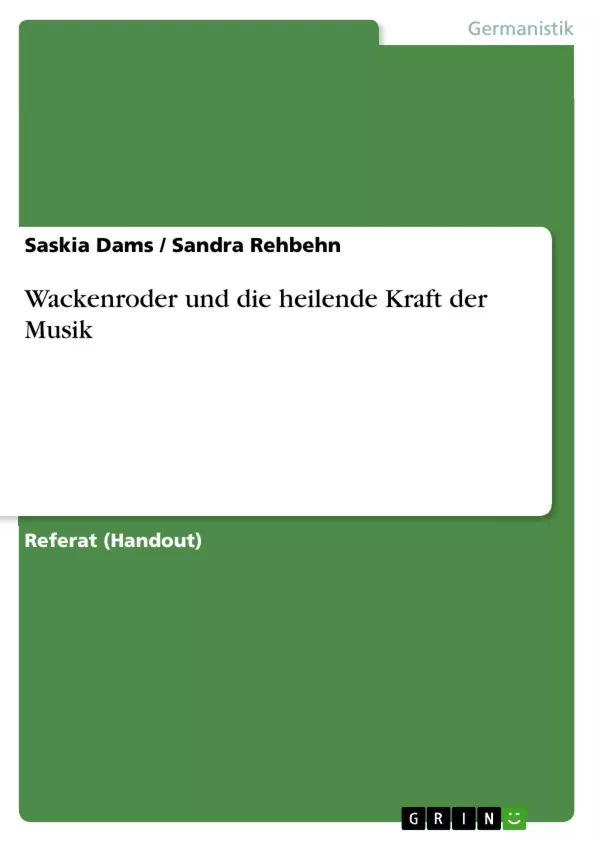Übersicht
- Der Text gilt als Manifest der Frühromantik.
- Verfasst 1797; 1799 nach dem Tod Wackenroders von seinem Freund Tieck in den „Phantasien über die Kunst“ veröffentlicht.
- Es herrscht Unschlüssigkeit über die Zuordnung des Textes, da ein Großteil des Bandes von Tieck stammt.
- Es ist ein Zusammenhang des Märchens mit dem Leben und den übrigen Schriften Wackenroders, besonders den „Herzergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ und dem Aufsatz über „Die Wunder der Tonkunst“ zu bemerken.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Vorbilder
- Motivik
- Das Zeitrad
- Das Bild des Orients
- Schuld und Erlösung
- Kunstreligion
- Die Heilkraft der Musik in Verbindung mit den Liebenden
- Diskussion: Legende ↔ Märchen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Märchen von Wilhelm Heinrich Wackenroder „wunderbaren morgenländischen Märchen von einem nackten Heiligen“ ist ein bedeutendes Werk der Frühromantik. Es befasst sich mit der Suche nach Erlösung durch Kunst und Musik in einer von Leid und Ungerechtigkeit geprägten Welt.
- Die Kraft der Musik und die Verbindung zur Liebe als Quelle der Erlösung
- Das Motiv des Heiligen als Verkörperung der Kunstreligion
- Die Flucht ins Wunderbare und die Überwindung der rationalistischen Welt
- Die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Zwängen
- Die Bedeutung des Orients als Symbol für Mystik und Geheimnis
Zusammenfassung der Kapitel
Übersicht
Der Text, verfasst im Jahre 1797 und 1799 von Tieck veröffentlicht, ist ein Manifest der Frühromantik. Er steht in Verbindung zu den „Herzergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ und dem Aufsatz über „Die Wunder der Tonkunst“ von Wackenroder.
Vorbilder
Das Märchen bezieht sich auf den Cæcilienmythos und die Geschichte des Laute spielenden David, der König Saul erheitert. Beide Vorbilder verdeutlichen die heilende Kraft der Musik.
Motivik
Das Zeitrad symbolisiert die kosmische Ordnung und die Vergänglichkeit der Zeit. Der Orient steht für Mystik und das Wunderbare. Die Erzählung spielt in einem abstrakten Raum, der die emotionale Ebene anspricht.
Schuld und Erlösung
Der Wahnsinn des Heiligen entsteht durch die Wahrnehmung des Zeitrades. Seine Nacktheit symbolisiert seine Askese oder die Tragik des Menschen. Die Erlösung vom irdischen Dasein erfolgt durch die Musik und die Verbindung zur Liebe.
Kunstreligion
Die Kunst dient der unmittelbaren Kommunikation mit dem Göttlichen. Musik wird als Gebet verstanden und die Beschäftigung mit Kunst als ein Weg zur spirituellen Erfahrung.
Die Heilkraft der Musik in Verbindung mit den Liebenden
Der Heilige sehnt sich nach Ruhe und Schönheit, doch findet er nur im Rausch der Musik und der Liebe Erlösung. Musik überformt die Monotonie des Zeitrades und erhebt die Seele in den Bereich des Übersinnlichen.
Diskussion: Legende ↔ Märchen
Der Heilige repräsentiert auf der Ebene des Märchens den Künstler. Raum und Zeit sind abstrakt und der Bezug zur Realität nur indirekt.
Schlüsselwörter
Frühromantik, Kunstreligion, Musik, Liebe, Erlösung, Zeitrad, Orient, Mystik, Heilige, Transfiguration, Legende, Märchen, Wackenroder, Tieck.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat Wackenroders Märchen für die Frühromantik?
Das "Märchen von einem nackten Heiligen" gilt als Manifest der Frühromantik und thematisiert die Kunstreligion sowie die Flucht aus der rationalistischen Welt.
Was symbolisiert das "Zeitrad" im Märchen?
Das Zeitrad steht für die unerbittliche kosmische Ordnung, die Monotonie des irdischen Daseins und den psychischen Druck, unter dem der "Heilige" leidet.
Wie wirkt die Musik auf den Protagonisten?
Musik besitzt eine heilende Kraft; sie ermöglicht die Erlösung vom Leid des Zeitrades und führt den Heiligen in einen Zustand der spirituellen Transfiguration.
Was ist unter dem Begriff "Kunstreligion" zu verstehen?
Es ist die Vorstellung, dass Kunst und Musik Wege zur unmittelbaren Kommunikation mit dem Göttlichen sind und eine religiöse Qualität der Erfahrung bieten.
Warum spielt der Orient eine Rolle im Werk?
Der Orient dient als Symbol für das Mystische, Geheimnisvolle und Wunderbare, fernab der bürgerlichen Zwänge der westlichen Gesellschaft.
- Quote paper
- M.A. Saskia Dams (Author), Sandra Rehbehn (Author), 2001, Wackenroder und die heilende Kraft der Musik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1298