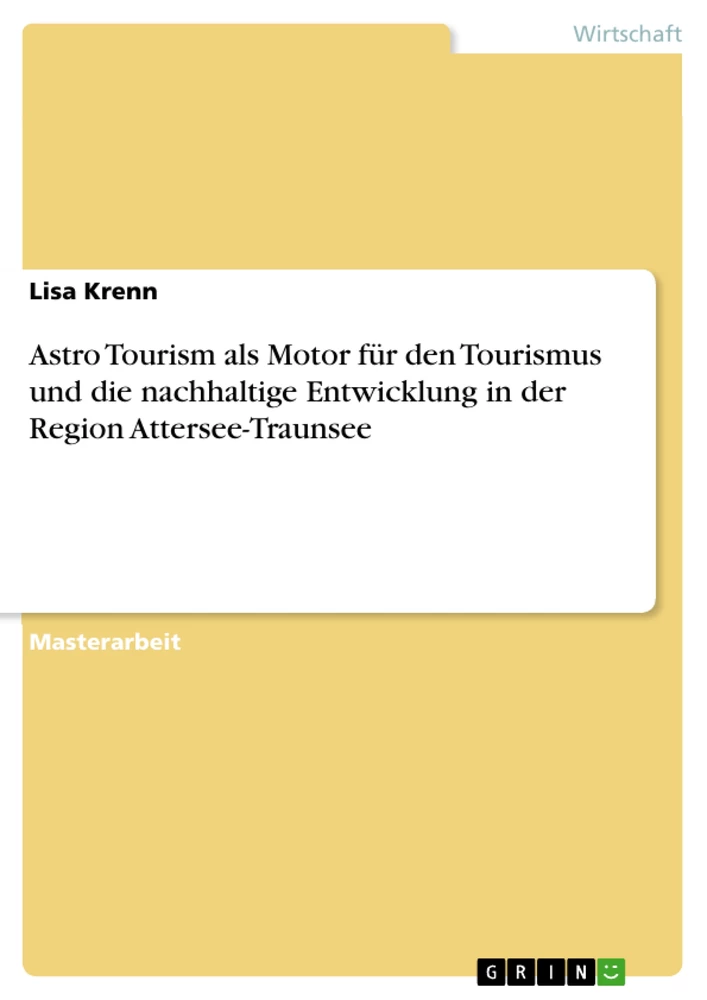Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Tourismusform Astro Tourism und beleuchet, wie diese den Tourismus und die nachhaltige Entwicklung fördern kann. Konkreter Untersuchungsgegenstand ist die Region Attersee-Traunsee in Österreich.
Seit April 2021 existiert in der oberösterreichischen Region Attersee-Traunsee der erste zertifizierte International Dark Sky Park in Österreich. Ein natürlicher Nachthimmel wird zunehmend seltener, denn aufgrund steigender Urbanisierung nimmt die weltweite Lichtverschmutzung zu. Der Sternenpark ist ein Nachtlandschaftsschutzgebiet und verpflichtet sich im Rahmen dieser Zertifizierung zu einer verantwortungsvollen Beleuchtungspolitik sowie öffentlicher Aufklärungsarbeit hinsichtlich richtigen Lichts und Lichtverschmutzung.
Konkret wurde die folgende Forschungsfrage untersucht: Welche Chancen für eine nachhaltige Entwicklung sowie für eine Positionierung als Astro Tourism Destination ergeben sich in der Region Attersee-Traunsee durch die Zertifizierung als International Dark Sky Park durch die International Dark-Sky Association?
Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgte mittels umfangreicher Literaturrecherche sowie inbesondere anhand Experteninterviews mit den zentralen StakeholderInnen in der Region und deren Umfeld sowie mit NachhaltigkeitsexpertInnen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Relevanz des Themas
- 1.3 Zielsetzung
- 1.4 Gang der Argumentation
- 2 Theoretische Grundlagen der Tourismusform Astro Tourism
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.2 Die Thematik der Lichtverschmutzung
- 2.3 Geschichtliche Entwicklung und die International Dark-Sky Association
- 2.4 International Dark Sky Places
- 2.5 Zertifizierungsprozess
- 2.6 International Darks Sky Places in Österreich
- 2.6.1 Lichtverschmutzung in Österreich
- 2.6.2 Der International Dark Sky Park in der Region Attersee-Traunsee
- 2.7 Conclusio
- 3 Nachhaltigkeitspotenziale von Astro Tourism Destinationen
- 3.1 Der Begriff der Nachhaltigkeit
- 3.2 Die drei Säulen der Nachhaltigkeit im Astro Tourism
- 3.2.1 Ökologie im Astro Tourism
- 3.2.2 Soziokultur im Astro Tourism
- 3.2.3 Ökonomie im Astro Tourism
- 3.3 Die Sustainable Development Goals im Tourismus
- 3.4 Destinationsmanagement & -entwicklung
- 3.5 Conclusio
- 4 Forschungsmethodik
- 4.1 Qualitatives Forschungsdesign
- 4.2 Theoretisches Sampling
- 4.3 Vorstellung der ExpertInnen
- 4.3.1 Das Sternenpark-Kernteam
- 4.3.2 ExpertInnen innerhalb der Region
- 4.3.3 Externe ExpertInnen
- 4.4 Datenerhebung
- 4.5 Auswertungsmethode nach Mayring
- 5 Forschungsergebnisse & Diskussion
- 5.1 Positionierung der Region Attersee-Traunsee als Astro Tourism Destination
- 5.1.1 Der Zertifizierungsprozess als Grundlage für eine Positionierung
- 5.1.2 Die Zusammenarbeit und Vernetzung in der Region
- 5.1.3 Chancen und Herausforderungen durch den Sternenpark
- 5.1.4 Die Tourismusstrategie der Region Attersee-Traunsee
- 5.2 Chancen für eine nachhaltige regionale Entwicklung durch den Sternenpark
- 5.2.1 Ökologie
- 5.2.2 Soziokultur
- 5.2.3 Ökonomie
- 5.3 Diskussion
- 6 Praktische Handlungsempfehlungen
- 6.1 Handlungsempfehlungen für die Region Attersee-Traunsee
- 6.2 Handlungsempfehlungen für Zertifizierungen in weiteren Regionen
- 7 Conclusio
- 7.1 Beantwortung der Hauptforschungsfrage
- 7.2 Beantwortung der Subforschungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Astro Tourism und dessen Potenzial für die nachhaltige Entwicklung der Region Attersee-Traunsee. Ziel der Arbeit ist es, die Chancen der Region als Astro Tourism Destination zu untersuchen und zu analysieren, inwiefern die Zertifizierung als International Dark Sky Park zur nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen kann.
- Die wachsende Bedeutung von Astro Tourism als Nischentrend im Tourismus
- Die Bedeutung eines dunklen Nachthimmels und die Herausforderungen durch Lichtverschmutzung
- Die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung im Tourismus
- Die Rolle der International Dark Sky Association und ihrer Zertifizierung für Astro Tourism Destinationen
- Die Chancen und Herausforderungen für die nachhaltige Entwicklung der Region Attersee-Traunsee durch die Zertifizierung als International Dark Sky Park
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, Relevanz, Zielsetzung und den Gang der Argumentation der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Astro Tourism. Es werden die Begriffsdefinition, die Thematik der Lichtverschmutzung, die geschichtliche Entwicklung und die International Dark-Sky Association sowie deren Zertifizierungsprozess dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit den Nachhaltigkeitspotenzialen von Astro Tourism Destinationen und analysiert die drei Säulen der Nachhaltigkeit im Kontext von Astro Tourism.
Kapitel 4 beschreibt die Forschungsmethodik der Arbeit, wobei das qualitative Forschungsdesign, die Datenerhebung und die Auswertungsmethode nach Mayring näher erläutert werden.
Kapitel 5 präsentiert die Forschungsergebnisse und deren Diskussion. Es werden die Chancen und Herausforderungen für die Region Attersee-Traunsee als Astro Tourism Destination sowie die Potenziale für eine nachhaltige regionale Entwicklung durch die Zertifizierung als International Dark Sky Park untersucht.
Kapitel 6 beinhaltet praktische Handlungsempfehlungen für die Region Attersee-Traunsee und für weitere Regionen, die eine Zertifizierung als International Dark Sky Park anstreben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Astro Tourism, Lichtverschmutzung, Nachhaltigkeit im Tourismus, International Dark Sky Park, Region Attersee-Traunsee, Zertifizierung, Positionierung als Astro Tourism Destination, nachhaltige regionale Entwicklung, qualitative Forschungsmethode, Experteninterviews, Inhaltsanalyse nach Mayring.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Astro Tourism?
Astro Tourism ist eine Nischenform des Tourismus, bei der das Erleben eines natürlichen, dunklen Nachthimmels und astronomische Beobachtungen im Mittelpunkt stehen.
Was zeichnet den Sternenpark Attersee-Traunsee aus?
Er ist der erste zertifizierte International Dark Sky Park in Österreich und verpflichtet sich zum Schutz der Nachtlandschaft und zur Vermeidung von Lichtverschmutzung.
Welche Rolle spielt die International Dark-Sky Association (IDA)?
Die IDA ist die weltweit führende Organisation im Kampf gegen Lichtverschmutzung und vergibt die Zertifizierungen für International Dark Sky Places.
Wie fördert Astro Tourism die Nachhaltigkeit?
Er schützt Ökosysteme (Ökologie), stärkt das Bewusstsein für Umweltprobleme (Soziokultur) und schafft neue wirtschaftliche Chancen in ländlichen Regionen (Ökonomie).
Welche Forschungsmethodik wurde in der Masterarbeit angewandt?
Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche sowie qualitativen Experteninterviews, die nach der Methode von Mayring ausgewertet wurden.
- Quote paper
- Lisa Krenn (Author), 2022, Astro Tourism als Motor für den Tourismus und die nachhaltige Entwicklung in der Region Attersee-Traunsee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1298151