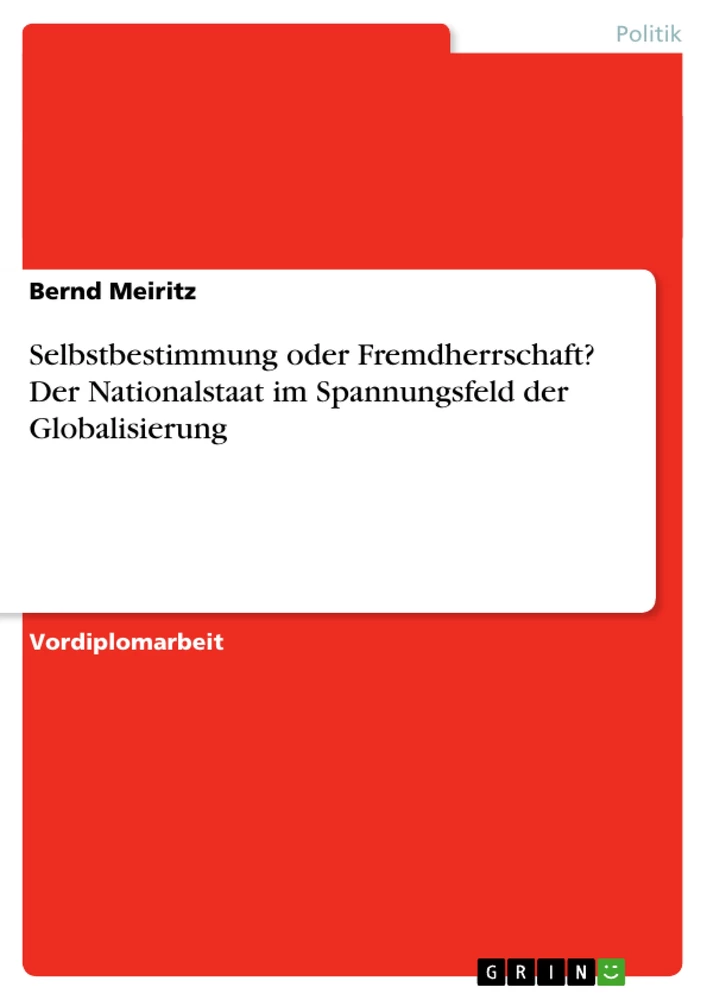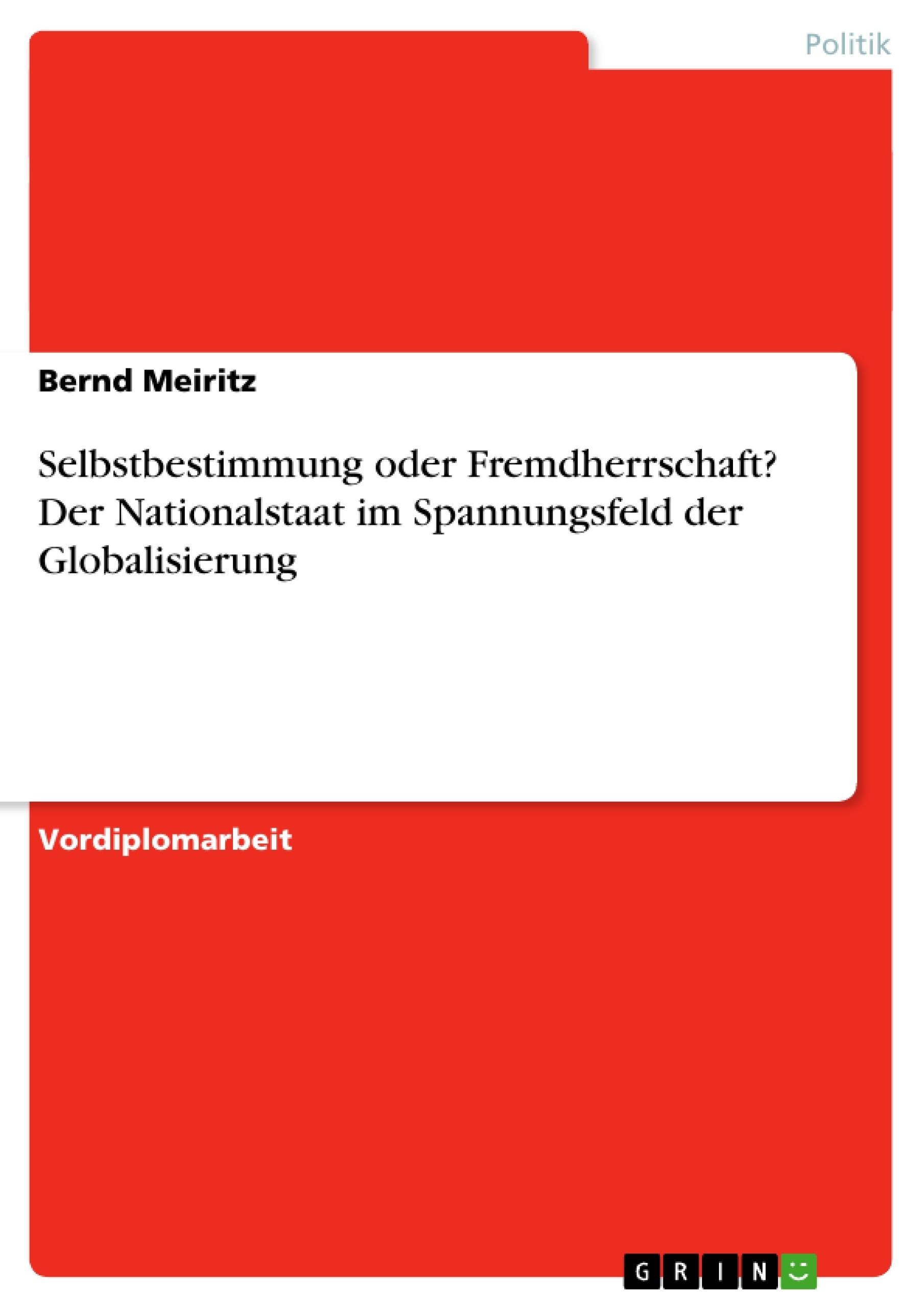Die Globalisierung ist ein Prozess, der in den vergangenen Jahren in der politischen Diskussion zu einem Schlüsselbegriff geworden ist. Doch was dieser Begriff genau bedeuten soll und welche Prozesse sich mit dieser Begrifflichkeit verbinden lassen, ist oftmals unklar und wird von Interessengruppen divergent ausgelegt oder interpretiert. Globalisierung, das steckt schon im Wort, hat etwas mit global zu tun, also mit Dingen die für die Menschen auf dem gesamten Globus von Bedeutung sind. Und das sind nicht wenige Faktoren. So haben sich beispielsweise Teile der Ökonomie und des Kapitals von lokalen und nationalen Standorten unabhängig gemacht. Multinationale Unternehmen sind in der Lage weltweit zu agieren und zu produzieren, eine Möglichkeit, die den Handlungsspielraum nationaler Regierungen einschränkt, wirtschaftliche Entwicklungen im eigenen Land zu beeinflussen. Lohnkonkurrenz und Preisdruck sind hierzu nur zwei Stichwörter. Auch die hohen Arbeitslosenzahlen in Deutschland werden gerne auf die Verflechtung mit der Weltwirtschaft und deren Schwäche zurückgeführt. Es gibt aber auch gegenteilige Positionen. So könnte, durch zunehmenden globalen Handel die Wirtschaft und somit auch die Menschen profitieren. Neue Märkte würden erschlossen und der Wohlstand der Menschen könne gemehrt werden. Menschen in allen Regionen der Welt könnten am technischen Fortschritt teilhaben. Zu diesen Sachverhalten drängen sich nun einige Fragen auf. Welche Faktoren sind überhaupt für die Globalisierung der Wirtschaft verantwortlich und gibt es globale Steuerungs- und Kontrollinstitutionen, die den Missbrauch und die Ausbeutung verhindern können? Nationale Regierungen sind durch Wahlen legitimiert, sind dies globale Akteure auch? Bei den Treffen der Regierungen der G7 Staaten finden regelmäßig große Demonstrationen statt, bei denen sich die Akteure besonders für die Länder der sogenannten Dritten Welt einsetzen, da sie diese als Verlierer der Globalisierung betrachten. Auch unkontrollierte Finanzströme und Devisenspekulationen, die ganze Volkswirtschaften zerstören können, werden kritisiert. Ein anderer Aspekt der Globalisierung sind globale Gefahren durch militärische Auseinandersetzungen. Ein mit Nuklearwaffen geführter Krieg hätte nicht nur katastrophale und vernichtende Auswirkungen für die beteiligten Parteien, sondern für alle Menschen, denn die Folgen eines solchen Schlagabtausches wären nicht vorhersehbar und könnten jegliches Leben auf dem Planeten unmöglich machen...
Inhaltsverzeichnis
- Definitionen
- Einführung in die Thematik
- Was sind Nation und Nationalstaat?
- Allgemeine Grundlagen der Globalisierung
- Fortschritt durch Technik
- Umwelt überschreitet nationale Grenzen
- Entwicklungsländer und Migration
- Wirtschaft ohne Standort?
- Neue Paradigmen nach der Beendigung des Ost-West Konfliktes
- Die Weltanschauung von Samuel Huntington
- Die Welt von Star TV
- Die Welt von Jean-Christophe Rufin
- Die Welt von James Kurth
- Die Welt der Quadriga
- Perspektiven des Wohlfahrtstaates
- Betrachtungen von Elmar Rieger und Stephan Leibfried
- Vom Anbeginn einer neuen Epoche, Einschätzungen von Martin Albrow
- Von der Moderne zum globalen Zeitalter
- Vom Nationalstaat zum Weltstaat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf den Nationalstaat und beleuchtet, wie die nationale Selbstbestimmung im Spannungsfeld der Globalisierung agiert. Sie analysiert die zunehmende Verflechtung von Wirtschaft, Politik und Kultur auf globaler Ebene und untersucht die Folgen für die nationale Souveränität und Identität.
- Definitionen von Globalisierung und Nationalstaat
- Bedeutung der Globalisierung für die nationale Wirtschaft und Politik
- Herausforderungen für den Nationalstaat im Kontext der Globalisierung
- Veränderungen von Machtstrukturen und -verhältnissen im globalen Kontext
- Perspektiven des Nationalstaates im Zeitalter der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Thematik, darunter Globalisierung und Nationalstaat. Es beleuchtet verschiedene Perspektiven auf das Phänomen der Globalisierung und die Rolle des Nationalstaates in der modernen Welt.
- Das zweite Kapitel behandelt die allgemeinen Grundlagen der Globalisierung, indem es verschiedene Aspekte wie den technischen Fortschritt, die Überwindung nationaler Grenzen durch Umweltprobleme, die Bedeutung von Entwicklungsländern und Migration sowie die Entwicklung einer globalisierten Wirtschaft beleuchtet.
- Das dritte Kapitel analysiert die neuen Paradigmen, die nach der Beendigung des Ost-West-Konfliktes entstanden sind. Es präsentiert die Weltanschauungen verschiedener Denker wie Samuel Huntington, Jean-Christophe Rufin und James Kurth und diskutiert die Rolle der Medien und die Auswirkungen der Globalisierung auf die Weltordnung.
- Das vierte Kapitel widmet sich den Perspektiven des Wohlfahrtstaates im Kontext der Globalisierung und beleuchtet die Analyse von Elmar Rieger und Stephan Leibfried.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Wandel vom Nationalstaat zum Weltstaat und analysiert die Einschätzungen von Martin Albrow.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Globalisierung, Nationalstaat, Selbstbestimmung, Fremdherrschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Identität, Souveränität, Wohlfahrtstaat, Weltstaat und Machtstrukturen. Es werden verschiedene Perspektiven und Theorien der Globalisierung diskutiert, sowie deren Auswirkungen auf den Nationalstaat in der modernen Welt.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Globalisierung die Macht des Nationalstaates?
Die wirtschaftliche Globalisierung schränkt den Handlungsspielraum nationaler Regierungen ein, da Kapital und Unternehmen weltweit agieren können.
Welche Rolle spielen multinationale Unternehmen in der Globalisierung?
Sie agieren unabhängig von Standorten, was zu Lohnkonkurrenz und Preisdruck führt und nationale Wirtschaftspolitik erschwert.
Was ist die Theorie von Samuel Huntington im Kontext dieser Arbeit?
Huntington wird als einer der Denker angeführt, die neue Paradigmen der Weltordnung nach dem Ost-West-Konflikt analysiert haben.
Was versteht man unter dem Wandel vom Nationalstaat zum Weltstaat?
Es beschreibt die theoretische Entwicklung hin zu globalen Steuerungsinstanzen, die über die Souveränität einzelner Nationen hinausgehen.
Welche Gefahren der Globalisierung werden in der Arbeit genannt?
Genannt werden unkontrollierte Finanzströme, Devisenspekulationen, Umweltprobleme und globale militärische Bedrohungen.
- Citar trabajo
- Bernd Meiritz (Autor), 2003, Selbstbestimmung oder Fremdherrschaft? Der Nationalstaat im Spannungsfeld der Globalisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12989