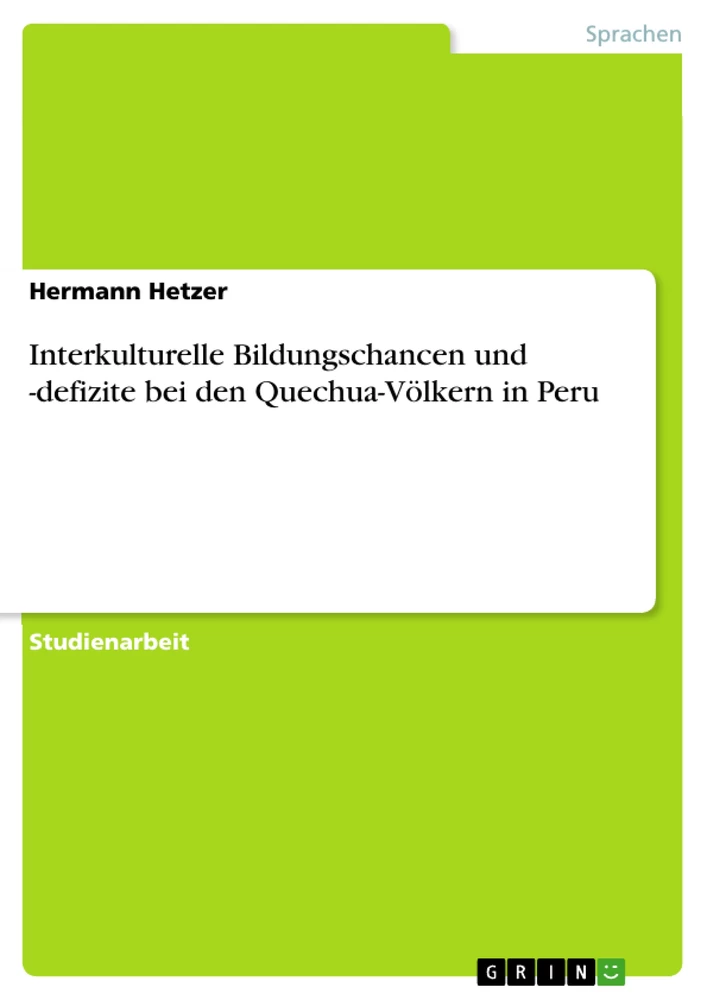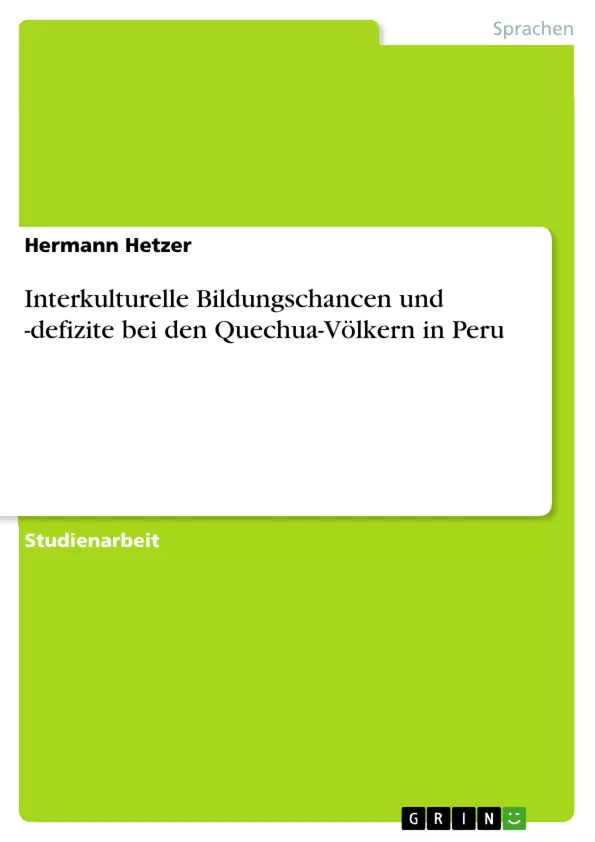Peru war schon vor der Invasion der Spanier in Lateinamerika durch Christopher Kolumbus ein mehrsprachiges Land. Viele indigene Sprachen und Varianten existierten im alten Inka-Reich. Jedoch wurde dem Quechua ein besonderer Status zugemessen. Es galt als universelle Verständigungssprache, als „lengua general“ in Verwaltung und Regierung, besonders aber für den wirtschaftlichen Handel innerhalb der verschiedenen Ethnien und mit dem Königreich der Inka. Hier war die Beherrschung des Quechua unabdinglich. Man vermutet, dass Sie schnell von den eroberten Völkern der Inka aufgenommen und angewendet wurde. Auch wenn das Spanische über viele Jahrhunderte hinweg eine klare Hegemoniestellung besaß und das Quechua verdrängt und unterdrückt wurde, existiert auch heute noch ein beachtlicher Sprecheranteil von eingeborenen Sprachen in Peru. Man zählt heute zwischen 3 und 4 Mill. Sprecher verschiedener Quechua-Varianten in Peru. Zwischen 9 und 14 Mill. sind es insgesamt in den Andenstaaten Lateinamerikas.
Vor allem aber durch die starke Isolation der Quechua-Völker gegenüber der spanischen Sprache konnte sich diese mündlich überlieferte Sprache aufrecht erhalten.
Jedoch gibt es heutzutage große soziale Ungerechtigkeiten zwischen den Indigenen und dem Rest der peruanischen Bevölkerung. In dieser Arbeit, möchte ich auf den Bereich der Bildung in Peru näher eingehen. Dabei habe ich zur Zielstellung, beide Standpunkte in Betracht ziehen, die der autochthonen Völker der Quechua und die okzidentale Sichtweise.
Das peruanische Bildungssystem ist durch eine hohe Wiederholerrate, schlecht ausgebildete Lehrer und unzureichend ausgestattete Schulen gekennzeichnet. Diese Defizite betreffen hauptsächlich die ärmeren ländlichen Regionen und hier ganz besonders die indigene Bevölkerung. Ein Zusammenhang zwischen armer und indigener Bevölkerung ist hier zu erkennen. Indigene leben demnach viel öfter in Armut und besitzen eine weitaus schlechtere Schulbildung als Nicht-indigene. Es soll in dieser Arbeit im Näheren darauf eingegangen werden, welche Bildungsdefizite im Andenstaat existieren und mit welchen Schwierigkeiten sich die Quechua-Völker im Zusammenhang mit der Bildung konfrontiert sehen. Wie werden die Indianer im Allgemeinen in der Gesellschaft wahrgenommen und welche Rolle spielt dabei die westliche Ideologie und das Kulturverständnis der autochthonen Völker?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzer Überblick zur Bildungspolitik in Peru
- Aktuelle Bildungssituation in Peru
- Spaltung von Wissen?
- Die Identität der Indios und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft
- Endogenes Kulturgut vs. Okzidentalisches Wissen
- Lösungsstrategien zur Unterstützung der Bildung der Quechua
- Bilinguismus, Zweisprachigkeit
- Bi- bzw. Interkulturalität
- Beispiele für Pilotprojekte
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildungschancen und -defizite der Quechua-Völker in Peru, indem sie sowohl die indigene als auch die okzidentale Perspektive berücksichtigt. Ziel ist es, die Herausforderungen im peruanischen Bildungssystem im Kontext der sozialen und kulturellen Ungleichheiten zu beleuchten.
- Bildungsdefizite der Quechua-Bevölkerung in Peru
- Die Rolle der Sprache (Quechua und Spanisch) in der Bildung
- Wahrnehmung der indigenen Identität in der peruanischen Gesellschaft
- Der Konflikt zwischen indigenem und okzidentalem Wissen
- Mögliche Lösungsstrategien zur Verbesserung der Bildungssituation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der mehrsprachigen Geschichte Perus ein, mit besonderem Fokus auf die Bedeutung des Quechua vor und nach der spanischen Kolonisierung. Sie hebt die sozialen Ungerechtigkeiten zwischen indigener und nicht-indigener Bevölkerung hervor und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Betrachtung der Bildungssituation aus beiden Perspektiven – der der Quechua und der okzidentalen Sichtweise.
Kurzer Überblick zur Bildungspolitik in Peru: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung der Bildungspolitik in Peru, beginnend mit dem Erscheinen der ersten Quechua-Grammatik im 16. Jahrhundert bis hin zur anhaltenden Dominanz des Spanischen und der Unterdrückung des Quechua. Es zeigt die Kontinuität kolonialer Machtstrukturen und den Widerstand der indigenen Bevölkerung gegen die Kastillianisierung, sowie die Rolle der zweisprachigen Dorfvorsteher (Gamonales) in der Aufrechterhaltung der sozialen Hierarchie durch die Sprachbarriere.
Aktuelle Bildungssituation in Peru: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Bildungssituation in Peru, die durch hohe Wiederholungsraten, schlecht ausgebildete Lehrer und unzureichend ausgestattete Schulen, besonders in ländlichen Regionen und unter indigener Bevölkerung, gekennzeichnet ist. Es stellt den Zusammenhang zwischen Armut und indigener Herkunft heraus und beleuchtet die bestehenden Bildungsdefizite und Schwierigkeiten der Quechua-Völker im Bildungssystem.
Spaltung von Wissen?: Dieses Kapitel untersucht die Wahrnehmung der indigenen Identität in der Gesellschaft und den Konflikt zwischen indigenem und okzidentalem Wissen. Es analysiert den Begriff der indigenen Identität im Kontext sprachlicher und bildungspolitischer Aspekte, um die komplexen Herausforderungen zu verstehen, vor denen die Quechua-Völker stehen.
Lösungsstrategien zur Unterstützung der Bildung der Quechua: Dieses Kapitel erörtert mögliche Lösungsstrategien zur Verbesserung der Bildungssituation der Quechua, mit Fokus auf Bilinguismus, Zweisprachigkeit und Interkulturalität. Es werden Beispiele für Pilotprojekte vorgestellt, die den Ansatz eines zweisprachigen und interkulturellen Unterrichts verfolgen, um eine eigenständige Identität der Quechua zu fördern und zu erhalten.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Bildung, Quechua, Peru, Bildungsdefizite, Indigene Völker, Zweisprachigkeit, Bilinguismus, Interkulturalität, Kolonialismus, soziale Ungerechtigkeit, Sprachpolitik, indigene Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bildungschancen und -defizite der Quechua-Völker in Peru
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bildungschancen und -defizite der Quechua-Völker in Peru, indem sie sowohl die indigene als auch die okzidentale Perspektive berücksichtigt. Ziel ist es, die Herausforderungen im peruanischen Bildungssystem im Kontext der sozialen und kulturellen Ungleichheiten zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bildungsdefizite der Quechua-Bevölkerung, die Rolle von Quechua und Spanisch in der Bildung, die Wahrnehmung der indigenen Identität, den Konflikt zwischen indigenem und okzidentalem Wissen und mögliche Lösungsstrategien zur Verbesserung der Bildungssituation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Überblick über die Bildungspolitik in Peru, die Beschreibung der aktuellen Bildungssituation, eine Analyse der Spaltung von Wissen (Identität der Indios, Konflikt zwischen indigenem und okzidentalem Wissen), die Vorstellung von Lösungsstrategien (Bilinguismus, Interkulturalität, Pilotprojekte) und eine Schlussbetrachtung. Zusätzlich werden Schlüsselwörter und eine Kapitelzusammenfassung bereitgestellt.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Bildungspolitik in Peru, beginnend mit dem Erscheinen der ersten Quechua-Grammatik im 16. Jahrhundert bis zur anhaltenden Dominanz des Spanischen und der Unterdrückung des Quechua. Es wird die Kontinuität kolonialer Machtstrukturen und der Widerstand der indigenen Bevölkerung gegen die Kastillianisierung thematisiert.
Wie wird die aktuelle Bildungssituation beschrieben?
Die aktuelle Bildungssituation wird als von hohen Wiederholungsraten, schlecht ausgebildeten Lehrern und unzureichend ausgestatteten Schulen, besonders in ländlichen Regionen und unter indigener Bevölkerung, gekennzeichnet beschrieben. Der Zusammenhang zwischen Armut und indigener Herkunft und die bestehenden Bildungsdefizite der Quechua-Völker werden hervorgehoben.
Welche Lösungsstrategien werden vorgeschlagen?
Als Lösungsstrategien werden Bilinguismus, Zweisprachigkeit und Interkulturalität diskutiert. Beispiele für Pilotprojekte, die einen zweisprachigen und interkulturellen Unterricht verfolgen, um eine eigenständige Identität der Quechua zu fördern und zu erhalten, werden vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Bildung, Quechua, Peru, Bildungsdefizite, Indigene Völker, Zweisprachigkeit, Bilinguismus, Interkulturalität, Kolonialismus, soziale Ungerechtigkeit, Sprachpolitik, indigene Identität.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Die Arbeit berücksichtigt sowohl die indigene als auch die okzidentale Perspektive, um ein umfassendes Bild der Bildungschancen und -defizite der Quechua-Völker zu liefern.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Arbeit?
Die Rolle der Sprache (Quechua und Spanisch) in der Bildung und die damit verbundene Sprachpolitik spielen eine zentrale Rolle in der Analyse der Bildungsdefizite und der vorgeschlagenen Lösungsstrategien.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit wird in der Zusammenfassung der Kapitel, insbesondere in der Schlussbetrachtung, detailliert dargestellt, ist hier aber nicht explizit zusammengefasst.)
- Arbeit zitieren
- Hermann Hetzer (Autor:in), 2008, Interkulturelle Bildungschancen und -defizite bei den Quechua-Völkern in Peru , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130042