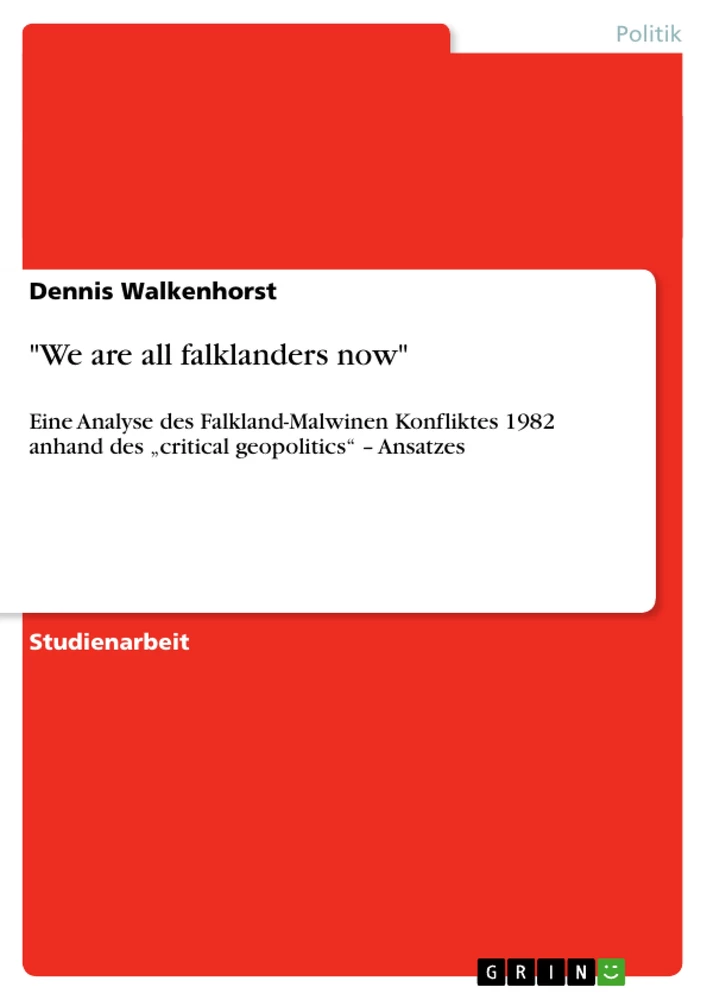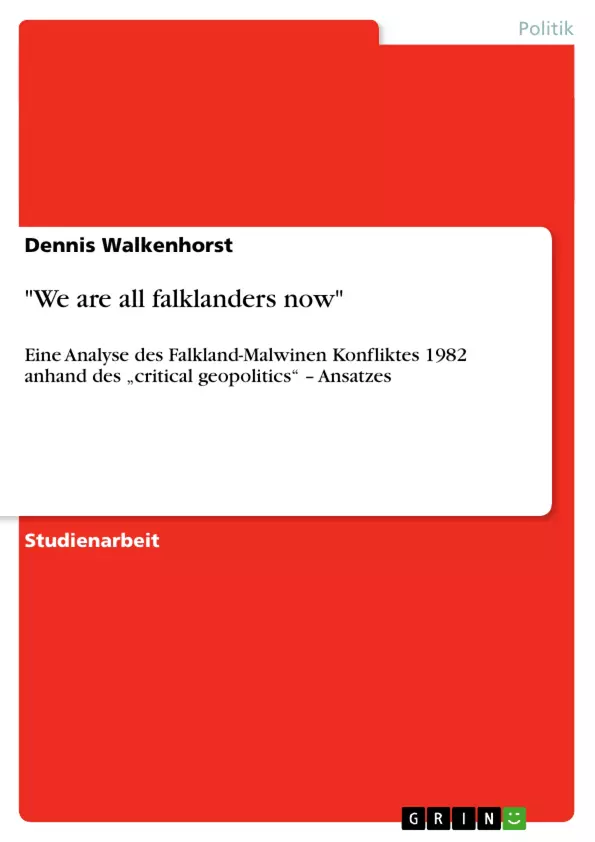Der Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Argentinien um die Falklandinseln im März 1982 erschien für viele Akteure zur damaligen Zeit als vollkommen unverhältnismäßig und unverständlich. So bezeichnete der damalige US –Präsident Ronald Reagan die Auseinandersetzung als einen nicht nachvollziehbaren „dispute over the sovereignty of that little ice-cold bunch of land down there” zwischen zwei Alliierten im Kampf gegen den Kommunismus, sollte den Briten aber schließlich doch die Unterstützung der Vereinigten Staaten zusichern. In der Tat ist auch heute, rund 25 Jahre später, noch die Frage, warum 236 britische und 700 argentinische Soldaten für die vermeintlich unbedeutenden Inseln kurz vor der Antarktis (die zum damaligen Zeitpunkt 1.800 Menschen und 60.000 Schafe beheimateten) sterben mussten, ein vieldiskutiertes Thema. So erscheinen Erklärungsversuche für die Auseinandersetzung anhand der „klassischen“ Theorien der Internationalen Beziehungen äußerst problematisch und unzureichend. Die wichtigsten Denkschulen der internationalen Beziehungen würden wohl behaupten, dieser Krieg hätte gar nicht stattfinden dürfen.
[...]
Es schien also für beide Seiten um einen „symbolischen“ Krieg zu gehen.
Sinnvoll erscheint deshalb der Versuch einer Analyse anhand eines „anders denkenden“ Ansatzes: dem der „Kritischen Geopolitik“ (oder auch „critical geopolitics“ nach Ò Tuathail). Innerhalb dieser Hausarbeit wird zunächst der Falklandkrieg als solcher kurz abgerissen, historische Grundlagen sowie die postmoderne Theorie der Kritischen Geopolitik erläutert und schließlich das „kritisch- geopolitische Auge“ mit besonderem Fokus auf die Medien- und Regierungskommunikation in Großbritannien angewendet werden. Durch Sprache erschaffene Geografien und Raumbilder sollen erkannt, analysiert und gedeutet werden. Des Weiteren sollen die tieferen Motive eben dieser Art von Geopolitik herausgearbeitet und die Wirkung auf die Bevölkerung erkannt werden.
Ziel ist also nicht die Frage nach dem „warum?“ ausschöpfend zu beantworten, sondern vielmehr die Frage nach dem „wie?“: Wie wirkten Raumbildern und geschaffene Identitäten in der Regierungs- und Medienkommunikation zu Beginn des Krieges? Wie halfen geopolitische Diskurse den Krieg zu legitimieren? Welche Interessen lagen hinter diesen Interpretationen der geopolitischen Wirklichkeit? Diese Fragen aufzuwerfen und anhand von konkreten Beispielen analysierend zu beantworten ist Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Falklandkonflikt
- ,,Falklands" oder „Malvinas“?
- Argentinische Invasion
- Britische Reaktion
- Die Theorie der Kritischen Geopolitik
- Der Begriff der Geopolitik: Mackinder, Ratzel und Haushofer.
- Kritische Geopolitik als Gegenentwurf
- Methodik
- Kritische Geopolitik und der Falklandkonflikt
- Drei große Diskurse
- Die Darstellung der Inseln als britisches Territorium.
- Der Bezug zur Situation vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
- Die Analogien zu britischer Imperialgeschichte.....
- Wirkung der Diskurse.
- Drei große Diskurse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Falkland-Malwinen Konflikt von 1982 anhand des Ansatzes der „Kritischen Geopolitik“. Ziel ist es, die Konstruktion von Raumbildern und Identitäten in der Regierungs- und Medienkommunikation Großbritanniens zu untersuchen und deren Einfluss auf die Legitimierung des Krieges zu beleuchten. Dabei werden die tieferen Motive dieser Art von Geopolitik und deren Wirkung auf die Bevölkerung herausgearbeitet.
- Analyse der Konstruktion von Raumbildern und Identitäten in der Regierungs- und Medienkommunikation Großbritanniens
- Untersuchung des Einflusses dieser Raumbilder auf die Legitimierung des Falkland-Malwinen Konfliktes
- Identifizierung der tieferen Motive der „Kritischen Geopolitik“ im Kontext des Konfliktes
- Analyse der Wirkung der „Kritischen Geopolitik“ auf die britische Bevölkerung
- Anwendung des Ansatzes der „Kritischen Geopolitik“ auf einen historischen Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Falkland-Malwinen Konflikt als ein Ereignis vor, das für viele Akteure unverständlich und unverhältnismäßig erschien. Sie führt die Problematik der Erklärung des Konfliktes anhand „klassischer“ Theorien der Internationalen Beziehungen aus und begründet die Notwendigkeit eines „anders denkenden“ Ansatzes, der „Kritischen Geopolitik“.
Das zweite Kapitel bietet einen kurzen Abriss des Falkland-Malwinen Konfliktes, beleuchtet die historischen Grundlagen und die Besitzansprüche auf die Inseln. Es beschreibt die argentinische Invasion und die britische Reaktion auf diese.
Das dritte Kapitel erläutert die Theorie der „Kritischen Geopolitik“ und stellt sie als Gegenentwurf zur „klassischen“ Geopolitik dar. Es geht auf die Methodik der „Kritischen Geopolitik“ ein und erklärt, wie sie zur Analyse von Raumbildern und Identitäten eingesetzt werden kann.
Das vierte Kapitel wendet den Ansatz der „Kritischen Geopolitik“ auf den Falkland-Malwinen Konflikt an. Es analysiert die drei großen Diskurse, die in der britischen Regierungs- und Medienkommunikation zu Beginn des Krieges verwendet wurden, und untersucht deren Wirkung auf die Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Falkland-Malwinen Konflikt, die „Kritische Geopolitik“, Raumbilder, Identitätskonstruktionen, Medienkommunikation, Regierungspolitik, Legitimierung von Krieg, Imperialismus, Nationalismus, Argentinien, Großbritannien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ansatz der "Kritischen Geopolitik"?
Dieser Ansatz untersucht, wie durch Sprache und Medien Raumbilder und Identitäten konstruiert werden, um politische Handlungen, wie etwa Kriege, zu legitimieren.
Warum wurde der Falklandkrieg als "unverhältnismäßig" bezeichnet?
Kritiker wie Ronald Reagan sahen darin einen Streit um ein "eiskaltes Stück Land" mit wenigen Einwohnern und vielen Schafen, der kaum durch klassische Interessen erklärbar schien.
Welche Diskurse nutzte die britische Regierung zur Kriegslegitimation?
Es wurden drei Hauptdiskurse genutzt: Die Darstellung der Inseln als britisches Territorium, Analogien zur Imperialgeschichte und Vergleiche mit der Situation vor dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Rolle spielten die Medien im Falklandkonflikt?
Die Medien halfen dabei, geopolitische Identitäten zu schaffen und die Inseln in der Wahrnehmung der Bevölkerung als untrennbaren Teil Großbritanniens zu verankern.
Was bedeutet der Titel "We are all falklanders now"?
Er symbolisiert die durch Kommunikation geschaffene nationale Identität und Solidarität, die notwendig war, um die militärische Reaktion gegen Argentinien zu rechtfertigen.
- Quote paper
- Dennis Walkenhorst (Author), 2007, "We are all falklanders now", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130095