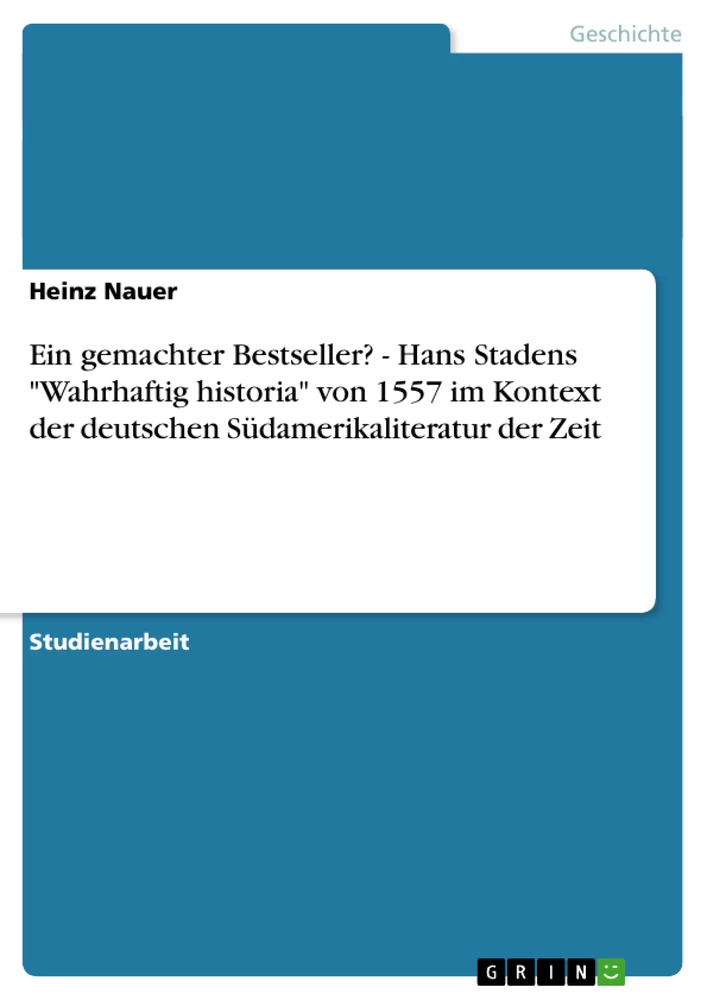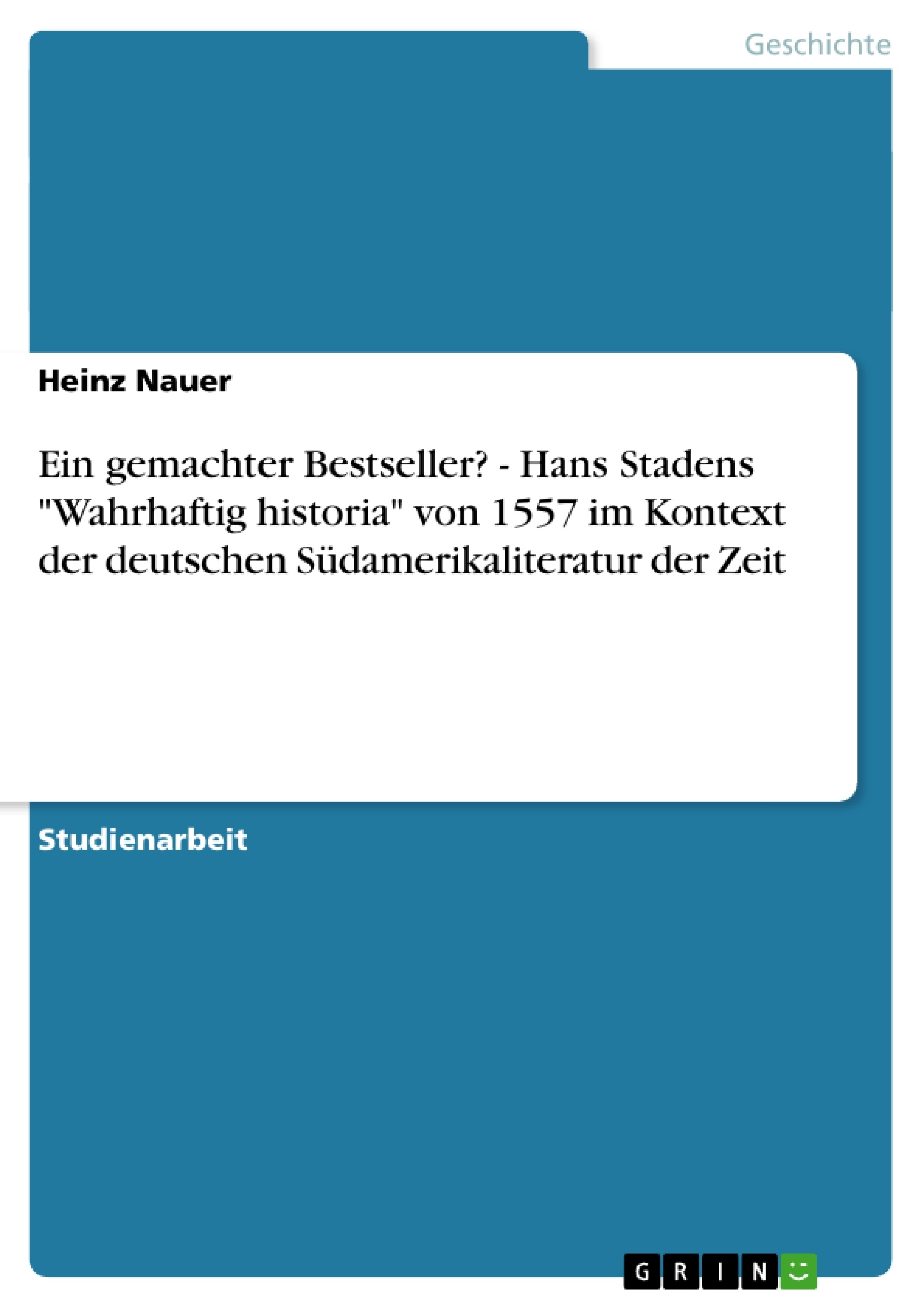Stadens „historia“ war ein Bestseller des 16. Jahrhunderts.
Der anhaltende Erfolg der „historia“ wäre aber nicht möglich gewesen wäre, wenn das Publikum nicht von der Glaubwürdigkeit des Berichts als authentischer Bericht eines Augenzeugen überzeugt worden wäre. Um möglichst viele Rezipienten von der Authentizität
der „historia“ zu überzeugen, stand Staden vor der Herausforderung beide grundsätzlichen Wissenschaftskonzeptionen zu bedienen, die in dieser Zeit gegeneinander und gleichzeitig für
Glaubwürdigkeit standen: dem Anspruch auf Wahrheit qua Rückbezug auf Autorität und Tradition einerseits, der Abstützung des Wahrheitsanspruches auf Empirie und eigener
Augenzeugenschaft andererseits.
Der Erfolg der „historia“ gründet sich darauf, dass es Staden gelingt, das Spektakuläre, das Wunderbare, das schier Unglaubliche, wovon er berichtet, für die Rezipienten in authentische und glaubwürdige Tatsachen zu verwandeln.Eine wichtige Rolle in diesem Beglaubigungsprogramm nahm der Humanist und Professor für Anatomie Johannes Eichmann, genannt Dryander, ein. Er bürgt in seiner Vorrede für die
Zuverlässigkeit von Staden qua verlässlicher Herkunft und agiert quasi als „wissenschaftliche Absicherung“ des Werks. Staden gelang es, seine in der Neuen Welt gemachten Erfahrungen und Beobachtungen mit seinen von der klassischen Tradition geprägten imaginären Bildern zu vereinbaren und sich mit seinem Bericht in bereits bekannte semiotische Zusammenhänge einzuschreiben. Dadurch, dass das Berichtete zwar grundsätzlich den Anspruch
auf Neuheit hatte, aber dennoch in einem Gewand aus bestens bekannten und populären Textstrukturen daherkam und zahlreiche Anleihen an verbreitete erzählerische Motive und Topoi machte, wurde zum einen die Glaubwürdigkeit des Berichts gesteigert, zum andern aber auch dessen Popularität.
Die starke Fokussierung auf sein eigenes Gefangenenschicksal und die Tatsache, dass er den Leser an seinem Innenleben Anteil nehmen lässt, macht die „historia“ zu einem Sonderfall
innerhalb der deutschsprachigen Amerikaliteratur des 16. Jahrhunderts und lässt seinen Bericht deutlich aus den rein historiographisch ausgerichteten Berichten eines Philipp von
Hutten, Nikolaus Federmann und Ulrich Schmidl heraustreten.
Besser als diese verstand es Staden, mit der Erwartungshaltung der Rezipienten zu spielen und in bis dahin ungewohntem Ausmass mit bekannten Erzählmotiven, etwa mit der anthropophagen Sitte, zu jonglieren und diese in seinen Bericht einfliessen zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Gattung,,Reisebericht“
- Forschungsüberblick
- Glaubwürdigkeit und Authentizität
- Die Widmung an Philipp den Grossmütigen
- Die Vorrede von Johann Dryander
- Die Beschlussrede von Hans Staden
- Kannibalen im Bild
- Neue Welten für Europa
- Die,,Wahrhaftig historia“ im Kontext zeitgenössischer deutscher Reiseberichte aus der Neuen Welt
- Philipp von Hutten und Nicolaus Federmann
- Ulrich Schmidl
- Hans Staden im Vergleich
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die „Wahrhaftig historia“ von Hans Staden (1557) im Kontext der deutschen Südamerikaliteratur des 16. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Strategien zu analysieren, mit denen Staden die Glaubwürdigkeit seines Reiseberichts und damit seinen Erfolg als „Klassiker der Reiseliteratur“ sicherstellte. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Authentizität in der Rezeption des Textes und untersucht, inwieweit die „historia“ als „gemachter Bestseller“ betrachtet werden kann.
- Die Konstruktion von Glaubwürdigkeit in der „Wahrhaftig historia“
- Die Bedeutung der Authentizität für den Erfolg des Reiseberichts
- Die „Wahrhaftig historia“ im Vergleich zu anderen deutschen Südamerikaliteratur der Zeit
- Die Rolle der „Wahrhaftig historia“ in der europäischen Wahrnehmung der Neuen Welt
- Die Frage nach der Fiktionalität und Authentizität in Reiseberichten des 16. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt Hans Staden und seine „Wahrhaftig historia“ vor. Sie beleuchtet die historische und literarische Bedeutung des Reiseberichts und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Das Kapitel „Zur Gattung,,Reisebericht““ bietet eine kurze literarische Einordnung der verwendeten Quellentexte und beleuchtet die Charakteristik von Reiseberichten als historische Quellentexte. Das Kapitel „Glaubwürdigkeit und Authentizität“ untersucht die Strategien, mit denen Staden die Glaubwürdigkeit seines Reiseberichts sicherstellt. Es analysiert die Widmung an Philipp den Grossmütigen, die Vorrede von Johann Dryander und die Beschlussrede von Hans Staden sowie die Darstellung der Kannibalen im Bild. Das Kapitel „Die,,Wahrhaftig historia“ im Kontext zeitgenössischer deutscher Reiseberichte aus der Neuen Welt“ vergleicht Stadens Reisebericht mit den Texten von Philipp von Hutten, Nicolaus Federmann und Ulrich Schmidl. Es analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Texte und beleuchtet die Rolle der „Wahrhaftig historia“ im Kontext der deutschen Südamerikaliteratur der Zeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Wahrhaftig historia“, Hans Staden, Reisebericht, Südamerikaliteratur, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Kannibalismus, deutsche Literatur des 16. Jahrhunderts, Philipp von Hutten, Nicolaus Federmann, Ulrich Schmidl, Neue Welt, Brasilien, Tupinambà, europäische Expansion, Kolonialismus.
- Quote paper
- Heinz Nauer (Author), 2009, Ein gemachter Bestseller? - Hans Stadens "Wahrhaftig historia" von 1557 im Kontext der deutschen Südamerikaliteratur der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130097