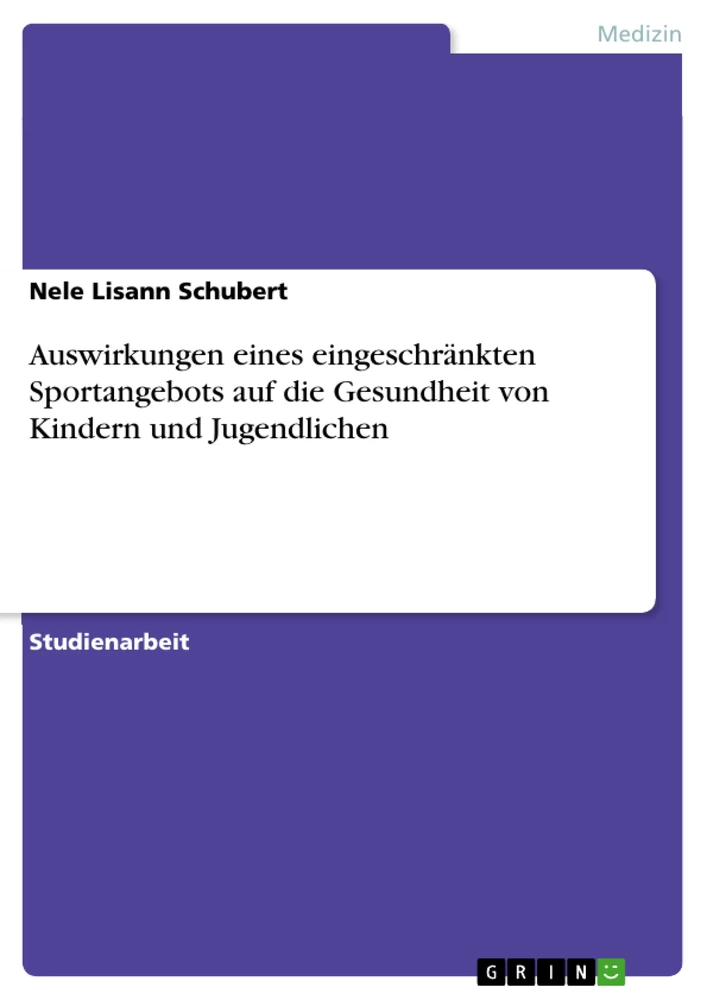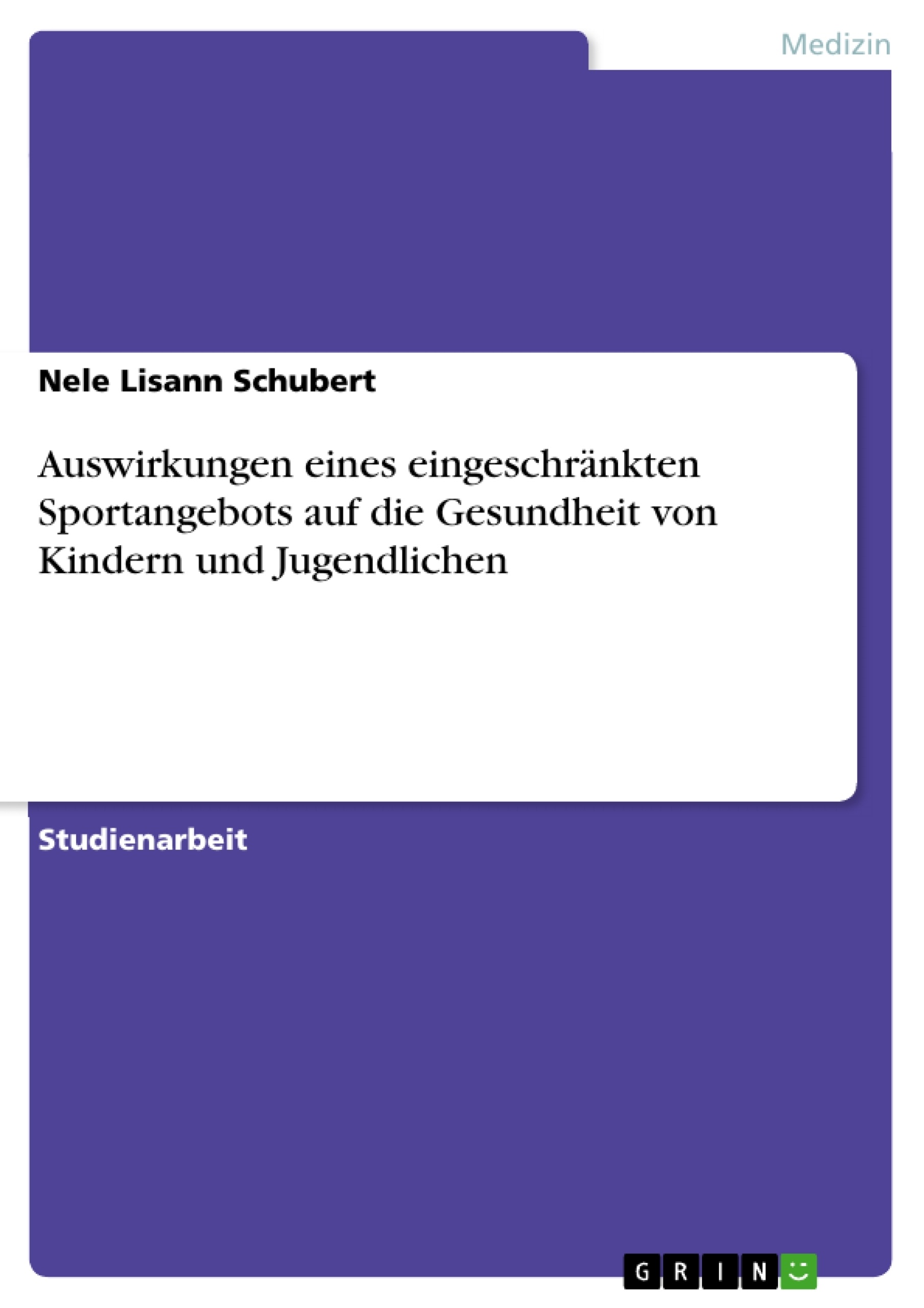Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stellt eine wichtige gesellschaftliche Ressource dar, die der Beeinflussung der unterschiedlichen Determinanten der Gesundheit unterliegt. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll aufgezeigt werden, welche physischen sowie auch psychischen Folgen und Risiken die Einschränkungen in den Sport- und Bewegungsalltag von Kindern und Jugendlichen mit sich bringt.
Seit im Januar 2020 der erste Corona-Patient identifiziert wurde, hat das Virus Deutschland fest im Griff. Das Coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID-19) ist eine durch Tröpfchen übertragene potentiell tödliche Infektionserkrankung mit hoher Ansteckungsgefahr. Welche Auswirkungen das Coronavirus auf das alltägliche Leben der Bevölkerung hat, war zu dem Zeitpunkt unvorstellbar. Die gegenwärtige Coronavirus-Pandemie stellt für viele Menschen die wohl größte Herausforderung nach Ende des Zweiten Weltkrieges dar. Schon seit dem Mittelalter wird die Menschheit immer wiederkehrend durch Infektionskrankheiten geplagt, die erhebliche Einschnitte in Gesellschaft und Politik mit sich bringen und Seuchenbekämpfung in den Fokus rückt.
Die aktuelle weltweite Krise fordert nicht nur zahlreiche Menschenleben, sondern geht auch mit einer Wirtschaftskrise, umfassenden Einschnitten in das Leben und den Wohlstand der Menschen, sowie in einigen Teilen der Welt mit einem Leben unter den notwendigen Lebensgrundlagen einher. Die Empfehlung der WHO umfasst soziale Distanzierung und versetzt zahlreiche Länder in einen „Lockdown“. Aus den vielfältigen Einschränkungen des alltäglichen Lebens resultieren ökonomische und soziale Auswirkungen, die bisher nur schwer abgeschätzt werden können. Besonders die gesamte Bandbreite des organisierten Sports und der Fitnessbranche, sowie Tourismus und Gastronomie sind besonders hart betroffen.
Auch die Teilnahme an öffentlichen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, welche normalerweise als gesundheitsfördernd gilt, wurde stark eingeschränkt. Studien der Weltgesundheitsorganisation belegen, dass Sport und Bewegung einen erheblichen Beitrag zu physischer und psychischer Gesundheit des Menschen beitragen und zu einem starken Immunsystem beitragen, welches die beste Prophylaxe gegen Krankheiten und Infektionen bietet. Der DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) appelliert mit einem Schreiben an die Regierung, Sport als Teil der Lösung der Pandemiebekämpfung anzusehen und nicht als Problem.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Corona Maßnahmen in Deutschland
- Gesundheit
- Determinanten von Gesundheit
- Psychische Gesundheit
- Sport und Bewegung in Zeiten der Corona-Pandemie
- Schule zu Corona Zeiten
- Bedeutung von Sport und Bewegung im Kindes- und Jugendalter
- Bewegungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen
- Bewegungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie
- Auswirkungen des eingeschränkten Sportangebots auf Kinder und Jugendliche
- Fazit und Ausblick
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen des Sportangebots auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Es soll untersucht werden, welche physischen und psychischen Folgen und Risiken diese Einschränkungen mit sich bringen.
- Corona-Maßnahmen in Deutschland und deren Auswirkungen auf das Sportangebot
- Die Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Die Determinanten von Gesundheit und die Bedeutung der psychischen Gesundheit
- Die Auswirkungen des eingeschränkten Sportangebots auf die Bewegungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen
- Mögliche Folgen und Risiken der Einschränkungen für die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein. Sie beleuchtet die allgemeine Situation in Deutschland, beschreibt die Auswirkungen des Virus auf das tägliche Leben und betont die Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit.
Theoretischer Hintergrund
Dieser Abschnitt liefert den theoretischen Rahmen für die Untersuchung. Er erläutert die Corona-Maßnahmen in Deutschland, den Begriff der Gesundheit, die Determinanten von Gesundheit und die Bedeutung der psychischen Gesundheit im Kindes- und Jugendalter.
Sport und Bewegung in Zeiten der Corona-Pandemie
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, Sport und Bewegung zu betreiben. Es untersucht die Bedeutung von Sport und Bewegung in dieser Altersgruppe, beleuchtet die Herausforderungen der Pandemie und analysiert die veränderten Bewegungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen.
Auswirkungen des eingeschränkten Sportangebots auf Kinder und Jugendliche
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswirkungen der eingeschränkten Sport- und Bewegungsmöglichkeiten auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Es werden mögliche Folgen und Risiken der Einschränkungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Corona-Pandemie, Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, Sport und Bewegung, psychische Gesundheit, Determinanten von Gesundheit, Einschränkungen des Sportangebots, Bewegungsgewohnheiten, Folgen und Risiken der Pandemie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Folgen hatte der Lockdown für die Gesundheit von Kindern?
Die Arbeit zeigt auf, dass die Einschränkungen des Sportangebots zu physischen Risiken (wie Bewegungsmangel) und erheblichen psychischen Belastungen geführt haben.
Warum ist Sport im Kindes- und Jugendalter so wichtig?
Sport stärkt das Immunsystem, fördert die körperliche Entwicklung und ist eine wichtige Prophylaxe gegen psychische Erkrankungen und soziale Isolation.
Wie veränderten sich die Bewegungsgewohnheiten während der Pandemie?
Durch die Schließung von Schulen und Vereinen fielen organisierte Bewegungsmöglichkeiten weg, was oft nicht durch private Aktivitäten kompensiert werden konnte.
Was fordert der DOSB in Bezug auf die Pandemiebekämpfung?
Der Deutsche Olympische Sportbund appellierte an die Regierung, Sport als Teil der Lösung (Gesundheitsförderung) und nicht als Problem anzusehen.
Was sind die Determinanten von Gesundheit laut WHO?
Gesundheit wird durch soziale, ökonomische und physische Faktoren beeinflusst, wobei soziale Distanzierung eine neue, belastende Determinante darstellte.
- Quote paper
- Nele Lisann Schubert (Author), 2021, Auswirkungen eines eingeschränkten Sportangebots auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301002