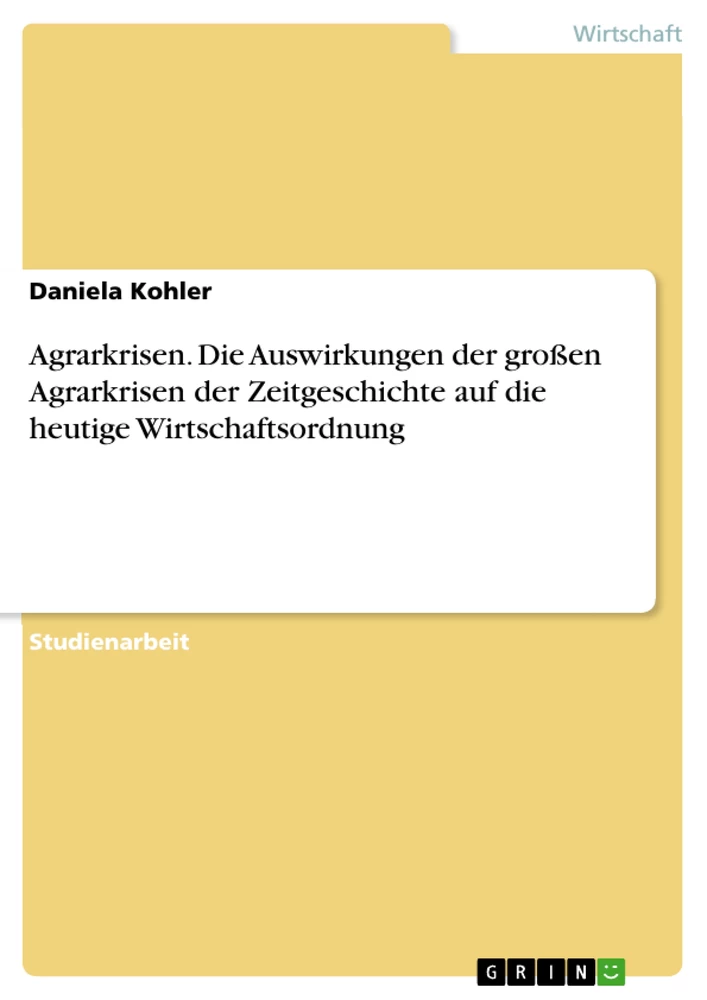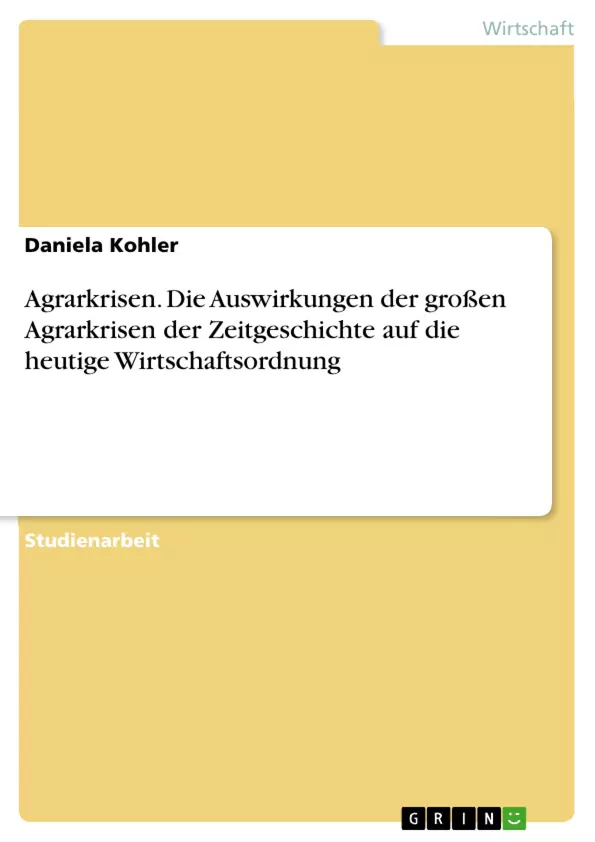Europa war im Mittelalter geprägt von mehreren großen Hungerkrisen, die den Bevölkerungszuwachs merklich stagnieren ließen oder gar zu rückläufigen Entwicklungen führten. Diese Krisen, die hauptsächlich enorme Auswirkungen auf die von der Landwirtschaft abhängigen Bevölkerungsschichten hatten, traten in unregelmäßigen Abständen in Mitteleuropa auf. Zu den größten Agrarkrisen zählen die Jahre um 1571/74, um 1771/72 und die Krise der Jahre 1816 und 1817. Diese wird auch als die letzte große Subsistenzkrise in Mitteleuropa angesehen. Das Jahr 1816 wird oft auch als das „Jahr ohne Sommer“ bezeichnet, in den USA trägt es den bezeichnenden Namen „Eighteen hundred and froze to death“ . Ausgelöst wurde die Hungerkrise durch einen lang anhaltenden Winter im Jahre 1816, selbst die Sommermonate kennzeichneten sich durch kurze aufeinander folgende Wetterumschwünge aus. Schnee und Frost wechselten sich mit lauer Luft, Tauwetter und stürmischen Regen ab. Dadurch verzögerten sich die Ernten, falls sie überhaupt einen Ertrag abworfen. Denn das schlechte Wetter führte in vielen Teilen des mittleren Europas dazu, dass „das Obst [...] nicht reif, die Kartoffeln blieben zurück und mit dem schwindenden Futterwert des Heus durch die ständigen Niederschläge ging auch die Milchleistung der Kühe zurück“. All diese Faktoren führten in den Jahren 1816 und 17 zu einem Rückgang der Erträge der Kulturpflanzen, dies wiederum erhöhte die Preise für Nahrungs- und Futtermittel. In den Teuerungsjahren waren Preissteigerungen von über 400 Prozent keine Seltenheit, vorallem in den im Binnenland gelegenen Dörfern und Ortschaften. „Die Getreidepreise, die erst seit 1816 wieder regelmäßig notiert worden sind, demonstrierten den Krisenverlauf: Seit 1817 fielen die Getreidepreise bis zu ihrem Tiefpunkt im Jahre 1825, wo sie nur noch 23% ihres Standes von 1817 betrugen.“
Um die Auswirkungen der großen Subsistenzkrisen in vollem Maße verstehen zu können, ist es notwendig die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten jener Jahre näher zu betrachten. In dieser Arbeit soll versucht werden alle nötigen Aspekte, die zu einer solchen Krise führen zu beachten und zu untersuchen.
II) Hungerkrise
Die zentrale Frage bei der Begriffsklärung einer Hunger- bzw. Agrarkrise liegt in ihrer Definition. In der breiten Bevölkerungsmasse „besteht vielfach die Neigung, jede Notlage der Landwirtschaft – ohne Rücksicht auf die entscheidenden Ursachen –
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Hungerkrise
- III) Die großen Agrarkrisen in Mitteleuropa zwischen 1500 und 1800
- 1) Die Krise des 16. Jahrhunderts
- 2) Die Krise des 18. Jahrhunderts
- IV) Subsistenzkrise 1816/17
- 1) Ursache der großen Krise
- 2) Die Krise des 19. Jahrhunderts
- a) Gegebenheiten zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- b) Ursachen jener Krise
- 3) Die Krise und ihre Auswirkungen an einem Beispiel
- VI) Schluss
- Bildanhang
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der großen Agrarkrisen der Zeitgeschichte auf die heutige Wirtschaftsordnung. Sie analysiert die Ursachen und Folgen dieser Krisen, insbesondere die Subsistenzkrise von 1816/17, und untersucht, inwiefern diese Ereignisse die Entwicklung der modernen Wirtschaftsordnung beeinflusst haben.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Agrarkrise"
- Analyse der Ursachen und Folgen der großen Agrarkrisen in Mitteleuropa
- Untersuchung der Auswirkungen der Subsistenzkrise von 1816/17 auf die Wirtschaft und Gesellschaft
- Bedeutung der Agrarkrisen für die Entwicklung der modernen Wirtschaftsordnung
- Vergleich der Agrarkrisen mit modernen Wirtschaftskrisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Agrarkrisen ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung der Agrarkrisen für die Geschichte Europas und die Entwicklung der modernen Wirtschaftsordnung.
Das Kapitel "Hungerkrise" beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Agrarkrise". Es wird untersucht, inwiefern sich Agrarkrisen von anderen Wirtschaftskrisen unterscheiden und welche Faktoren zu einer Hungerkrise führen können.
Das Kapitel "Die großen Agrarkrisen in Mitteleuropa zwischen 1500 und 1800" analysiert die Krisen des 16. und 18. Jahrhunderts. Es werden die Ursachen und Folgen dieser Krisen untersucht, sowie die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Gesellschaft.
Das Kapitel "Subsistenzkrise 1816/17" befasst sich mit der letzten großen Subsistenzkrise in Mitteleuropa. Es werden die Ursachen der Krise, wie der "Jahr ohne Sommer" 1816, sowie die Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Agrarkrisen, Subsistenzkrisen, Hungerkrisen, Wirtschaftsgeschichte, Mitteleuropa, 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Subsistenzwirtschaft, Nahrungsmittelpreise, Ernteausfälle, Wirtschaftsordnung, Konjunkturzyklen, Preisgestaltung, Landwirtschaft, Gesellschaft, Bevölkerung, Entwicklung, Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das „Jahr ohne Sommer“ 1816?
Das Jahr 1816 war geprägt von extremen Wetterumschwüngen, Frost und Schnee im Sommer, was zu massiven Ernteausfällen und der letzten großen Subsistenzkrise in Mitteleuropa führte.
Wie wirkten sich historische Agrarkrisen auf die Preise aus?
Ernteausfälle führten zu extremen Teuerungen. In den Krisenjahren 1816/17 stiegen die Preise für Nahrungsmittel oft um über 400 Prozent, was zu Hungersnöten in der Bevölkerung führte.
Was ist der Unterschied zwischen einer Hunger- und einer Agrarkrise?
Eine Agrarkrise bezieht sich auf die wirtschaftliche Notlage der Landwirtschaft, während eine Hungerkrise die daraus resultierende mangelnde Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln beschreibt.
Welche langfristigen Auswirkungen hatten diese Krisen auf die Wirtschaftsordnung?
Diese Krisen beeinflussten die Entwicklung moderner Marktmechanismen, staatlicher Vorratshaltung und führten langfristig zu einer Veränderung der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden.
Welche Rolle spielte die Subsistenzwirtschaft im 19. Jahrhundert?
Da viele Menschen direkt von ihren eigenen Erträgen lebten (Subsistenz), bedeutete ein Ernteausfall den unmittelbaren Verlust der Lebensgrundlage, ohne dass Marktmechanismen dies abfedern konnten.
- Arbeit zitieren
- Daniela Kohler (Autor:in), 2005, Agrarkrisen. Die Auswirkungen der großen Agrarkrisen der Zeitgeschichte auf die heutige Wirtschaftsordnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130111