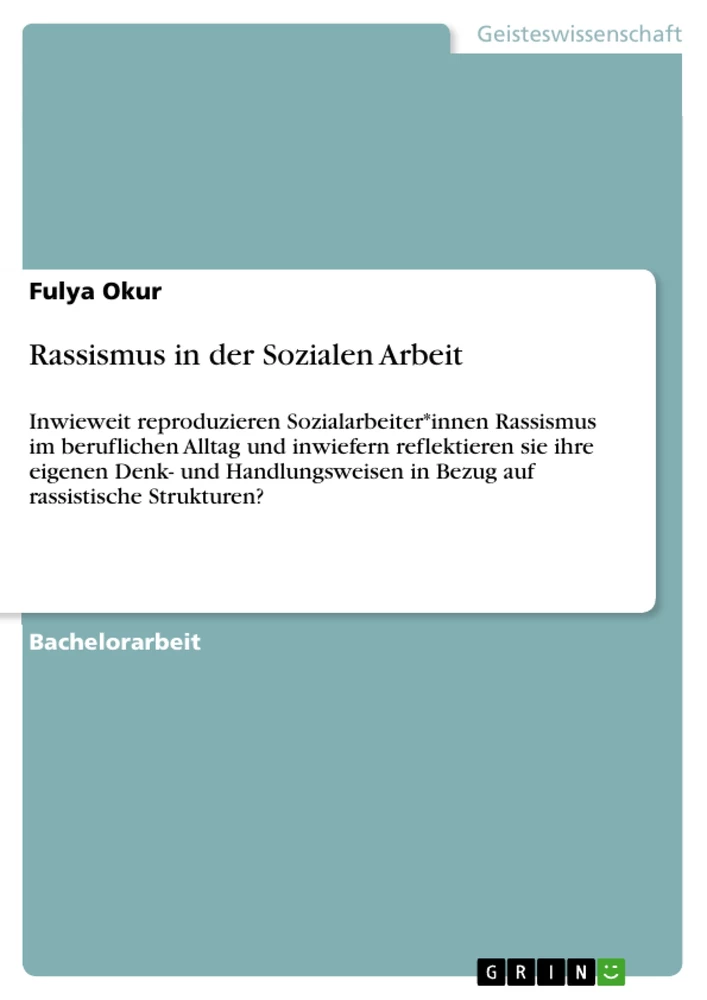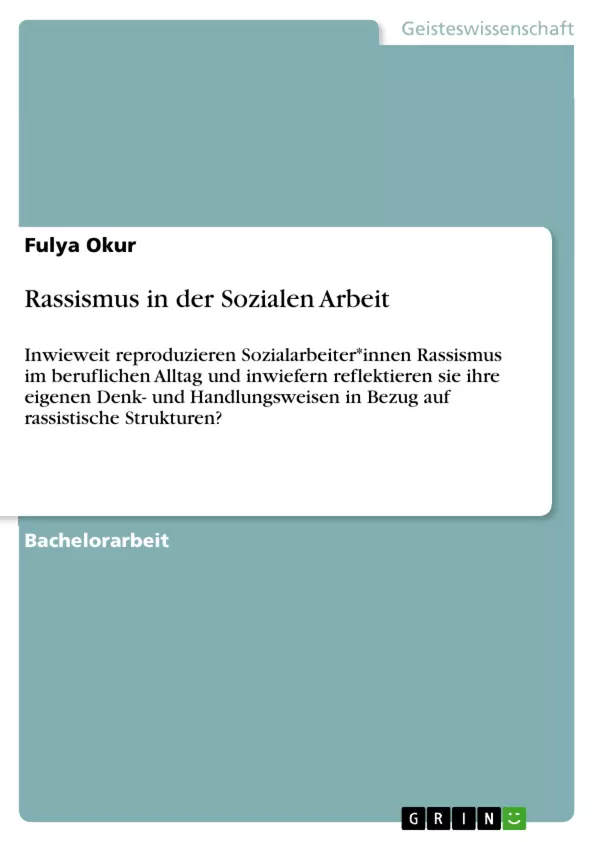Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur aktuellen Auseinandersetzung mit Rassismus in der Sozialen Arbeit leisten. Hierfür werden die Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit, die die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit begünstigt, in den Blick genommen und die Verstrickung der Sozialen Arbeit in Macht- und Herrschaftsstrukturen aufgezeigt. Die Arbeit geht konkret der Frage nach, inwiefern Sozialarbeiter*innen in ihrem beruflichen Alltag Rassismus reproduzieren und inwiefern sie ihre eigenen Denk- und Handlungsweisen in Bezug auf rassistische Strukturen reflektieren. Zentrale Antworten auf diese Frage werden durch eine bereits vorhandene Studie von Claus Melter (2006) „Rassismuserfahrungen in der Jugendhilfe: eine empirische Studie zu Kommunikationspraxen in der Sozialen Arbeit“ gewonnen. Diese Ergebnisse werden unter rassismuskritischen Gesichtspunkten ausgewertet, um die rassismuskritische pädagogische Arbeit als einen Ansatz vorzustellen, der die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit verringert und zu einer Reflexion der eigenen Positionierung in rassistischen Verhältnissen auffordert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Aufbau der Arbeit
- Begriffsdefinitionen und Schreibweisen
- Anführungszeichen
- „Rasse“
- Schwarze Menschen, weiße Menschen und People of Color
- Postkolonialismus
- Kultur
- Annäherung an den Begriff Rassismus
- Umgang mit Rassismus in der BRD
- „Ausländerfeindlichkeit“ und „Fremdenfeindlichkeit“
- Rassismustheoretische Positionen
- Rassismus als Apparat nach Mark Terkessidis
- Rassismus zur Legitimation von ungleichen Machtverhältnissen
- Rassismus ohne „Rassen“
- Alltagsrassismus
- Institutioneller und struktureller Alltagsrassismus
- Kritisches Weißsein
- Rassismuskritische Soziale Arbeit
- Othering- Konstruktion der „Anderen“
- Rassismuskritik als Querschnittaufgabe für die Soziale Arbeit
- Selbstverständnis und Auftrag der Sozialen Arbeit
- Interkulturelle Kompetenz Vermittlung
- Forschungsgegenstand
- Forschungsmethodik
- Zugang zu der Studie
- Forschungsergebnisse
- Differenziertes Wissen über Rassismus
- Sprechen über Rassismuserfahrung
- Fazit
- (Selbst-)Reflexivität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Sozialarbeiter*innen Rassismus im beruflichen Alltag reproduzieren und inwiefern sie ihre eigenen Denk- und Handlungsweisen in Bezug auf rassistische Strukturen reflektieren.
- Die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit
- Die Verstrickung der Sozialen Arbeit in Macht- und Herrschaftsstrukturen
- Die Rolle der Sozialarbeiter*innen in rassistischen Verhältnissen
- Die Bedeutung von Rassismuskritik für die Soziale Arbeit
- Die Relevanz einer reflexiven Selbstbetrachtung in Bezug auf rassistische Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Umgang mit Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland dar und zeigt, dass der Begriff „Rassismus“ häufig vermieden und durch Begriffe wie „Ausländerfeindlichkeit“ oder „Fremdenfeindlichkeit“ ersetzt wird. Sie verdeutlicht, dass rassistische Einstellungen und Praktiken tief in der Gesellschaft und ihren Institutionen verankert sind und nicht auf individuelle Haltungen oder Einstellungen zu reduzieren sind.
- Annäherung an den Begriff Rassismus: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Definition von Rassismus, wie z.B. „Ausländerfeindlichkeit“ und „Fremdenfeindlichkeit“, und stellt verschiedene rassismustheoretische Positionen vor, darunter den Ansatz von Mark Terkessidis, der Rassismus als Apparat begreift. Weiterhin werden Alltagsrassismus und institutioneller Rassismus thematisiert.
- Kritisches Weißsein: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Konzept des „kritischen Weißseins“ und analysiert die Rolle der weißen Mehrheitsgesellschaft in der Reproduktion von Rassismus.
- Rassismuskritische Soziale Arbeit: Dieses Kapitel stellt die rassismuskritische Soziale Arbeit als Ansatz vor, der die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit verringert und zu einer Reflexion der eigenen Positionierung in rassistischen Verhältnissen auffordert. Dabei werden Themen wie die Konstruktion des „Anderen“, die Interkulturelle Kompetenz Vermittlung und das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit im Kontext von Rassismus behandelt.
- Forschungsgegenstand: Dieses Kapitel präsentiert den Gegenstand der Untersuchung und stellt die Forschungsfrage nach dem Reproduzieren von Rassismus durch Sozialarbeiter*innen in den Vordergrund.
- Forschungsmethodik: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Ansätze, die für die Untersuchung angewendet werden. Es enthält Informationen zur Vorgehensweise der Forschung.
- Zugang zu der Studie: Dieses Kapitel erklärt, wie die verwendeten Daten und die Studie gewonnen wurden, um die Forschungsergebnisse zu analysieren.
- Forschungsergebnisse: Dieser Abschnitt präsentiert die zentralen Ergebnisse der Forschung, z.B. die Ergebnisse zur Differenzierung von Wissen über Rassismus bei Sozialarbeiter*innen und den Umgang mit Rassismuserfahrungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen und Konzepte wie Rassismus, Alltagsrassismus, institutioneller Rassismus, Rassismuskritik, Rassismuskritische Soziale Arbeit, (Selbst-)Reflexivität, Othering, interkulturelle Kompetenz, und die Reproduktion von Rassismus in der Sozialen Arbeit. Im Fokus der Untersuchung steht die Analyse von rassistischen Erfahrungen in der Jugendhilfe, die auf Grundlage der Studie von Claus Melter (2006) „Rassismuserfahrungen in der Jugendhilfe: eine empirische Studie zu Kommunikationspraxen in der Sozialen Arbeit“ durchgeführt wird.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Rassismus in der Sozialen Arbeit reproduziert?
Rassismus wird oft unbewusst durch institutionelle Strukturen, Alltagsrassismus und die Konstruktion des "Anderen" (Othering) in der Kommunikation mit Klienten reproduziert.
Was bedeutet "Kritisches Weißsein"?
Es ist ein Konzept, das weiße Menschen dazu auffordert, ihre eigenen Privilegien und ihre Positionierung innerhalb rassistischer Machtstrukturen zu reflektieren.
Warum wird der Begriff "Rassismus" in Deutschland oft vermieden?
Häufig werden verharmlosende Begriffe wie "Ausländerfeindlichkeit" verwendet, um die strukturelle und historische Tiefe rassistischer Verhältnisse zu umgehen.
Was ist das Ziel rassismuskritischer Sozialer Arbeit?
Ziel ist es, Machtverhältnisse zu hinterfragen, die eigene Praxis kritisch zu reflektieren und Diskriminierung in Institutionen wie der Jugendhilfe abzubauen.
Welche Rolle spielt die Studie von Claus Melter (2006)?
Die Studie liefert empirische Belege für Rassismuserfahrungen in der Jugendhilfe und analysiert die Kommunikationspraxen zwischen Sozialarbeitern und Betroffenen.
- Quote paper
- Fulya Okur (Author), 2020, Rassismus in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301376