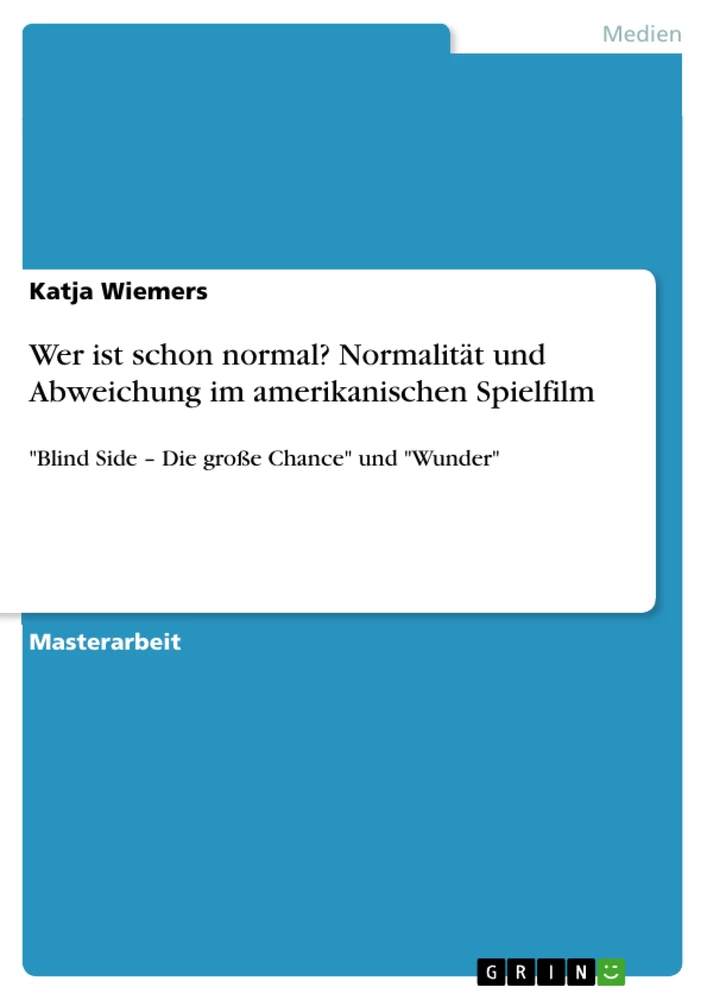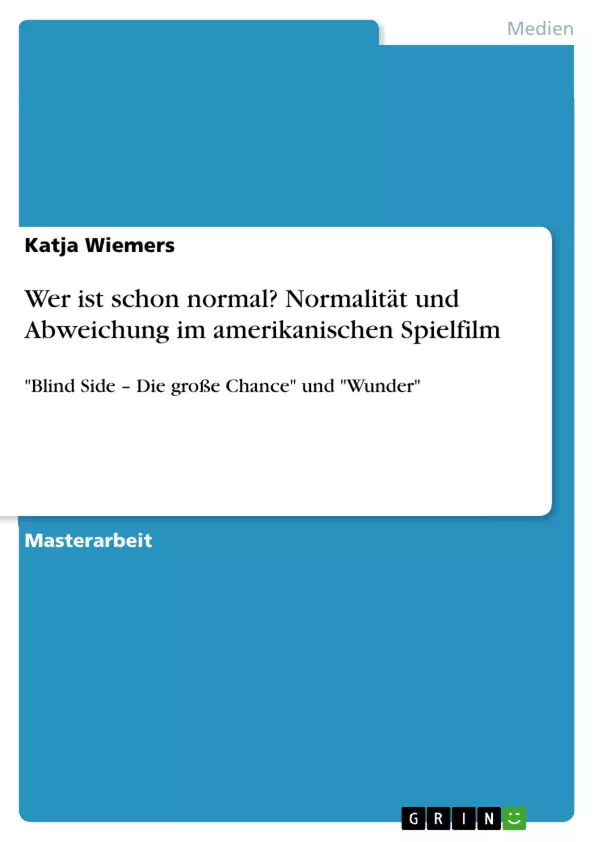Wie werden Normalität und Abweichung im amerikanischen Spielfilm inszeniert und verhandelt? Zu Beginn der Arbeit werden Links wichtigste Thesen zum Normalismus vorgestellt. Daran anknüpfend wird dargelegt, inwiefern Medien als ‚Normalisierungsagenturen‘ funktionieren. Zunächst werden die Ausgangslagen der Protagonisten untersucht, um festzustellen, in welchen spezifischen Situationen Normalisierungsbedarf entsteht und welche Normalitätsgrenzen dabei ins Spiel kommen. Daran anschließend wird der Prozess der ‚Selbstnormalisierung‘ aufgezeigt, wobei die im Film inszenierte ‚Mitte‘ sowie die ‚kurvenreichen Fahrten‘, die die Subjekte durchleben, herausgearbeitet werden. Am Ende der Studie wird versucht, einen Bezug der Filme zur Realität herzustellen.
Bei ‚Norm‘, ‚Normalität‘ und ‚Abweichung‘ handelt es sich um Begriffe, die in unserem Alltag und auch im wissenschaftlichen Diskurs in verschiedenen Bedeutungen vorkommen. Matthias Thiele schlägt daher vor, den Begriff ‚Normalität‘ möglichst eng zu definieren und bezeichnet ihn „als Gesamtheit aller sowohl diskursiven als auch praktisch-intervenierenden Verfahren, Dispositive, Instanzen und Institutionen, durch die in modernen Gesellschaften ›Normalitäten‹ produziert und reproduziert werden. In seinem „Versuch über den Normalismus“ (1996) hat es sich der Literaturwissenschaftler Jürgen Link zur Aufgabe gemacht, den ‚Archipel‘ des Normalismus zu erkunden, indem er die vielfältigen Wissensbestände seiner Zeit aufgearbeitet und eine umfangreiche fachübergreifende Studie veröffentlicht hat. Sie spielt für die Literatur- und Medienwissenschaften eine prägnante Rolle, da ein Großteil der Literatur ab 1885 sowie Kinofilme und gegenwärtige Fernsehformate normalistisch funktionieren. Vor allem fiktionale Erzählungen wie die des Spielfilms stellen Rolf Parr zufolge als eine Art von ‚Normalitätstest‘ die Möglichkeit bereit, Normalitätskonzepte zu durchbrechen, indem sie das Normalitätsspektrum und mit ihm die Grenzen zwischen ‚normal‘ und ‚anormal‘ verschieben. Um die normalistische Funktionsweise von Medien zu überprüfen, werden in vorliegender Arbeit zwei amerikanische Spielfilme aus dem Genre des Dramas auf der Ebene der Narration hinsichtlich der Strategie des flexiblen Normalismus untersucht. Es handelt sich dabei um die Filme: „Blind Side – Die große Chance“ (2009) und „Wunder“ (2017).
Inhaltsverzeichnis
- Normale Menschen - anormale Menschen. Die massenmediale Konstruktion (a-)normaler Identitäten
- Link, Jürgen: Leben in (flexibel-normalistischen) Kurvenlandschaften.
- Medien als,Normalisierungsagenturen‘. Zur Funktionalität und Effektivität normalistischer Massenmedien
- (Nicht) normale Fahrten als Narrationstyp normalistischen Erzählens.
- Der hypernormalistische Aufstieg eines Subnormalen: BLIND SIDE – DIE GROßE CHANCE.
- Weiße Wände, schwarze Mauern. Die Figur Michael gefangen im Feld des Anormalitätsspektrums
- „Auf den Mut hoffen und es der Ehre wegen versuchen“: Michaels Lebensfahrt zur Überdurchschnittlichkeit
- Kinder können grausam sein: Augusts Weg aus der Krise der Subnormalität: WUNDER
- „Ich weiß, dass ich kein normaler Zehnjähriger bin.“ Die Selbstsituierung Augusts als gesellschaftliche Randfigur.
- Es ist ok, nicht normal zu sein: Selbstakzeptanz schafft gesellschaftliche Akzeptanz.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Konstruktion von Normalität und Abweichung im amerikanischen Spielfilm. Die Arbeit analysiert zwei Filme, „Blind Side – Die große Chance“ (2009) und „Wunder“ (2017), um zu untersuchen, wie Normalität und Abweichung dargestellt und verhandelt werden und wie sich diese Darstellungen mit gesellschaftlichen Diskussionen über (A-)Normalitäten auseinandersetzen.
- Konstruktion von Normalität und Abweichung im Diskurs
- Funktionsweise von Medien als „Normalisierungsagenturen“
- Der Einfluss von Normalitätsverhandlungen auf den Filmzuschauer
- Die Inszenierung von Normalität und Abweichung im amerikanischen Spielfilm
- Die Rolle von Hollywood als globaler Normalitätensimulator
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die massenmediale Konstruktion von (a-)normalen Identitäten und stellt die zentrale Rolle der Medien im Kontext der Normalitätsdefinition dar. Im zweiten Kapitel wird die Theorie von Jürgen Link zum flexiblen Normalismus vorgestellt, die die Gesellschaft als eine „flexibel-normalistische“ Kurvenlandschaft beschreibt, in der Normalität innerhalb einer Toleranzzone existiert und Abweichung als „Extrem“ betrachtet wird.
Kapitel 3 behandelt die Funktionalität von Medien als „Normalisierungsagenturen“ und analysiert, wie Medien dazu beitragen, Normen zu etablieren und zu reproduzieren. Kapitel 4 fokussiert auf den narrativen Typus „(Nicht) normale Fahrten“ und untersucht, wie in Spielfilmen Normalität und Abweichung als narrative Elemente verwendet werden.
Das fünfte Kapitel analysiert den Film „Blind Side – Die große Chance“, indem es Michaels Lebensweg von einer „abweichenden“ Person hin zu einer „normalen“ gesellschaftlichen Figur beleuchtet. Kapitel 6 widmet sich dem Film „Wunder“ und untersucht Augusts Kampf mit seiner „Anormalität“ und seinen Weg zur Selbstakzeptanz und gesellschaftlichen Integration.
Schlüsselwörter
Normalität, Abweichung, Normalismus, Medien, Spielfilm, Hollywood, „Blind Side – Die große Chance“, „Wunder“, flexible-normalistische Kurvenlandschaften, Normalisierungsagenturen, Selbstnormalisierung, gesellschaftliche Randfigur, Selbstakzeptanz, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Wie definieren Medien, was "normal" ist?
Medien fungieren als "Normalisierungsagenturen", die durch Erzählungen und Bilder Normen reproduzieren und die Grenzen zwischen Normalität und Abweichung festlegen.
Was besagt die Theorie des "flexiblen Normalismus" von Jürgen Link?
Sie beschreibt Normalität als eine statistische Kurvenlandschaft, in der es eine breite Mitte (Normalzone) gibt und Abweichungen an den Rändern als "anormal" eingestuft werden.
Worum geht es in der Analyse des Films "Blind Side"?
Die Arbeit untersucht den Aufstieg des Protagonisten Michael von einer als "subnormal" geltenden Randfigur hin zur gesellschaftlichen Überdurchschnittlichkeit durch Sport und Integration.
Welche Rolle spielt die Selbstakzeptanz im Film "Wunder"?
Der Film zeigt, wie der Junge August durch Selbstakzeptanz seine soziale Ausgrenzung überwindet und die Wahrnehmung seiner Umwelt über "Normalität" verändert.
Was ist ein "Normalitätstest" im Spielfilm?
Fiktionale Erzählungen testen Normalitätskonzepte, indem sie das Publikum mit Abweichungen konfrontieren und so die Grenzen des Akzeptablen verschieben.
Warum wird Hollywood als "globaler Normalitätensimulator" bezeichnet?
Weil amerikanische Spielfilme weltweit verbreitet werden und somit maßgeblich mitbestimmen, welche Identitäten und Verhaltensweisen international als normal angesehen werden.
- Citar trabajo
- Katja Wiemers (Autor), 2022, Wer ist schon normal? Normalität und Abweichung im amerikanischen Spielfilm, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301448