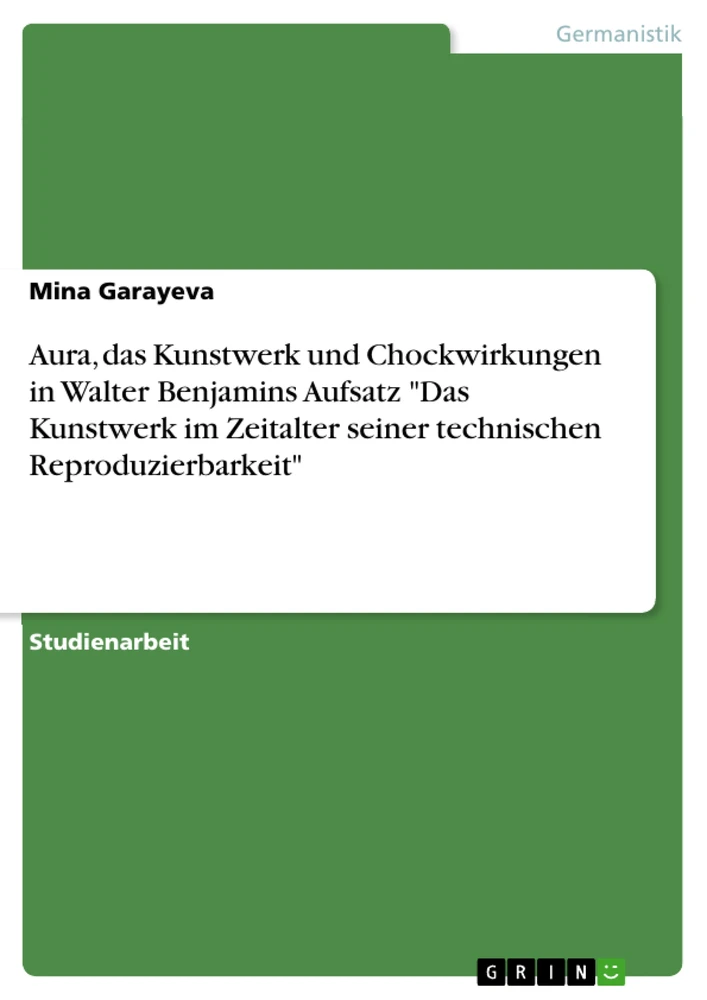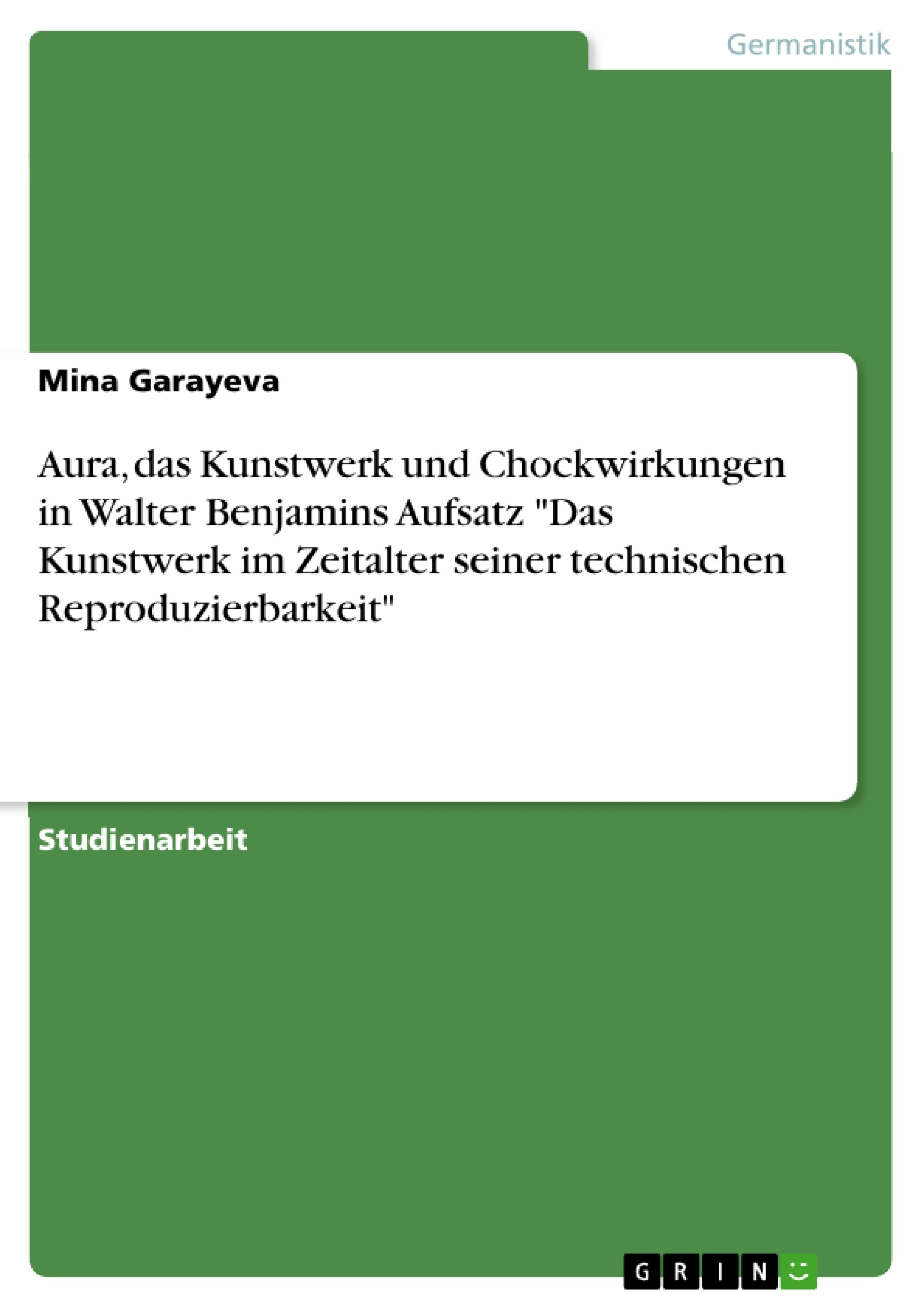In seinem Aufsatz versucht Benjamin die Gründe für den Verfall der traditionellen Kunst und die Entstehung der neuen Formen zu analysieren. Dabei bedient er sich drei wichtigen Begriffen: Aura, technische Reproduzierbarkeit und Schock.
Wie genau die Begriffe im Zusammenhang stehen, wird in folgenden Kapiteln behandelt. Zuerst wird kurz der historische Kontext vorgestellt, in dem das Werk entstand. Der Erste Weltkrieg beeindruckte Walter Benjamin sowie viele Künstlerinnen und Künstler sehr tief. Da das Bildungsbürgertum sehr schnell die humanistischen Grundsätze verwarf und sich dem extremen Nationalismus wandte, wollten die Vertreterinnen und Vertreter der Avantgarde die etablierte Wahrnehmungsmuster angreifen.
Genau da knüpft Benjamin an und will untersuchen, wie die Kunst und ihre Rezeption sich im XX. Jahrhundert änderten. Das macht er aus philosophischer, soziologischer, historischer und psychologischer Perspektive. Deshalb werden die genannten Begriffe multidisziplinär untersucht. Dabei werden vornehmlich zwei Fragen behandelt: Zum einen, was Benjamin als das auratische Kunstwerk bezeichnet und wie es sich von der technisch reproduzierbaren Kunst unterscheidet und zum anderen, was er unter der „Chockwirkung“ des Films versteht.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Die Bedeutung von Bildung
- 2.1 Die Rolle der Bildung in der Gesellschaft
- 2.2 Die Herausforderungen der Bildung
- Kapitel 3: Inklusive Bildung
- 3.1 Definition und Konzepte
- 3.2 Die Bedeutung von Inklusion in der Schule
- Kapitel 4: Exklusive Bildung
- 4.1 Ursachen und Folgen von Exklusion
- 4.2 Auswirkungen auf den Bildungserfolg
- Kapitel 5: Empirische Forschung
- 5.1 Methoden und Ergebnisse
- 5.2 Das BiLieF-Projekt
- Kapitel 6: Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Bildung in der Gesellschaft und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich im Kontext von Inklusion und Exklusion ergeben. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Bildungssystemen und sozialer Ungleichheit zu beleuchten und auf Basis empirischer Forschungsergebnisse Handlungsempfehlungen für eine gerechtere und inklusive Bildung zu formulieren.
- Inklusive und exklusive Bildung
- Soziale Ungleichheit im Bildungsbereich
- Empirische Forschungsergebnisse
- Das BiLieF-Projekt
- Handlungsempfehlungen für eine gerechtere Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bildung ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Gesellschaft.
Kapitel 2: Die Bedeutung von Bildung
Kapitel 2 beleuchtet die wichtige Rolle der Bildung in der Gesellschaft. Es werden die vielfältigen Funktionen von Bildung hervorgehoben und die Herausforderungen, denen sich die Bildung heute gegenübersieht, analysiert.
Kapitel 3: Inklusive Bildung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der Inklusion in der Bildung. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze von Inklusion vorgestellt und die Bedeutung von Inklusion in der Schule beleuchtet.
Kapitel 4: Exklusive Bildung
Kapitel 4 befasst sich mit der Problematik der Exklusion im Bildungsbereich. Es werden Ursachen und Folgen von Exklusion analysiert und die Auswirkungen auf den Bildungserfolg beleuchtet.
Kapitel 5: Empirische Forschung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse empirischer Forschung zu Inklusion und Exklusion in der Bildung präsentiert. Das BiLieF-Projekt wird vorgestellt und seine wichtigsten Erkenntnisse werden zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Bildung, Inklusion, Exklusion, soziale Ungleichheit, Empirische Forschung, BiLieF-Projekt, Handlungsempfehlungen, gerechte Bildung, Bildungssystem, Gesellschaft, Herausforderungen, Chancen.
- Quote paper
- Mina Garayeva (Author), 2019, Aura, das Kunstwerk und Chockwirkungen in Walter Benjamins Aufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301777