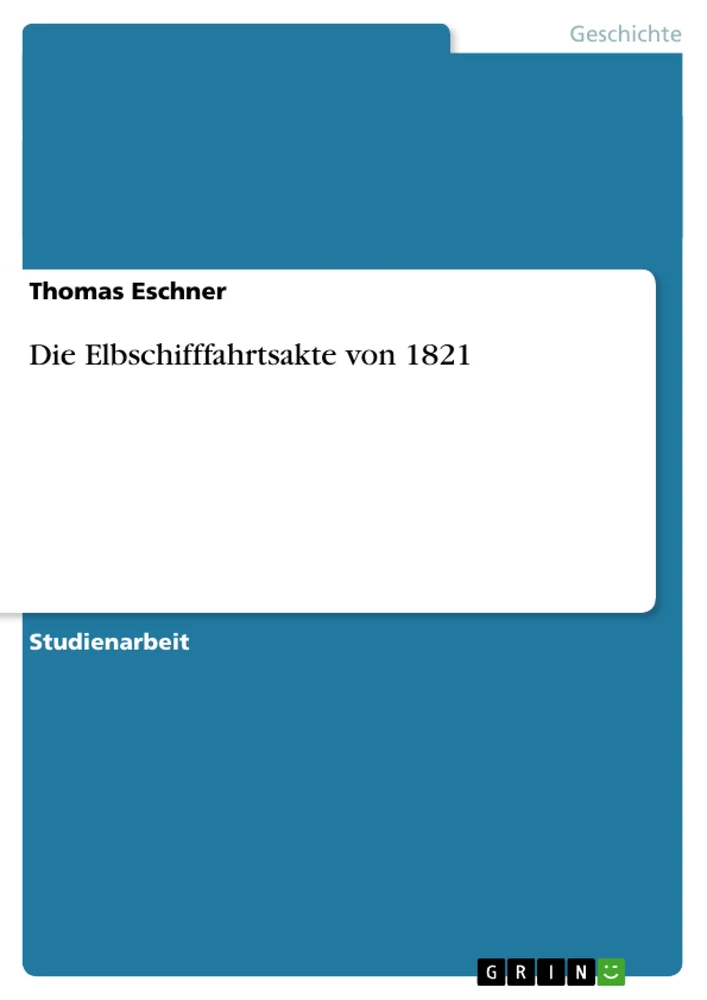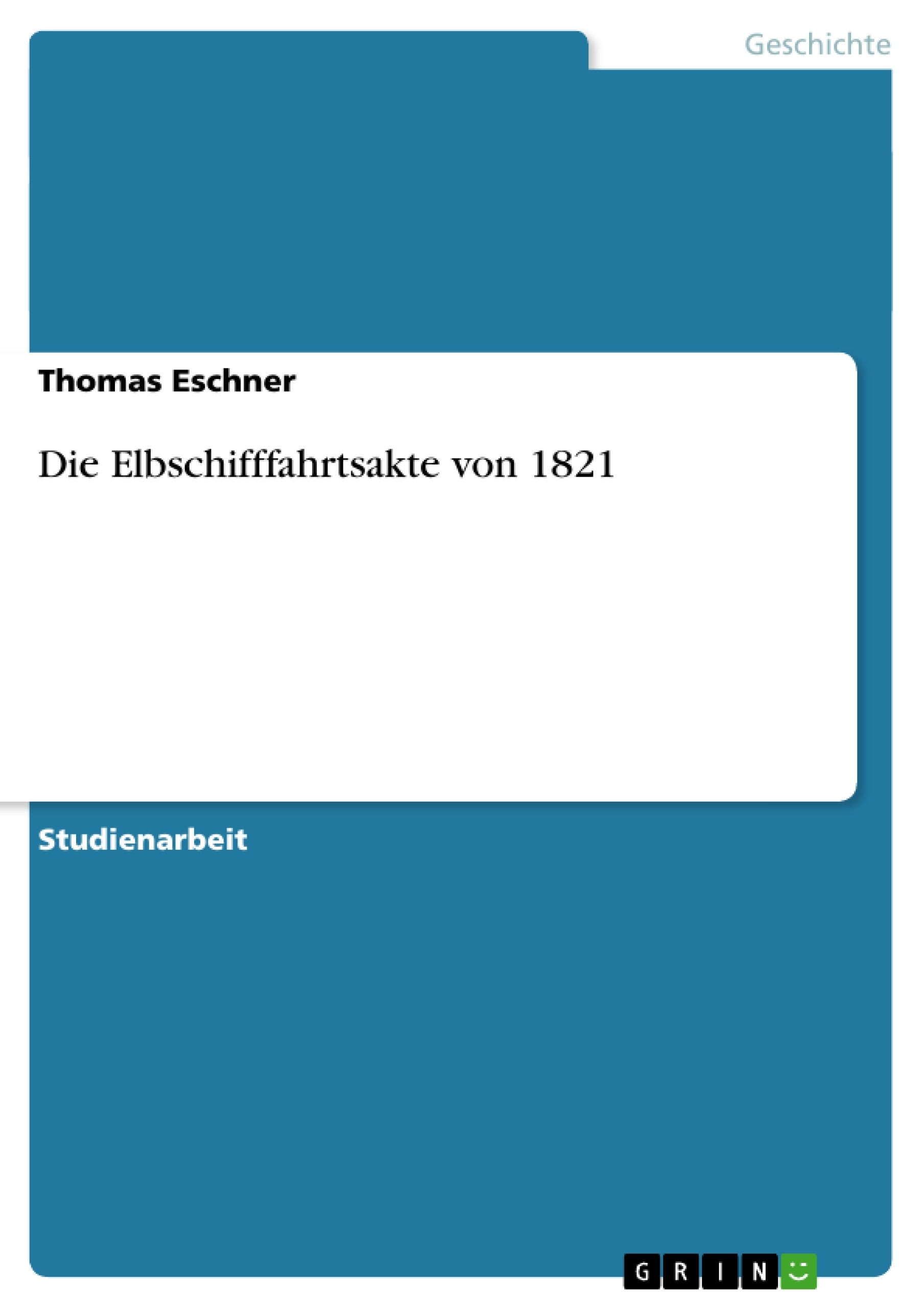Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich die Schifffahrt auf den großen deutschen Wasserstrassen in einem bedauernswerten Zustand. Nicht nur die natürlichen Hindernisse, die das verwahrloste Fahrwasser für Schiffe mit großem Tiefgang bereithielt, erschwerten den Verkehr auf den Flüssen sondern vor allem die unzähligen Abgaben und die Art ihrer Erhebung.
Die Schifffahrt auf der Elbe war durch die vielen verschiedenen Herrschaftsgebiete, die sich entlang ihrer Ufer erstreckten, besonders von diesem Abgabensystem betroffen. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts existierten auf einer Stromlänge von ungefähr 725 Kilometern nicht weniger als 35 Zollämter, die die Abgaben der auf dem Fluss fahrenden Händler entgegennahmen.
Allerdings verlangten auch die zu der Zeit „auflebende Wirtschaft wie die verbreitete Idee des Liberalismus nach einer Lockerung der dem Verkehr auferlegten territorialen Bindungen. Dem trugen die Artikel 108 bis 117 der Wiener Schlussakte vom 9. Juni 1815 Rechnung und entwarfen ein Programm für die zukünftige Gestaltung des internationalen Binnenschiffahrtsrechts.“ Für die zehn Anliegerstaaten der Elbe waren die Beschlüsse des Wiener Kongresses von allerhöchstem Interesse, wurden sie doch durch die Artikel der Schlussakte dazu angehalten, die Verhältnisse auf der Elbe so zu regeln, dass die Schifffahrt erleichtert und der Handel angeregt werde. Die „Kommission zur Organisierung der Elbschiffahrt“, die aus zehn Bevollmächtigten der Elbanliegerstaaten bestand, war im Jahre 1819 in Dresden mit dem Ziel zusammengetreten, die für die Schifffahrt auf der Elbe nötigen Bestimmungen in gemeinschaftlicher Übereinkunft zu treffen. Nach mehr als zweijähriger Verhandlungszeit konnten sich die Beteiligten auf einen Konsens einigen. Die am 23. Juni 1821 ratifizierte Elbschifffahrtsakte legte trotz ihrer bisweilen unzureichenden Veränderungen den Grundstein für Innovationen und Verbesserungen auf dem Gebiet der Elbschifffahrt und des Elbhandels.
Wie nun der Weg von der Schlussakte des Wiener Kongresses zur Elbschifffahrtsakte führte, welche Schwierigkeiten sich für die Beteiligten bei der Ausarbeitung derselben ergaben und welchen Inhalt und Charakter das Ergebnis ihrer Verhandlungen besaß, ist Gegenstand dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation der Flussschifffahrt im Deutschen Reich um 1800
- Die Regelung der Binnenschifffahrt auf dem Wiener Kongress
- Die Dresdner Elbschifffahrtskommission von 1819
- Die äußeren Umstände der Dresdner Verhandlungen
- Das Ergebnis der Dresdner Elbschifffahrtskommission – Die Elbschifffahrtsakte
- Der Nutzen der Elbschifffahrtsakte
- Das Hauptproblem der Dresdner Verhandlungen – Die Zollfrage
- Zentralverwaltung und Meliorationsarbeiten am Fahrwasser
- Schlußbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Elbschifffahrtsakte von 1821 und untersucht die Entwicklung der Schifffahrt auf der Elbe im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Veränderungen des frühen 19. Jahrhunderts. Die Arbeit analysiert die Situation der Flussschifffahrt im Deutschen Reich um 1800, die Regelung der Binnenschifffahrt auf dem Wiener Kongress und die Verhandlungen der Dresdner Elbschifffahrtskommission.
- Die Herausforderungen der Flussschifffahrt im Deutschen Reich um 1800, insbesondere die zahlreichen Abgaben und die fehlende einheitliche Verwaltung
- Die Bedeutung des Wiener Kongresses für die Regelung der Binnenschifffahrt und die Festlegung von Prinzipien für die zukünftige Gestaltung des internationalen Binnenschiffahrtsrechts
- Die Verhandlungen der Dresdner Elbschifffahrtskommission und die Herausforderungen bei der Ausarbeitung der Elbschifffahrtsakte
- Der Inhalt und die Bedeutung der Elbschifffahrtsakte für die Entwicklung der Schifffahrt auf der Elbe
- Die Auswirkungen der Elbschifffahrtsakte auf den Handel und die wirtschaftliche Entwicklung der Elbregion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Situation der Flussschifffahrt im Deutschen Reich um 1800 dar. Die zahlreichen Abgaben und die fehlende einheitliche Verwaltung erschwerten den Schiffsverkehr und hemmten die wirtschaftliche Entwicklung. Das Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe und die Herausforderungen, die die Schifffahrt auf der Elbe zu dieser Zeit prägten.
Das zweite Kapitel behandelt die Regelung der Binnenschifffahrt auf dem Wiener Kongress. Die Artikel der Schlussakte des Wiener Kongresses legten die Grundlage für die zukünftige Gestaltung des internationalen Binnenschiffahrtsrechts und forderten die Elbanliegerstaaten zur Zusammenarbeit auf, um die Schifffahrt auf der Elbe zu erleichtern und den Handel anzuregen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Dresdner Elbschifffahrtskommission von 1819. Die Kommission, bestehend aus Bevollmächtigten der Elbanliegerstaaten, verhandelte über zwei Jahre lang über die notwendigen Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Elbe. Die Verhandlungen waren von zahlreichen Schwierigkeiten geprägt, insbesondere in Bezug auf die Zollfrage. Das Kapitel beleuchtet die äußeren Umstände der Verhandlungen, die Herausforderungen und das Ergebnis der Kommission.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Elbschifffahrt, die Binnenschifffahrt, die Elbschifffahrtsakte von 1821, der Wiener Kongress, die Dresdner Elbschifffahrtskommission, die Zollfrage, die Zentralverwaltung, die Meliorationsarbeiten am Fahrwasser, die wirtschaftliche Entwicklung der Elbregion und die Geschichte der Elbe.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Elbschifffahrtsakte von 1821?
Es war eine Übereinkunft der Elbanliegerstaaten, um die Schifffahrt auf dem Fluss zu erleichtern, den Handel anzuregen und die unzähligen Zollschranken zu regulieren.
Warum war die Schifffahrt auf der Elbe vor 1821 so schwierig?
Es gab auf einer Strecke von 725 Kilometern rund 35 Zollämter verschiedener Herrschaftsgebiete, was den Transport extrem teuer und zeitaufwendig machte.
Welche Rolle spielte der Wiener Kongress für die Elbe?
Die Wiener Schlussakte von 1815 legte die Prinzipien für ein internationales Binnenschifffahrtsrecht fest und verpflichtete die Anliegerstaaten zu gemeinschaftlichen Regelungen.
Was war die Aufgabe der Dresdner Elbschifffahrtskommission?
Die 1819 zusammengetretene Kommission sollte die Bestimmungen der Wiener Schlussakte konkret umsetzen und einen Konsens zwischen den zehn beteiligten Staaten finden.
Welche Verbesserungen brachte die Akte für das Fahrwasser?
Neben der Zollregelung sah die Akte Meliorationsarbeiten (Verbesserungen) am Fahrwasser vor, um Hindernisse zu beseitigen und die Schiffbarkeit für größere Tiefgänge zu gewährleisten.
- Quote paper
- Thomas Eschner (Author), 2004, Die Elbschifffahrtsakte von 1821, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130265