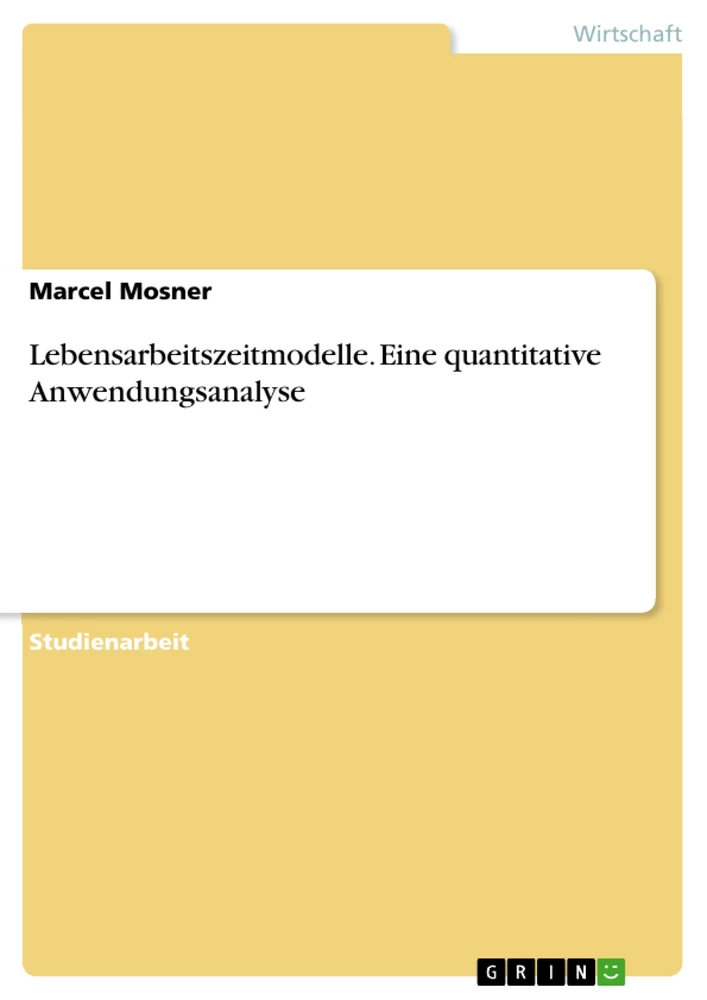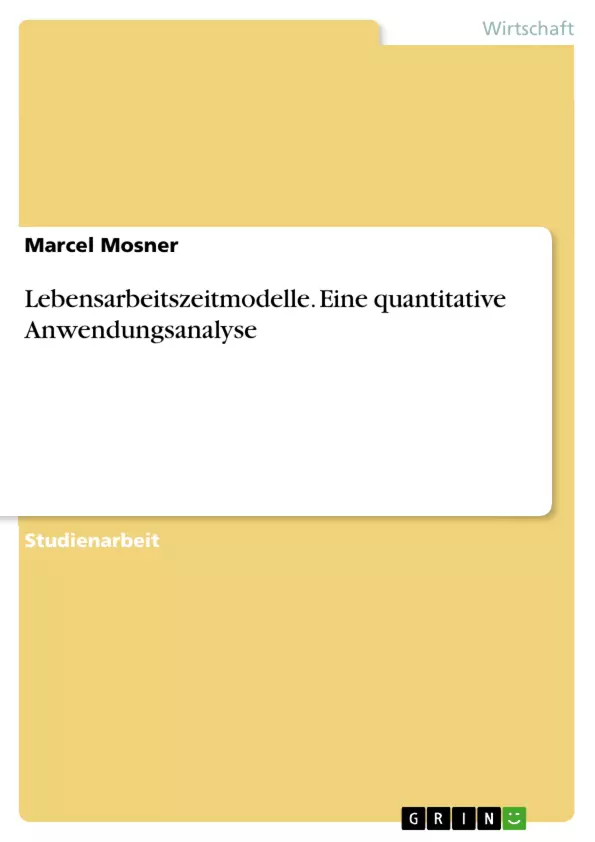Warum finden das Modell der Lebensarbeitszeit einen geringen Zuspruch? Inwiefern sind die Gründe Nachfrager oder Anbieter verschuldet und gibt es alterstechnische Unterschiede?
Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung ist der Begriff New Work im täglichen Arbeitsalltag angekommen und nicht mehr wegzudenken. Geprägt von neuen Werten wie Freiheit, Flexibilität, Selbstständigkeit und Gemeinschaft sowie Arbeitsformen wie agilem Arbeiten, Freelancing und Coworking-Spaces entsteht ein neues Verständnis von Arbeit. Diese neue Arbeit soll Flexibilität von Ort und Zeit, Work Life Blending, Selbstverwirklichung und Automatisierung mit sich bringen. Hinzu kommt, als wäre diese Arbeitsweltveränderung nicht bereits disruptiv, eine immense Beschleunigung des Wandels durch die Corona-Pandemie.
Jedoch lässt sich sagen, dass diese Entwicklungen trotz der Geschwindigkeit, mit der sie voranschreiten, nicht überraschend einherkommen. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 beobachtet das Zukunftsinstitut langfristige Entwicklungen mit entscheidender Relevanz für Wirtschaft und Gesellschaft. Daraus werden sog. Megatrends entwickelt, welche extreme Veränderungsdynamiken beschreiben und den Wandel der Welt darstellen. Für das 21. Jahrhundert wurden so die 12 Megatrends, Gender Shift, Gesundheit, Globalisierung, Konnektivität, Individualisierung, Mobilität, Sicherheit, New Work, Neo-Ökologie, Wissenskultur, Silver Society sowie Urbanisierung abgeleitet.
Werden hingegen die gängigsten Arbeitszeitmodelle in Deutschland betrachtet, fällt auf, dass sich in den letzten Jahren kaum Veränderungen hin zu den Zukunftsthemen entwickelt haben. Noch immer hat der Beobachter den Anschein, dass Gleitzeit, Teilzeit Vertrauensarbeitszeit und Schichtarbeit den Markt dominieren. Dabei gibt es mit dem Lebensarbeitszeitmodell ein Modell, welches eine Flexibilisierung der Arbeitszeit verspricht und unterschiedliche Megatrends wie Individualisierung, Gender Shift, Silver Society, New Work sowie Gesundheit bedient.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gegenstand der Arbeit
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Ziele und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition des Lebensarbeitszeitmodells
- 2.2 Vor- und Nachteile des Lebensarbeitszeitmodells
- 3. Empirische Studie zur Zuspruchsanalyse
- 3.1 Beschreibung des Datenerhebungsinstruments
- 3.2 Beschreibung der Stichprobe
- 3.3 Durchführung der empirischen Erhebung
- 3.4 Methode der Datenauswertung
- 4. Ergebnisse
- 5. Diskussion der Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geringe Akzeptanz von Lebensarbeitszeitmodellen in Deutschland. Durch eine quantitative Studie werden Gründe für den niedrigen Zuspruch analysiert und altersbedingte Unterschiede untersucht. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Faktoren zu schaffen, die die Verbreitung von Lebensarbeitszeitmodellen behindern.
- Relevanz von Lebensarbeitszeitmodellen im Kontext von New Work und Megatrends
- Vorteile und Nachteile von Lebensarbeitszeitmodellen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Analyse der Gründe für den geringen Zuspruch von Lebensarbeitszeitmodellen
- Untersuchung altersbedingter Unterschiede in der Akzeptanz von Lebensarbeitszeitmodellen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Akzeptanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Gegenstand der Arbeit: Dieses Kapitel führt in das Thema Lebensarbeitszeitmodelle ein und betont deren Relevanz im Kontext des sich wandelnden Arbeitsmarktes, geprägt von New Work und Megatrends wie Individualisierung und Digitalisierung. Es wird die Forschungsfrage formuliert, die sich mit den Gründen für den geringen Zuspruch zu diesen Modellen auseinandersetzt und die Notwendigkeit einer quantitativen Untersuchung begründet. Die Einleitung stellt einen klaren Bezug zwischen dem dynamischen Arbeitsmarkt und der scheinbar geringen Adaption von Lebensarbeitszeitmodellen her, welche flexible Arbeitszeitmodelle versprechen und sich positiv auf Megatrends wie Individualisierung, Gender Shift und New Work auswirken könnten. Die Forschungslücke wird deutlich, indem auf die fehlende Erklärung für den geringen Zuspruch hingewiesen wird.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Lebensarbeitszeitmodellen. Es definiert Lebensarbeitszeitmodelle als eine Form von Langzeitkonten, bei denen Arbeitszeit über Jahre hinweg angespart und später für Freistellungsperioden genutzt werden kann. Die verschiedenen Komponenten, die in ein solches Konto eingebracht werden können (Gehalt, Überstunden, Sonderzahlungen etc.), werden erläutert und die rechtlichen Grundlagen (Flexi-II-Gesetz) werden dargelegt. Der Abschnitt hebt die Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hervor, die durch das Modell ermöglicht wird, und zeigt die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung der angesparten Zeit auf (vollständige Freistellung, stufenweiser Abbau, Elternzeit, Weiterbildung etc.). Das Kapitel dient der fundierten Einordnung des Modells und schafft somit die Grundlage für die anschließende empirische Untersuchung.
3. Empirische Studie zur Zuspruchsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte quantitative Studie, die die Forschungsfrage der Arbeit beantwortet. Es erläutert das Design des Fragebogens als Datenerhebungsinstrument, beschreibt die Stichprobe, die Methode der Datenerhebung und die angewandte Methode der Datenauswertung. Die detaillierte Darstellung der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Beurteilung der Ergebnisse und bietet somit Transparenz bezüglich der angewandten Forschungsstrategie. Es legt den Fokus auf die Vorgehensweise bei der empirischen Überprüfung der Hypothese und bereitet den Weg für die Interpretation der im nächsten Kapitel präsentierten Ergebnisse.
FAQ: Analyse der geringen Akzeptanz von Lebensarbeitszeitmodellen in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die geringe Akzeptanz von Lebensarbeitszeitmodellen in Deutschland. Sie analysiert die Gründe für den niedrigen Zuspruch und untersucht altersbedingte Unterschiede. Ziel ist ein besseres Verständnis der Faktoren, die die Verbreitung von Lebensarbeitszeitmodellen behindern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Relevanz von Lebensarbeitszeitmodellen im Kontext von New Work und Megatrends, den Vor- und Nachteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Analyse der Gründe für den geringen Zuspruch, der Untersuchung altersbedingter Unterschiede in der Akzeptanz und der Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Akzeptanz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Gegenstand der Arbeit, 2. Theoretische Grundlagen, 3. Empirische Studie zur Zuspruchsanalyse, 4. Ergebnisse, 5. Diskussion der Ergebnisse und 6. Fazit.
Was wird im Kapitel "Gegenstand der Arbeit" behandelt?
Dieses Kapitel führt in das Thema Lebensarbeitszeitmodelle ein, betont deren Relevanz im Kontext des sich wandelnden Arbeitsmarktes und formuliert die Forschungsfrage. Es begründet die Notwendigkeit einer quantitativen Untersuchung und zeigt die Forschungslücke auf.
Was wird im Kapitel "Theoretische Grundlagen" behandelt?
Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Lebensarbeitszeitmodellen. Es definiert diese, erläutert verschiedene Komponenten, die in ein solches Konto eingebracht werden können, und legt die rechtlichen Grundlagen dar. Es hebt die Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hervor und zeigt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der angesparten Zeit auf.
Was wird im Kapitel "Empirische Studie zur Zuspruchsanalyse" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte quantitative Studie. Es erläutert das Design des Fragebogens, beschreibt die Stichprobe, die Methode der Datenerhebung und die angewandte Methode der Datenauswertung. Die detaillierte Darstellung der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Beurteilung der Ergebnisse.
Welche Art von Studie wurde durchgeführt?
Es wurde eine quantitative Studie mit einem Fragebogen als Datenerhebungsinstrument durchgeführt.
Welche Methode der Datenauswertung wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Methode der Datenauswertung im Kapitel 3, jedoch wird die spezifische Methode nicht im FAQ genannt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden im Kapitel 4 präsentiert, die detaillierte Darstellung erfolgt jedoch nicht im FAQ.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und das Fazit der Arbeit werden im Kapitel 6 präsentiert, eine detaillierte Zusammenfassung erfolgt hier nicht.
Welche Handlungsempfehlungen werden abgeleitet?
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Akzeptanz von Lebensarbeitszeitmodellen werden in der Arbeit abgeleitet, jedoch nicht im Detail im FAQ aufgeführt.
- Citar trabajo
- Marcel Mosner (Autor), 2022, Lebensarbeitszeitmodelle. Eine quantitative Anwendungsanalyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1303218