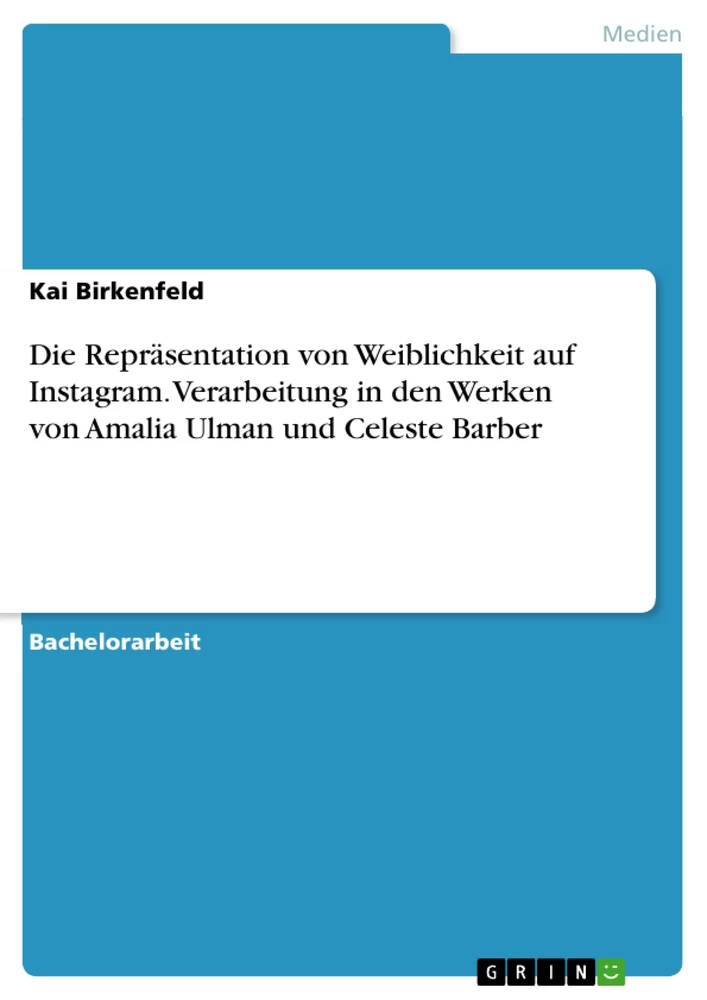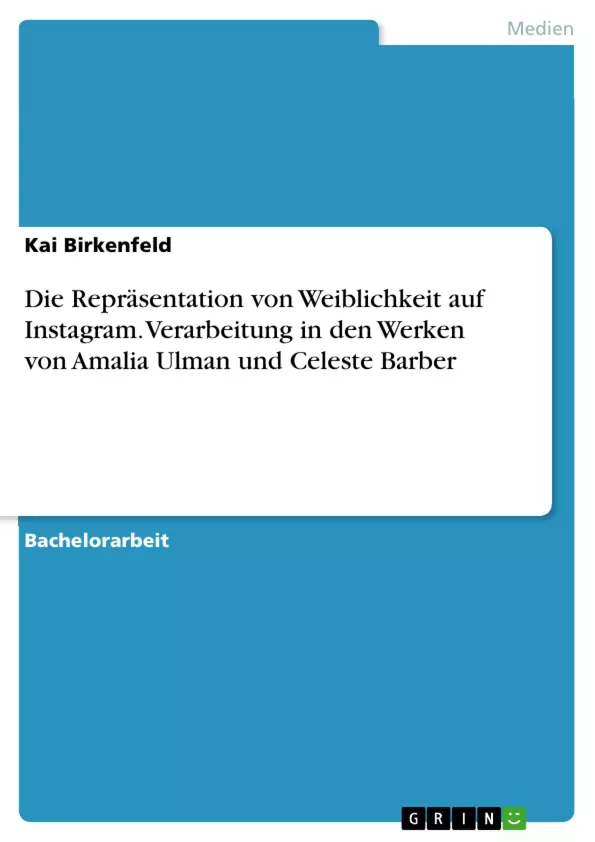In dieser Bachelorarbeit werden die Performance "Excellences & Perfections" der Künstlerin Amalia Ulman sowie die Werkreihe, welche die Komikerin Celeste Barber unter dem Hashtag #celestechallangeaccepted auf Instagram veröffentlicht daraufhin untersucht, wie sie die Darstellungsmuster von Weiblichkeit auf Instagram verarbeiten und infrage stellen. Dafür wird in einem ersten Schritt untersucht, wie Weiblichkeit auf der Plattform vornehmlich dargestellt wird. Anschließend werden die Werke als Ganzes betrachtet, um danach jeweils drei einzelne Bilder genauer zu analysieren.
Geschlechtliche Rollenbilder werden stark durch Massenmedien vermittelt, zu welchen Instagram gezählt werden kann. Gleichzeitig findet in sozialen Medien, begünstigt durch unterschiedliche Prozesse, eine Darstellungsverengung statt. Dies führt auf Instagram zu einer einseitigen und stereotypen Weiblichkeitsdarstellung. Celeste Barber verarbeitet diese vor allem mit Mitteln des Humors und legt sie so offen. Sie konzentriert sich dabei vor allem auf das Herausstellen des engen weiblichen Schönheitsideals und die auf der Plattform vorherrschende Inszeniertheit. Amalia Ulman taucht hingegen zuerst in die Praktiken auf Instagram ein und imitiert sie mittels fiktiven Instagram Alter-Egos, um anschließend das Weiblichkeitsbild und die damit verbundene Maskerade durch das Offenlegen der fiktiven und künstlerischen Natur ihrer Performance herauszustellen. Ulman gelingt es insbesondere offenzulegen, wie sehr bestimmte Verhaltensweisen von Frauen als abnormal gelabelt werden, und wie auf Instagram die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Die Beschaffenheit Sozialer Netzwerke und insbesondere Instagrams
- 2.1 Soziale Netzwerke (Funktionsweise und Nutzen)
- 2.2 Instagram (Funktionsweise und Einfluss auf Nutzer*innen)
- 3. Die Darstellungsmuster von Weiblichkeit auf Instagram
- 3.1 Weiblichkeit / Feminität im Allgemeinen
- 3.2 Die Repräsentation von Weiblichkeit auf Instagram
- Vorbemerkung zu den Kapiteln vier und fünf
- 4. Die Verarbeitung der Darstellungsmuster in der Werkreihe #celestechallengeaccepted von Celeste Barber
- 4.1 Die Person Celeste Barber
- 4.2 Das Werkskonzept der Werkreihe #celestechallengeaccepted
- 4.3 Analyse ausgewählter Beiträge
- 5. Die Verarbeitung der Darstellungsmuster in Excellences & Perfections von Amalia Ulman
- 5.1 Die Person Amalia Ulman
- 5.2 Das Werkskonzept von Excellences & Perfections
- 5.3 Analyse ausgewählter Beiträge
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Performance Excellences & Perfections der Künstlerin Amalia Ulman sowie die Werkreihe #celestechallangeaccepted der Komikerin Celeste Barber auf Instagram. Die Arbeit untersucht, wie diese Künstlerinnen die Darstellungsmuster von Weiblichkeit auf Instagram verarbeiten und in Frage stellen. Dazu wird zunächst untersucht, wie Weiblichkeit auf der Plattform vornehmlich dargestellt wird. Anschließend werden die Werke als Ganzes betrachtet, um danach jeweils drei einzelne Bilder genauer zu analysieren.
- Die Darstellung von Weiblichkeit auf Instagram
- Die Verarbeitung von Weiblichkeitsdarstellungen in den Werken von Celeste Barber und Amalia Ulman
- Die kritische Auseinandersetzung mit den etablierten Darstellungsweisen von Weiblichkeit
- Die Rolle von Instagram als Medium der Selbstdarstellung und der Vermittlung von Rollenbildern
- Die Frage nach der Grenze zwischen Fiktion und Realität auf Instagram
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Untersuchung und die Forschungsfragen darstellt. Kapitel 2 behandelt die Beschaffenheit von Sozialen Netzwerken im Allgemeinen und von Instagram im Besonderen. Kapitel 3 beleuchtet die Darstellungsmuster von Weiblichkeit auf Instagram. In den Kapiteln 4 und 5 werden die Werke von Celeste Barber und Amalia Ulman analysiert, wobei jeweils ein Abschnitt zur Person und zum Werkskonzept sowie eine Analyse ausgewählter Beiträge erfolgt. Das Resümee fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Weiblichkeit, Instagram, Soziale Medien, Selbstdarstellung, Rollenbilder, Kunst und Performance, Analyse von Instagram-Profilen, Genderdarstellungen und Medienspezifik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Weiblichkeit auf Instagram typischerweise dargestellt?
Die Darstellung ist oft einseitig und stereotyp, geprägt von engen Schönheitsidealen und einer starken Inszenierung des Alltags.
Was ist das Konzept hinter Celeste Barbers #celestechallengeaccepted?
Barber parodiert mit Humor die hochglanzpolierten Fotos von Models und Celebrities, um die Künstlichkeit und Absurdität dieser Darstellungen offenzulegen.
Worum geht es in Amalia Ulmans Performance „Excellences & Perfections“?
Ulman erschuf fiktive Alter-Egos auf Instagram, um gängige Weiblichkeitsklischees zu imitieren und später durch die Enthüllung als Kunstprojekt die Grenzen zwischen Fiktion und Realität zu hinterfragen.
Welchen Einfluss hat Instagram auf geschlechtliche Rollenbilder?
Als Massenmedium trägt Instagram maßgeblich zur Vermittlung und Verfestigung von Rollenbildern bei, wobei es oft zu einer „Darstellungsverengung“ kommt.
Was bedeutet „Maskerade“ im Kontext von Amalia Ulmans Werk?
Es beschreibt die bewusste Übernahme von Weiblichkeitsklischees als eine Form der Performance, um die Konstruiertheit von Geschlechterrollen aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Kai Birkenfeld (Autor:in), 2022, Die Repräsentation von Weiblichkeit auf Instagram. Verarbeitung in den Werken von Amalia Ulman und Celeste Barber, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1303465