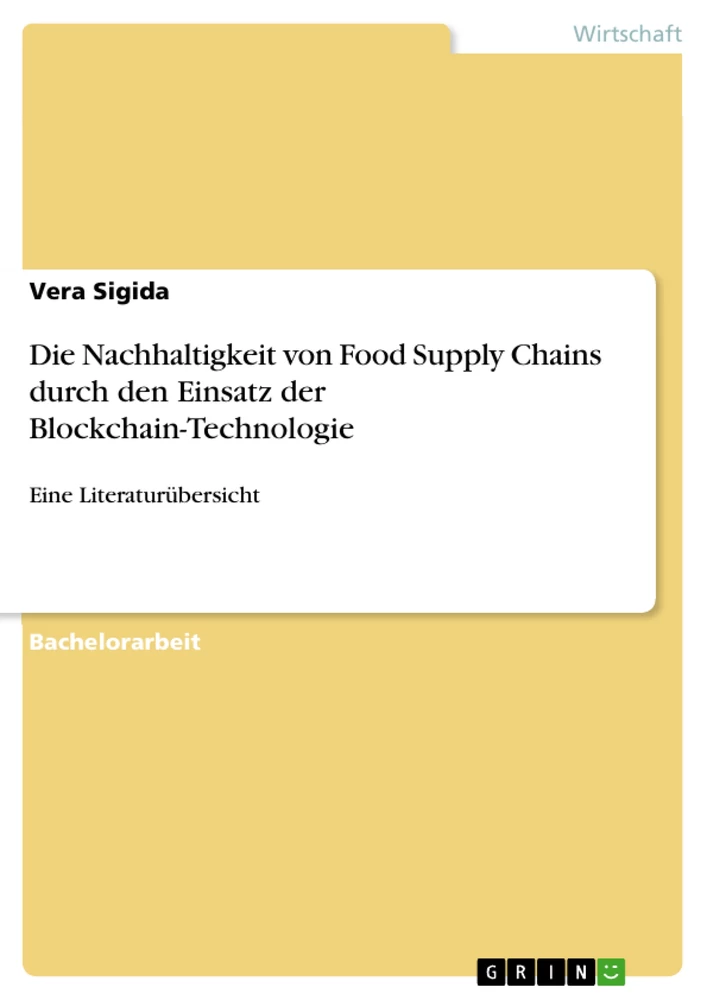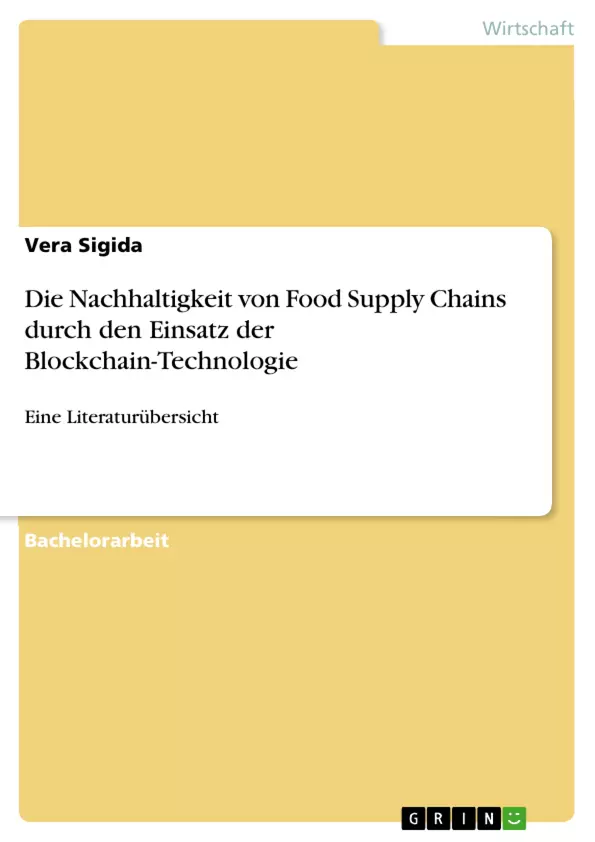Inwiefern kann durch die Blockchain-Technologie die Nachhaltigkeit in der Food Supply Chain gefördert werden? Weiterhin sollen Handlungsempfehlungen für Unternehmen vergeben und ein Ausblick für mögliche Forschungsbereiche gegeben werden. Zu Beginn dieser Ausarbeitung wird zuerst die Nachhaltigkeit definiert. Zudem werden der Aufbau und die Herausforderungen einer nachhaltigen Food Supply Chain beschrieben. Anschließend werden die wesentlichen Eigenschaften der Blockchain-Technologie vorgestellt. Nachdem ein grundlegendes Verständnis geschaffen wurde, wird der Forschungsstand zur Nachhaltigkeit in der Food Supply Chain durch den Einsatz der Blockchain untersucht. Dafür wird die Methode der systematischen Literaturübersicht verwendet. Zur Betrachtung der Nachhaltigkeit wird ein Framework eingesetzt, welcher die Treiberdimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Abschließend wird ein Fazit gezogen und Handlungsempfehlungen ausgesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Nachhaltige Food Supply Chain
- 2.1.1 Definition der Nachhaltigkeit
- 2.1.2 Genereller Aufbau einer Food Supply Chain
- 2.1.3 Herausforderungen in Food Supply Chains
- 2.2 Eigenschaften der Blockchain Technologie
- 2.2.1 Transparenz
- 2.2.2 Effizienz
- 2.2.3 Dezentralität
- 2.2.4 Datensicherheit
- 3 Literaturübersicht zur Blockchain in nachhaltigen Food Supply Chains
- 3.1 Erstellung und Ergebnis der Literaturübersicht
- 3.2 Ökonomische Nachhaltigkeit
- 3.2.1 Lückenloser Datenaustausch
- 3.2.2 Supply-Chain-Transparenz
- 3.2.3 Rückverfolgbarkeit
- 3.2.4 Kosten und Geschwindigkeit
- 3.2.5 Disintermediation und Opportunismus
- 3.3 Soziale Nachhaltigkeit
- 3.3.1 Herkunft
- 3.3.2 Vertrauen
- 3.3.3 Datenschutz und Sicherheit
- 3.3.4 Antikorruption
- 3.4 Ökologische Nachhaltigkeit
- 3.4.1 Überprüfung und Verifikation
- 3.4.2 Ressourcenoptimierte Nutzung
- 3.4.3 Recycle-Exchange-Tokenisierung
- 4 Zusammenfassung und Fazit
- 5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einsatz der Blockchain-Technologie zur Steigerung der Nachhaltigkeit in Food Supply Chains. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema aufzuzeigen und die potenziellen Vorteile und Herausforderungen zu analysieren.
- Nachhaltigkeit in Food Supply Chains
- Eigenschaften und Anwendung der Blockchain-Technologie
- Ökonomische, soziale und ökologische Auswirkungen der Blockchain auf die Nachhaltigkeit
- Herausforderungen und Chancen des Blockchain-Einsatzes
- Analyse bestehender Literatur und Forschungslücken
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die zunehmende Komplexität globaler Food Supply Chains und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsprobleme, wie opportunistisches Verhalten, Korruption und Ressourcenverschwendung. Der steigende globale Bedarf an Nahrungsmitteln und die Fragilität der Lieferketten aufgrund unvorhergesehener Ereignisse wie Pandemien und Kriege werden als Hauptargumente für die Notwendigkeit einer Steigerung der Nachhaltigkeit hervorgehoben. Die Arbeit betont die Rolle von Transparenz und Rückverfolgbarkeit sowie das Potenzial der Blockchain-Technologie als Lösung für diese Herausforderungen.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert Nachhaltigkeit im Kontext von Food Supply Chains, beschreibt den Aufbau solcher Ketten und beleuchtet die wichtigsten Herausforderungen, die mit ihnen verbunden sind. Darüber hinaus werden die Kernmerkmale der Blockchain-Technologie – Transparenz, Effizienz, Dezentralität und Datensicherheit – detailliert erklärt, und ihre potenzielle Relevanz für die Lösung der zuvor identifizierten Probleme in Food Supply Chains wird begründet. Die Kapitelteile bilden die Basis für die anschließende Literaturanalyse.
3 Literaturübersicht zur Blockchain in nachhaltigen Food Supply Chains: Dieser zentrale Teil der Arbeit präsentiert eine umfassende Literaturübersicht, die sich mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in Food Supply Chains auseinandersetzt. Die Übersicht ist in ökonomische, soziale und ökologische Aspekte unterteilt und analysiert, wie Blockchain in jedem dieser Bereiche zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen kann. Der Abschnitt beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Methodik der Literaturrecherche und -auswahl. Die Ergebnisse werden systematisch präsentiert und kritisch diskutiert, um Stärken und Schwächen des Einsatzes von Blockchain aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Food Supply Chain, Blockchain, Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Ökonomische Nachhaltigkeit, Soziale Nachhaltigkeit, Ökologische Nachhaltigkeit, Datensicherheit, Digitalisierung, Lieferkettenmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Blockchain in nachhaltigen Food Supply Chains
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Einsatz der Blockchain-Technologie zur Steigerung der Nachhaltigkeit in Food Supply Chains. Sie analysiert den aktuellen Forschungsstand, potenzielle Vorteile und Herausforderungen dieser Technologie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Nachhaltigkeit in Food Supply Chains, die Eigenschaften und Anwendung der Blockchain-Technologie, ökonomische, soziale und ökologische Auswirkungen der Blockchain auf die Nachhaltigkeit, Herausforderungen und Chancen des Blockchain-Einsatzes sowie eine Analyse bestehender Literatur und Forschungslücken.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen (inkl. Definition von Nachhaltigkeit und Eigenschaften der Blockchain), Literaturübersicht zur Blockchain in nachhaltigen Food Supply Chains (unterteilt nach ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten), Zusammenfassung und Fazit sowie Literaturverzeichnis. Die Literaturübersicht beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Methodik der Literaturrecherche und -auswahl.
Was wird unter "Nachhaltigkeit in Food Supply Chains" verstanden?
Die Arbeit definiert Nachhaltigkeit im Kontext von Food Supply Chains und beleuchtet die Herausforderungen wie opportunistisches Verhalten, Korruption und Ressourcenverschwendung, die mit komplexen globalen Lieferketten verbunden sind. Der steigende globale Bedarf an Nahrungsmitteln und die Fragilität der Lieferketten werden als Hauptargumente für die Notwendigkeit einer Steigerung der Nachhaltigkeit hervorgehoben.
Welche Eigenschaften der Blockchain-Technologie werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Kernmerkmale der Blockchain-Technologie: Transparenz, Effizienz, Dezentralität und Datensicherheit. Es wird deren potenzielle Relevanz für die Lösung von Problemen in Food Supply Chains begründet.
Wie wird die Nachhaltigkeit im Kontext der Blockchain-Technologie betrachtet?
Die Arbeit unterteilt die Betrachtung der Nachhaltigkeit in ökonomische, soziale und ökologische Aspekte. Die Literaturübersicht analysiert, wie Blockchain in jedem dieser Bereiche zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen kann (z.B. lückenloser Datenaustausch, Rückverfolgbarkeit, Vertrauen, Antikorruption, ressourcenoptimierte Nutzung).
Welche Ergebnisse liefert die Literaturübersicht?
Die Literaturübersicht präsentiert eine umfassende Analyse des Einsatzes der Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in Food Supply Chains. Die Ergebnisse werden systematisch präsentiert und kritisch diskutiert, um Stärken und Schwächen des Einsatzes von Blockchain aufzuzeigen und vorhandene Forschungslücken zu identifizieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nachhaltigkeit, Food Supply Chain, Blockchain, Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Ökonomische Nachhaltigkeit, Soziale Nachhaltigkeit, Ökologische Nachhaltigkeit, Datensicherheit, Digitalisierung, Lieferkettenmanagement.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet das Potenzial der Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in Food Supply Chains. Es werden möglicherweise auch noch offene Fragen und weiterer Forschungsbedarf benannt.
- Quote paper
- Vera Sigida (Author), 2022, Die Nachhaltigkeit von Food Supply Chains durch den Einsatz der Blockchain-Technologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1303624