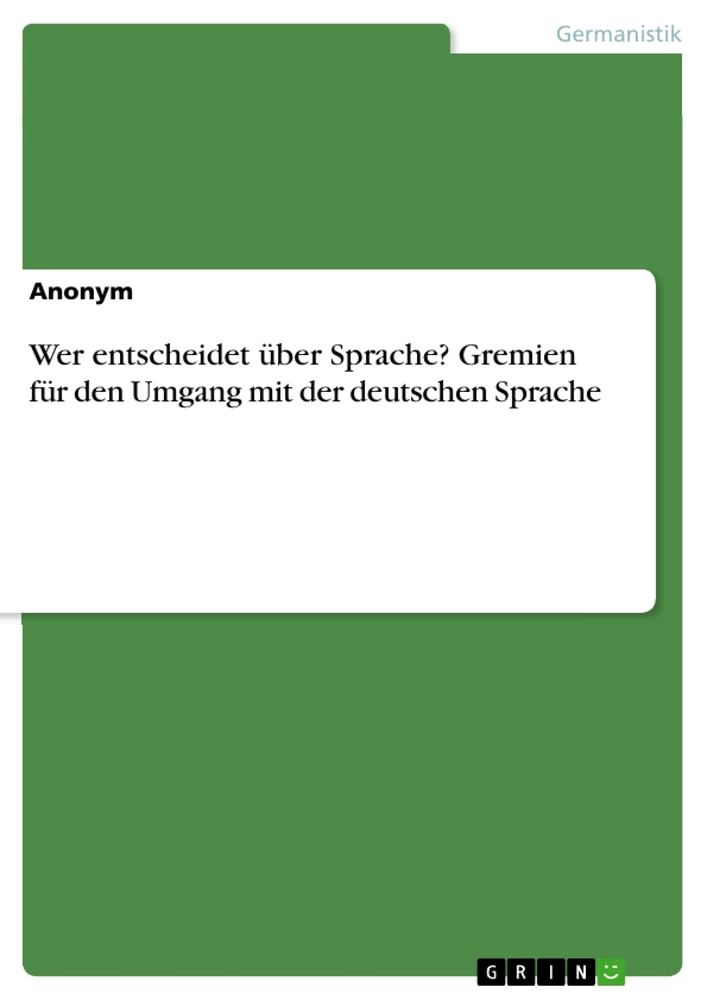Von der Respektrente über die Corona-Pandemie bis hin zum Wellenbrecher – Jahr für Jahr wird in Deutschland das „Wort des Jahres“ als sprachlicher Jahresrückblick gekürt. Doch was steckt dahinter? Wieso gerade diese Wörter? Und wer wählt sie? Genau mit solchen und grundsätzlichen Fragen über die Verantwortlichkeit der deutschen Sprache beschäftigt sich die siebte Vorlesungseinheit "Wer entscheidet über Sprache?". Um einen Überblick über die Thematik zu bekommen, werden nachfolgend die zentralen Inhalte der Vorlesung wiedergegeben. Dafür wird zunächst der gegenwärtige deutsche Sprachraum dargestellt. Anschließend die für die deutsche Sprache zuständigen Akteure und Gremien innerhalb Deutschlands beleuchtet. Und zuletzt diejenigen Einrichtungen betrachtet, welche für die auswärtige Sprachpolitik des Deutschen verantwortlich sind. Damit soll Aufschluss darüber gegeben werden, welche institutionellen Grundstrukturen hinter dem Umgang mit der deutschen Sprache stecken.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt der Vorlesungseinheit
- Der deutsche Sprachraum
- Akteure der Sprachpolitik in Deutschland
- Gremien
- Auswärtige Sprachpolitik des Deutschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesungseinheit „Wer entscheidet über Sprache?“ befasst sich mit der Frage nach der Verantwortlichkeit für die deutsche Sprache und den Institutionen, die die Sprachentwicklung und -nutzung beeinflussen. Im Fokus stehen die Akteure und Gremien, die die deutsche Sprache innerhalb und außerhalb Deutschlands prägen. Dabei soll ein Überblick über die institutionellen Grundstrukturen im Umgang mit der deutschen Sprache gewonnen werden.
- Der gegenwärtige deutsche Sprachraum
- Akteure der Sprachpolitik in Deutschland
- Institutionelle Strukturen der Sprachpolitik
- Auswärtige Sprachpolitik des Deutschen
- Gremien und Einrichtungen zur Steuerung der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Inhalt der Vorlesungseinheit
Die Einleitung stellt das „Wort des Jahres“ als Beispiel für die Auseinandersetzung mit Sprache in Deutschland vor. Die Vorlesungseinheit zielt darauf ab, die Akteure und Institutionen zu beleuchten, die die deutsche Sprache beeinflussen, und somit einen Einblick in die Struktur des Sprachmanagements zu geben.
Der deutsche Sprachraum
Dieser Abschnitt beschreibt das geografische Verbreitungsgebiet der deutschen Sprache, welches über Deutschland hinaus in weitere mitteleuropäische Länder und Regionen reicht. Die Verbreitung der deutschen Sprache wird mit einer Karte veranschaulicht, die verschiedene Dialekte und Sprachgrenzen darstellt. Die verschiedenen Dialekte werden in ihrer geographischen Lage und ihrer Beziehung zum Hochdeutschen beleuchtet.
Akteure der Sprachpolitik in Deutschland
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Akteuren, die die Sprachpolitik in Deutschland beeinflussen. Er unterteilt diese in Regierungen, Bildungseinrichtungen, Quasiregierungsorganisationen, Unternehmen und nicht-staatliche politische Organisationen. Die jeweiligen Rollen und Einflussbereiche der Akteure werden detailliert beschrieben. Der Abschnitt beleuchtet auch die Rolle des Duden-Verlags und die verschiedenen Positionen von Vereinen wie der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) und dem Verein Deutsche Sprache (VDS).
Gremien
Dieser Abschnitt stellt verschiedene Gremien vor, die sich mit sprachlichen Kontroversen auseinandersetzen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung, die Kultusministerkonferenz und der Deutsche Sprachrat werden in ihrer Zusammensetzung, ihrer Bedeutung und ihren Aufgabenbereiche vorgestellt.
Auswärtige Sprachpolitik des Deutschen
Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtungen, die die deutsche Sprache im Ausland fördern. Neben deutschen Auslandsschulen und -universitäten werden das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), staatliche Stiftungen und das Goethe-Institut vorgestellt. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Deutsche Welle (DW) werden als weitere wichtige Institutionen für die Verbreitung der deutschen Sprache im Ausland erläutert.
Schlüsselwörter
Die Vorlesungseinheit fokussiert auf die Akteure und Institutionen, die die deutsche Sprache im In- und Ausland beeinflussen. Schlüsselbegriffe sind Sprachpolitik, deutscher Sprachraum, Dialekte, Hochdeutsch, Akteure, Gremien, Institutionen, Sprachentwicklung, Sprachgebrauch, Sprachnormierung, Auswärtige Sprachpolitik, Goethe-Institut, DAAD, Deutsche Welle.
Häufig gestellte Fragen
Wer wählt das "Wort des Jahres" in Deutschland?
Das "Wort des Jahres" wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gekürt, um sprachliche Jahreshöhepunkte und gesellschaftliche Trends zu reflektieren.
Welche Institutionen bestimmen über die deutsche Rechtschreibung?
Zentrale Akteure sind der Rat für deutsche Rechtschreibung sowie die Kultusministerkonferenz, die über offizielle Regelungen im Bildungsbereich entscheiden.
Welche Rolle spielt der Duden-Verlag für die Sprache?
Obwohl der Duden ein privater Verlag ist, gilt er traditionell als Instanz für die deutsche Rechtschreibung und prägt durch seine Wörterbücher den täglichen Sprachgebrauch maßgeblich.
Was ist "auswärtige Sprachpolitik"?
Darunter versteht man die Förderung der deutschen Sprache im Ausland durch Einrichtungen wie das Goethe-Institut, den DAAD oder deutsche Auslandsschulen.
Gibt es Unterschiede zwischen Hochdeutsch und Dialekten?
Ja, der deutsche Sprachraum ist durch eine Vielzahl von Dialekten geprägt. Die Vorlesung beleuchtet deren geografische Lage und ihr Verhältnis zur standardisierten Hochsprache.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Wer entscheidet über Sprache? Gremien für den Umgang mit der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1304155