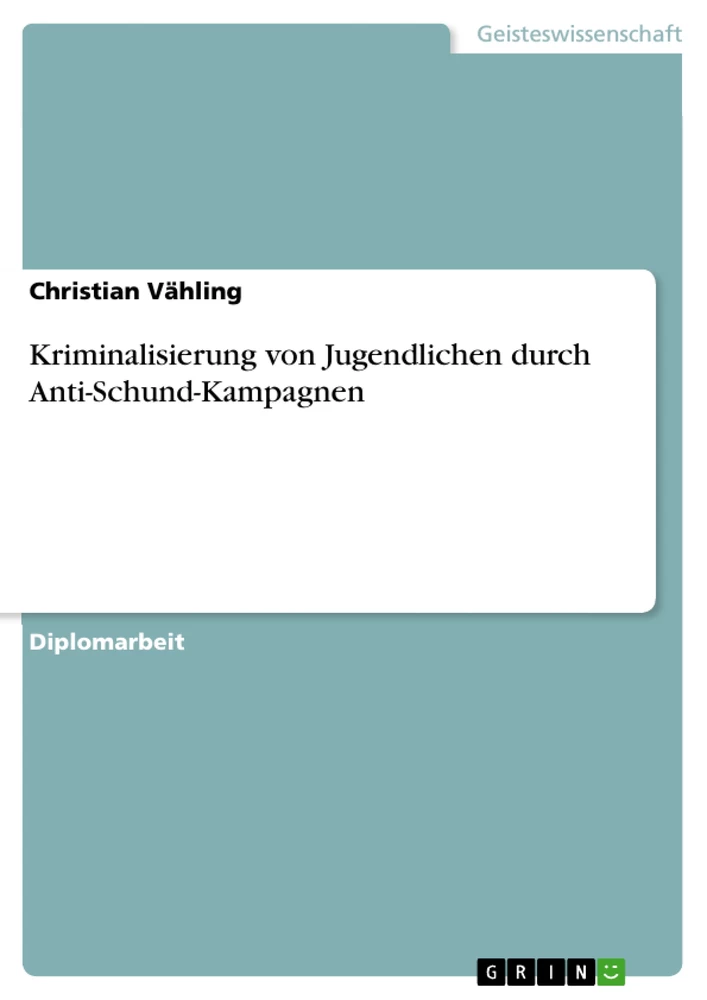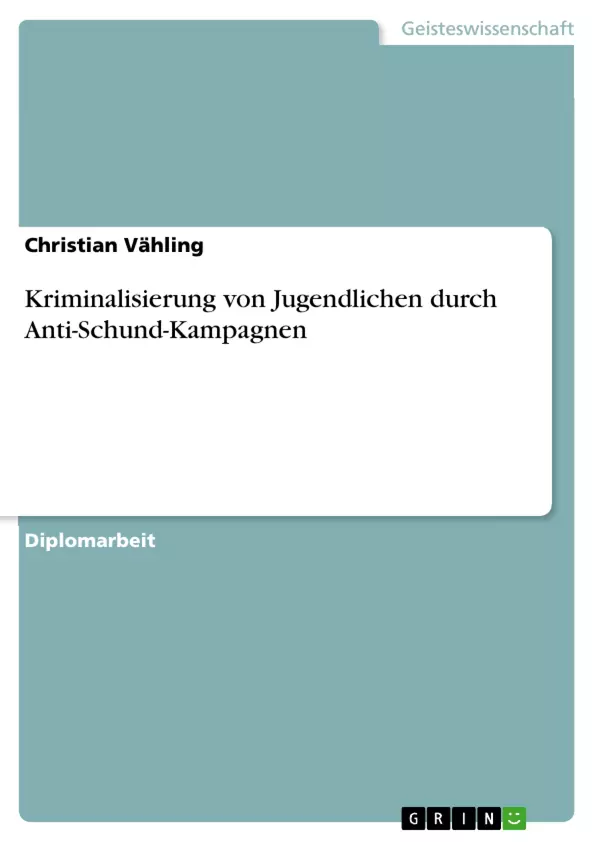Automatismus der Medienschelte
Wenn den Berichten über Verbrechen an Schulen geglaubt werden darf, ist der gewaltfördernde Einfluß von Massenmedien eine ausgemachte Sache. Die bloße Verfügbarkeit gewalthaltiger Medien im Umfeld des Täters erscheint als hinreichende Bedingung, um die Verantwortung für die Tat diesen Medien zu übertragen. Tatsächlich ist das Erklärungsmuster "Medieninduktion" so stark, daß es geeignet ist, alternative Erklärungen zu verdrängen oder zumindest zu relativieren. So wurden anläßlich des jüngsten "Amoklaufs" in Erfurt zunächst noch die auswegslose schulische Situation des Täters und das strenge Schulsystem Thüringens als Tathintergründe mit thematisiert, aber nach kurzer Zeit wurde dieser Diskurs völlig von der Diskussion über Medieninduktion und ein neues Jugendschutzgesetz überlagert.. Der sogenannte "Amoklauf von Bad Reichenhall" 1999 verdrängte in den Medien nicht nur ein gleichzeitiges, ebenso schlimmes Verbrechen, das sich weniger leicht deuten ließ, (vgl. Grimm 2002, S. 160) sondern der leicht hergestellte Bezug zu Gewaltmedien ließ andere signifikante Aspekte verblassen, von denen das Portrait Adolf Hitlers im Zimmer des Schützen (vgl. Gieselmann 2000, S. 132) nur einer der offensichtlichsten Hinweise ist. Auch bei den Schützen von Littleton 1999 ist ein rechtsradikaler Hintergrund nicht auzuschließen, da dieses Verbrechen am Geburtstag Hitlers stattfand. Dies wurde aber im Gegensatz zum Medienkonsum der Täter (in diesem Fall die Ballerspiele DOOM und QUAKE) kaum thematisiert.
In der Gewaltforschung wird schon lange nicht mehr angenommen, daß der Konsum von Gewaltmedien direkt zur Umsetzung der Inhalte führe. Die derzeit übliche Vorstellung ist, daß Gewaltmedien eine verstärkende Wirkung haben können unter der Voraussetzung, daß eine gewisse Gewaltneigung schon entwickelt ist. Es handelt sich dann um ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren, bei dem fraglich ist, welche Bedeutung der Faktor "Medien" im Vergleich mit anderen hat. Durch die Isolation eines einzigen Faktors wird die Diskussion über Gewaltursachen verzerrt. Wenn trotz aller alternativen Erklärungsmuster, und obwohl weitgehend bekannt ist, wie umstritten das Problemmuster "Mediengewalt" ist, trotzdem daran festgehalten wird, verweist das auf Plausibilitätsvorstellungen, die über den Sachverhalt hinausweisen...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Automatismus der Medienschelte
- 1.2. Theoretische Vorannahmen
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Soziale Probleme
- 2.1.1. Sachverhalt und Problemmuster
- 2.1.2. Bedingungen einer Problemkarriere
- 2.2. Diskurstheorie
- 2.2.1. Foucaults Diskursbegriff
- 2.2.2. Macht
- 2.3. Anknüpfungspunkte beider Theorien
- 2.4. Medientheoretische Überlegungen
- 3. Bisheriger Forschungsstand
- 3.1. Kampagnen
- 3.2. Wirkungen
- 3.2.1. Die "naiven" Theorien
- 3.2.2. Katharsisthese
- 3.2.3. Inhibition und Habitualisierung
- 3.2.4. Lerntheorie
- 3.2.5. Folgerung
- 4. Gesellschaftliche Bedingungen
- 4.1. Der "alte" Schunddiskurs
- 4.2. Comics in den USA
- 4.3. Die Nachkriegszeit
- 4.4. Jugendkriminalität
- 4.4.1. Statistische Zusammenhänge
- 4.4.2. Ursachen
- 4.4.3. Rolle der Medien
- 4.4.4. Sonderfall: "Halbstarke"
- 5. Der Schundkampf
- 5.1. Der Schund
- 5.1.1. Groschenhefte
- 5.1.2. Comics
- 5.1.3. Film
- 5.1.4. Illustrierte
- 5.1.5. Fernsehen
- 5.1.6. Rock'n'Roll
- 5.2. Argumentation
- 5.2.1. Allgemeine Wirkungen
- 5.2.1.1. Kulturelle Entwöhnung
- 5.2.1.2. Moralische Desorientierung
- 5.2.1.3. Affektive Überladung
- 5.2.2. Spezielle Wirkungen der Gewaltdarstellungen
- 5.2.2.1. Nachahmung
- 5.2.2.2. Einfluß bei Vorbelastung
- 5.2.2.3. Desensibilisierung
- 5.2.3. (Anti-)Amerikanismus
- 5.2.4. Jungen und Mädchen
- 5.2.5. Gegenvorstellungen
- 5.2.5.1. Gewaltfreiheit?
- 5.2.5.2. Gut und Böse
- 5.2.5.3. Ehe und Familie
- 5.2.5.4. Autoritäten
- 5.2.5.5. Religion
- 5.2.6. Das Bild der Jugend
- 5.2.6.1. Die Voraussetzung
- 5.2.6.2. Jugendliche Medienrezeption
- 5.2.6.3. Rebellion
- 5.2.6.4. Die schreckliche Generation?
- 5.3. Strategien
- 5.3.1. Fremdheit des Mediums
- 5.3.2. Vertrautheit des Grundmusters
- 5.3.3. Verbreitung des Mediums
- 5.3.4. Starke Metaphern
- 5.3.5. Einzelfälle
- 5.3.5. Einordnung der Fachdiskurse
- 5.3.6. Polarisierung der Notwendigkeiten
- 5.4. Interdiskurs
- 5.4.1. die wissenschaftlichen Perspektiven
- 5.4.1.1. Psychologie
- 5.4.1.2. Pädagogik
- 5.4.1.3. Kriminologie
- 5.4.1.4. Justiz
- 5.4.2. Buchwesen
- 5.4.3. Kirchliche Organisationen
- 5.4.4. Politik
- 5.4.5. Jugendschutz
- 5.4.6. Gegenstimmen
- 5.5 Versäumnisse des Schundkampfes
- 6. Das Schundkampf-Dispositiv
- 6.1. Moralisch-ethische Verwirrung und Gewalt
- 6.2. Diskursive Verknüpfung von Gewalt und Medien
- 6.3. Gefährliche Jugend?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Kriminalisierung von Jugendlichen durch Anti-Schund-Kampagnen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert, wie durch den Diskurs um „Schund“ und „Jugendkriminalität“ Jugendliche als gefährliche Gruppe konstruiert werden und wie diese Konstruktion zur Legitimation von staatlichen und gesellschaftlichen Kontrollmechanismen beiträgt. Dabei werden die historischen Wurzeln des Schundkampfes und seine zeitgenössischen Manifestationen in den Medien untersucht.
- Die Konstruktion von „Schund“ als soziales Problem
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Jugendkriminalität
- Die Diskursive Verknüpfung von „Schund“, Gewalt und Jugend
- Die Legitimation von Kontrollmechanismen durch die Kriminalisierung von Jugendlichen
- Die Auswirkungen von Anti-Schund-Kampagnen auf die Lebenswelt von Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Automatismus der Medienschelte in Bezug auf Jugendkriminalität dar und erläutert die theoretischen Vorannahmen der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen, insbesondere die Konzepte von „Sozialen Problemen“ und „Diskurstheorie“. Dabei wird auf Foucaults Diskursbegriff und den Zusammenhang von Macht und Wissen eingegangen. Kapitel 3 beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zu Anti-Schund-Kampagnen und deren Auswirkungen auf Jugendliche. Es werden verschiedene Theorien zur Wirkung von Medien auf Jugendliche diskutiert, wie die Katharsisthese, die Inhibitionsthese und die Lerntheorie.
Kapitel 4 untersucht die gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Entstehung des Schundkampfes führten, und beleuchtet die Rolle von Jugendkriminalität in der Nachkriegszeit. Im Fokus stehen die statistischen Zusammenhänge zwischen Jugendkriminalität und Medienkonsum sowie die Ursachen und die Rolle der Medien in diesem Kontext. Kapitel 5 analysiert den Schundkampf selbst, indem es die verschiedenen Formen des „Schunds“ (Groschenhefte, Comics, Film, Illustrierte, Fernsehen, Rock'n'Roll) und die Argumentationslinien der Schundkämpfer beleuchtet. Dabei werden die Argumente der allgemeinen und speziellen Wirkungen von „Schund“ auf Jugendliche sowie die Gegenvorstellungen der Schundkämpfer diskutiert.
Kapitel 6 widmet sich dem Schundkampf-Dispositiv, das durch die moralisch-ethische Verwirrung und die diskursive Verknüpfung von Gewalt und Medien entsteht. Das Kapitel untersucht, wie die Konstruktion einer „gefährlichen Jugend“ zu einer Legitimation von staatlichen und gesellschaftlichen Kontrollmechanismen führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die Kriminalisierung von Jugendlichen, Anti-Schund-Kampagnen, soziale Probleme, Diskurstheorie, Medienwirkungen, Jugendkriminalität, Gewaltdarstellungen, Medienkonsum, Jugendkultur, Kontrollmechanismen, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem Begriff „Medieninduktion“ im Kontext von Jugendkriminalität verstanden?
Medieninduktion beschreibt ein Erklärungsmuster, bei dem die Verantwortung für Gewalttaten an Schulen primär dem Einfluss von Massenmedien zugeschrieben wird, oft unter Vernachlässigung anderer Faktoren.
Welche Rolle spielten Videospiele bei der Analyse des Amoklaufs von Littleton?
In der öffentlichen Diskussion wurde der Konsum von Ballerspielen wie DOOM und QUAKE stark thematisiert, während andere Hintergründe wie eine mögliche rechtsradikale Gesinnung kaum Beachtung fanden.
Was besagt die aktuelle Gewaltforschung über den Konsum von Gewaltmedien?
Die Forschung geht davon aus, dass Gewaltmedien eher eine verstärkende Wirkung haben, sofern bereits eine gewisse Gewaltneigung beim Konsumenten vorhanden ist, anstatt direkt zur Tat zu führen.
Was ist das Ziel von Anti-Schund-Kampagnen?
Diese Kampagnen zielen darauf ab, bestimmte Medieninhalte als „Schund“ zu brandmarken, um staatliche Kontrollmechanismen gegenüber Jugendlichen zu legitimieren.
Welche theoretischen Grundlagen nutzt die Arbeit zur Analyse des Schund-Diskurses?
Die Arbeit stützt sich insbesondere auf Foucaults Diskursbegriff und die Konzepte von Macht und Wissen sowie auf soziologische Theorien zu sozialen Problemen.
Welche Medien wurden im historischen „Schundkampf“ besonders kritisiert?
Kritisiert wurden vor allem Groschenhefte, Comics, Filme, Illustrierte, das Fernsehen und Musikrichtungen wie Rock 'n' Roll.
- Quote paper
- Christian Vähling (Author), 2003, Kriminalisierung von Jugendlichen durch Anti-Schund-Kampagnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13049