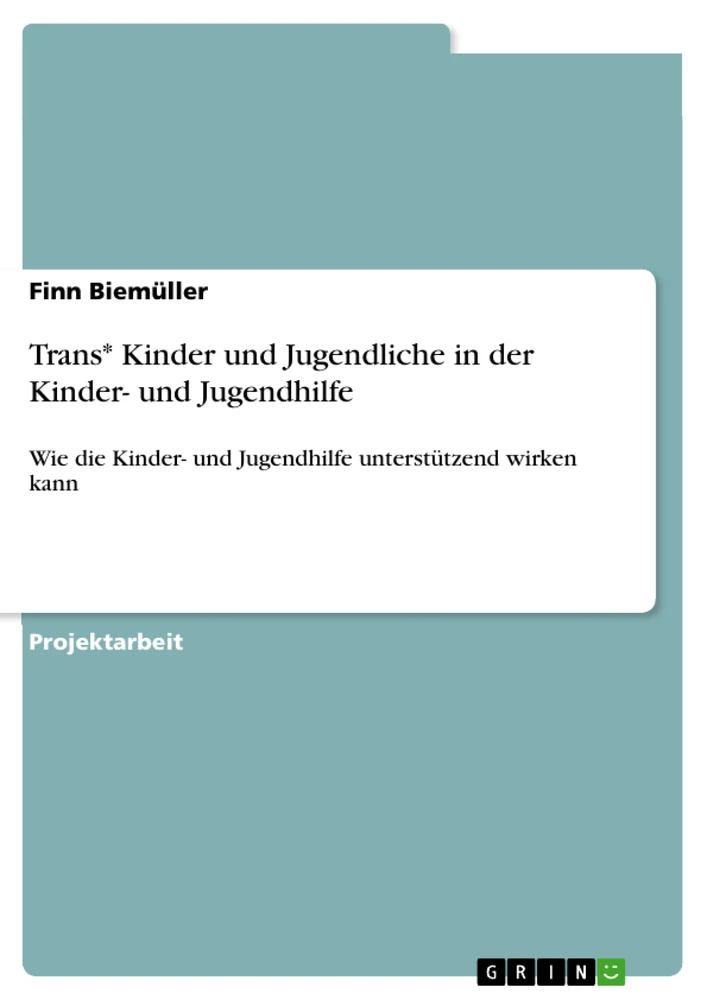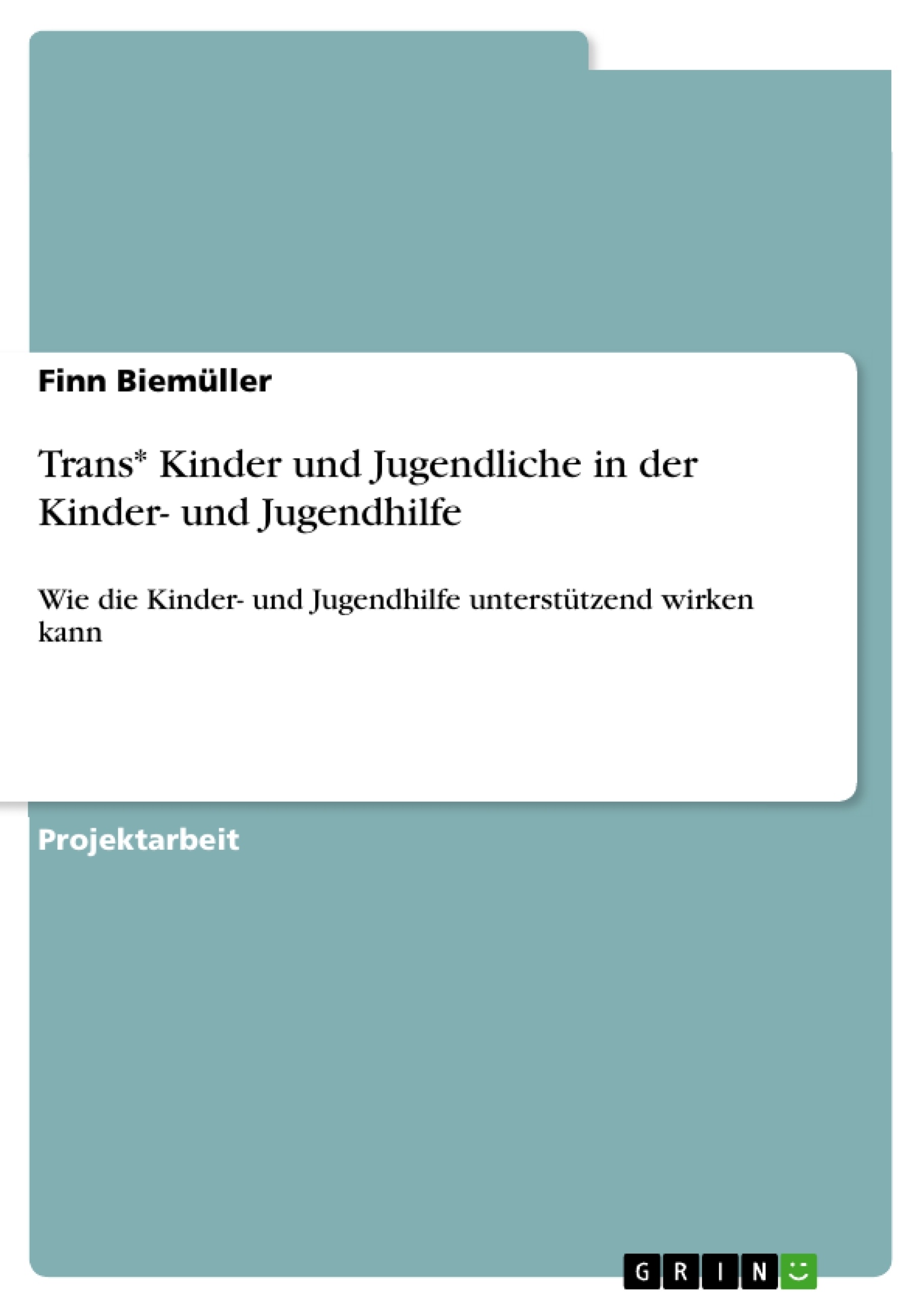Outet sich das eigene Kind gegenüber Familienangehörigen, etwa bei den Eltern, Geschwistern und Großeltern, als trans*, so ist dies eventuell für jene erst mal ein Schock. Im weiteren Prozess nimmt insbesondere der engste Familienkreis eine wichtige Rolle für das Kind oder die*den Jugendliche auf deren*dessen weiteren Weg ein. Bestenfalls wird das Kind in seiner Transition unterstützt und begleitet, auch wenn es anfangs Fragen und Unklarheiten von Seiten der Familie geben kann. Gespräche mit Therapeut*innen oder Psycholog*innen etwa können eine Möglichkeit sein, das eigene Kind besser zu verstehen und Informationen zu erhalten, wie es in Zukunft weitergehen könnte. Trans*Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe müssen unter Umständen besonders geschützt oder im Hilfekontext begleitet werden, da die LGBTQ*Community zu einer Minderheit gehört. Laut einer Studie des „mdr“, bei der es um die Suizidrate von Jugendliche ging, erfuhren von den 334 identifizierten LGBTQ*-Jugendlichen etwa 20,7 Prozent Mobbing, was somit jede* fünfte Jugendliche dieser Community wäre.
Bei den Heranwachsenden, die sich nicht als Teil der LGBTQ*-Community sehen, waren es 4,4 Prozent, was somit „nur“ jede*r Zwanzigste war. Dies veranschaulicht, dass LGBTQ*-Jugendliche anfälliger für Mobbing sind und deshalb geschützt werden sollten.
Trans*Menschen haben meistens einen schwierigen und langen Weg vor sich, sowohl aus medizinischer, als auch juristischer Sicht, wie im Folgenden aufgezeigt wird. Hier kann die Kinder- und Jugendhilfe einen Beitrag leisten, wie sie trans*Jugendliche auf ihrem Weg begleiten und unterstützen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Ein möglicher Transweg
- Medizinische Möglichkeiten
- Das TSG und die Vornamens-/Personenstandsänderung
- Die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektskizze befasst sich mit der Unterstützung von trans*Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel ist es, einen Überblick über die Herausforderungen und Hürden zu geben, denen trans*Personen im Laufe ihrer Transition gegenüberstehen, und die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe aufzuzeigen.
- Die Bedeutung des Familienkreises und der Unterstützung durch Eltern und Angehörige bei der Transition
- Medizinische Möglichkeiten wie Pubertätsblocker, Hormontherapie und geschlechtsangleichende Operationen
- Juristische Aspekte wie die Vornamens- und Personenstandsänderung gemäß dem Transsexuellengesetz (TSG)
- Die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe bei der Unterstützung von trans*Kindern und Jugendlichen
- Das Bewusstsein für heteronormatives Denken und die Notwendigkeit, Vielfalt von Identitäten und Sexualitäten zu akzeptieren
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung
Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Familienkreises und der Unterstützung, die trans*Kinder und Jugendliche in der Transition benötigen. Die besonderen Herausforderungen für LGBTQ*-Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe werden anhand einer Studie des „mdr“ verdeutlicht, die auf Mobbing und erhöhte Suizidraten hinweist. Die schwierige und langwierige Transition aus medizinischer und juristischer Sicht wird als Ausgangspunkt für die weiteren Kapitel dargestellt.
Ein möglicher Transweg
Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Schritte, die trans*Personen auf ihrem Weg zur Geschlechtsangleichung gehen können. Hierbei werden sowohl die Möglichkeiten des äußeren Coming-Outs und der Hormontherapie als auch die verschiedenen medizinischen und juristischen Optionen erläutert.
Medizinische Möglichkeiten
Das Kapitel erläutert die medizinischen Möglichkeiten für trans*Personen, die von Pubertätsblockern bis hin zu geschlechtsangleichenden Operationen reichen. Die Bedeutung der ärztlichen Indikation und der Kostenübernahme durch Krankenkassen werden dargestellt. Die Fremdbestimmung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) wird als ein wichtiger Punkt aufgezeigt.
Das TSG und die Vornamens-/Personenstandsänderung
Das Kapitel beleuchtet die Bedingungen und den Prozess der Vornamens- und Personenstandsänderung gemäß dem Transsexuellengesetz (TSG). Die Notwendigkeit der fachärztlichen Begutachtung durch unabhängige Gutachter*innen wird als Beispiel für Fremdbestimmung dargestellt.
Schlüsselwörter
Transsexualität, Transition, Kinder- und Jugendhilfe, Pubertätsblocker, Hormontherapie, geschlechtsangleichende Operationen, Transsexuellengesetz (TSG), Vornamens-/Personenstandsänderung, LGBTQ*-Community, heteronormatives Denken, Mobbing, Suizidrate.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Familie bei der Transition von trans* Kindern?
Der engste Familienkreis ist entscheidend für die Unterstützung und Begleitung des Kindes. Ein unterstützendes Umfeld kann die psychische Belastung erheblich mindern.
Welche medizinischen Möglichkeiten gibt es für trans* Jugendliche?
Zu den Optionen gehören Pubertätsblocker, Hormontherapie und später geschlechtsangleichende Operationen, wobei oft eine ärztliche Indikation und die Klärung der Kostenübernahme nötig sind.
Was regelt das Transsexuellengesetz (TSG)?
Das TSG regelt aktuell den Prozess der Vornamens- und Personenstandsänderung, der häufig mit langwierigen psychologischen Begutachtungen verbunden ist.
Wie kann die Kinder- und Jugendhilfe trans* Jugendliche unterstützen?
Sie bietet Schutzräume, Beratung und Begleitung im Hilfekontext, insbesondere um Diskriminierung und Mobbing entgegenzuwirken, denen LGBTQ*-Jugendliche häufiger ausgesetzt sind.
Warum sind trans* Jugendliche besonders gefährdet?
Studien zeigen, dass LGBTQ*-Jugendliche ein deutlich höheres Risiko für Mobbing und Suizidalität haben (z.B. 20,7% Mobbingrate im Vergleich zu 4,4% bei nicht-LGBTQ*-Jugendlichen).
- Citar trabajo
- Finn Biemüller (Autor), 2021, Trans* Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305452