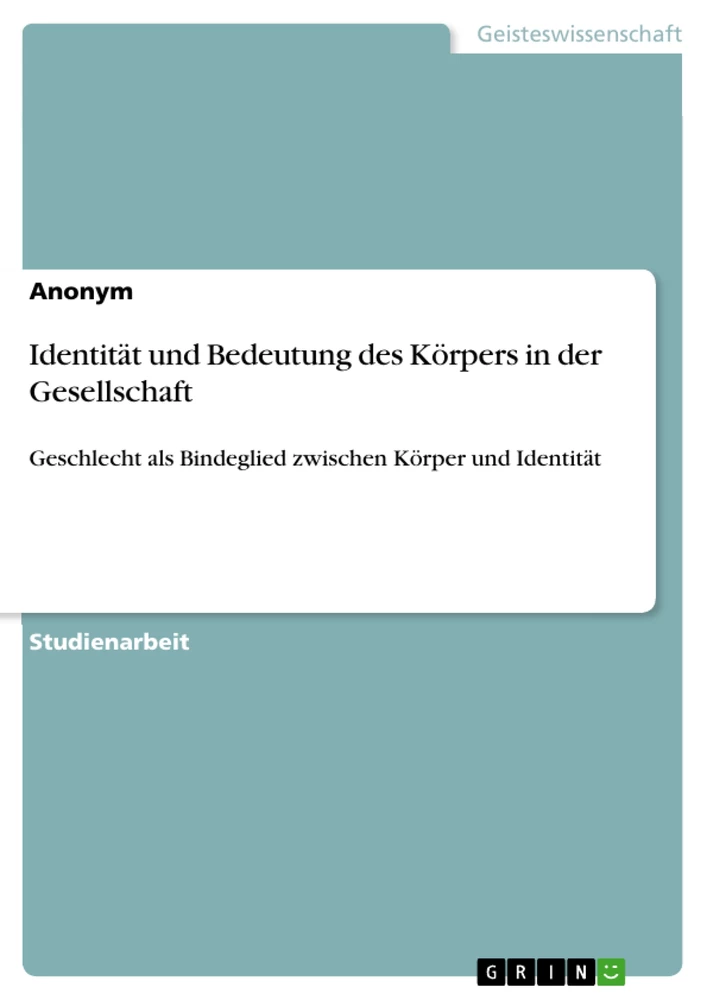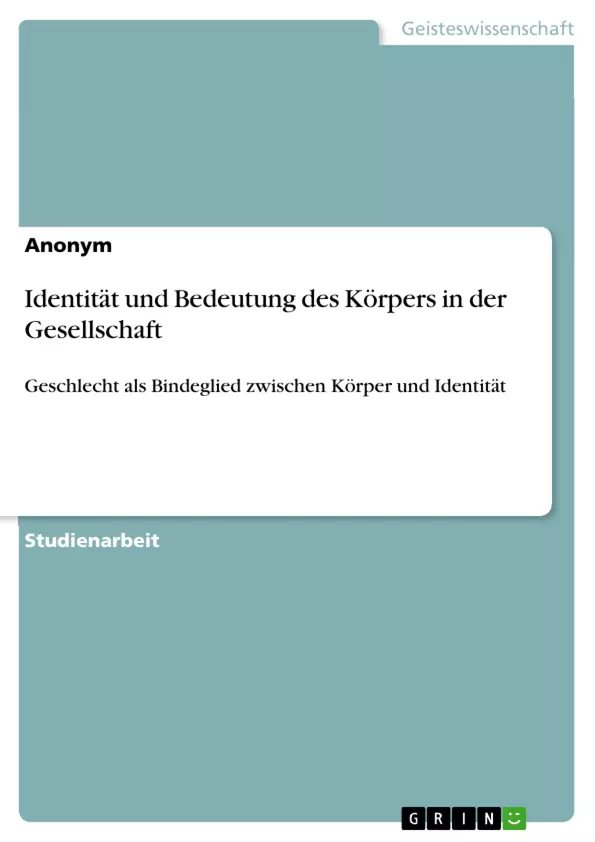Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern Körper, hinsichtlich seiner geschlechtlichen Dimension, eine Rolle für die Identität eines Individuums in der Gesellschaft spielt. So steht im Mittelpunkt der Analyse Körper und Geschlecht in Bezug auf persönliche Identität.
Bezüglich des Themas werden in dieser Arbeit drei wichtige Punkte aufgegriffen, die eine Erklärungsgrundlage für die Forschungsfrage bilden. Im ersten Teil dieser Arbeit wird die Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft beleuchtet. Bei Betrachtung des Körpers wird Leib als ein Teil des Körpers mit seinen sinnlichen Aspekten berücksichtigt. Das Geschlecht als ein wesentliches körperliches Merkmal, aber auch als ein mögliches Kriterium für die Identitätsbildung stellt die Einführung in das Hauptteil dar. Im zweiten Teil der Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob das Geschlecht ein wesentliches Kriterium für Identität sein kann und seine Rolle im sozialen Raum wird verdeutlicht. Im Fazit werden die Ergebnisse der durchgeführten Arbeit vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Körper und seine Bedeutung in der Gesellschaft
- Körper und Leib im Prozess der gesellschaftlichen Distanzierung.
- Bedeutung des Geschlechts in der Gesellschaft: die Trennung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht.
- Die Macht der Geschlechternormen.
- Identität im gesellschaftlichen Kontext
- Identität und Geschlechterdifferenzierung.
- Wechselseitigkeit von Körper, Geschlecht, Identität:
- Bedeutung des Geschlechtskörpers für Identität.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss des Körpers, insbesondere in seiner geschlechtlichen Dimension, auf die individuelle Identität in der Gesellschaft. Die Arbeit untersucht, wie der Körper im Transformationsprozess von Geschlechterrollen und -normen eine zentrale Rolle spielt und wie die Verbindung zwischen Körper, Geschlecht und Identität im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen ist.
- Die Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft und seine soziale Distanzierung.
- Die Rolle des Geschlechts als Kriterium für Identitätsbildung und seine Auswirkungen auf den sozialen Raum.
- Der Einfluss von Geschlechterrollen und -normen auf die individuelle Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Suche nach Identität.
- Die Verbindung zwischen dem Körper und der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Geschlecht und Identität.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Körper, Geschlecht und Identität ein und beleuchtet den Transformationsprozess, den diese Kategorien derzeit durchlaufen. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die wichtigsten Themenbereiche.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft. Es untersucht die Unterscheidung zwischen Körper und Leib und beleuchtet die Rolle des Körpers als soziales Kapital und Handlungsinstrument. Weiterhin wird die wachsende Bedeutung des Körpers in den Medien und die damit verbundenen Schönheitsnormen sowie der Einfluss von Körpermanipulationen auf das Selbstbild und die Identität betrachtet.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung des Geschlechts für die individuelle Identität. Es beleuchtet die Trennung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht und die Auswirkungen von Geschlechterrollen und -normen auf die Identitätsbildung.
Schlüsselwörter
Körper, Geschlecht, Identität, Gesellschaft, Geschlechterrollen, Geschlechterdifferenzierung, Körperkapital, Schönheitsnormen, Körpermanipulation, Leib, soziale Distanzierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Körper für die persönliche Identität?
Der Körper ist die materielle Basis des Individuums und dient als Ausdrucksmittel der Identität sowie als Medium der sozialen Interaktion.
Was ist der Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht?
Das biologische Geschlecht bezieht sich auf körperliche Merkmale, während das soziale Geschlecht (Gender) die gesellschaftlich konstruierten Rollen und Erwartungen beschreibt.
Wie beeinflussen Geschlechternormen das Selbstbild?
Gesellschaftliche Normen geben vor, wie ein Körper „idealerweise“ auszusehen hat, was zu Identitätskonflikten oder dem Wunsch nach Körpermanipulation führen kann.
Was versteht man unter „Körperkapital“?
Der Begriff beschreibt den Wert, den ein Körper in einer Gesellschaft hat (z.B. durch Fitness oder Schönheit), und wie dieser soziale Vorteile verschaffen kann.
Was bedeutet „gesellschaftliche Distanzierung“ in Bezug auf den Körper?
Es beschreibt den Prozess, wie der Körper in der Moderne zunehmend rationalisiert, kontrolliert und als gestaltbares Objekt wahrgenommen wird.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Identität und Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305728