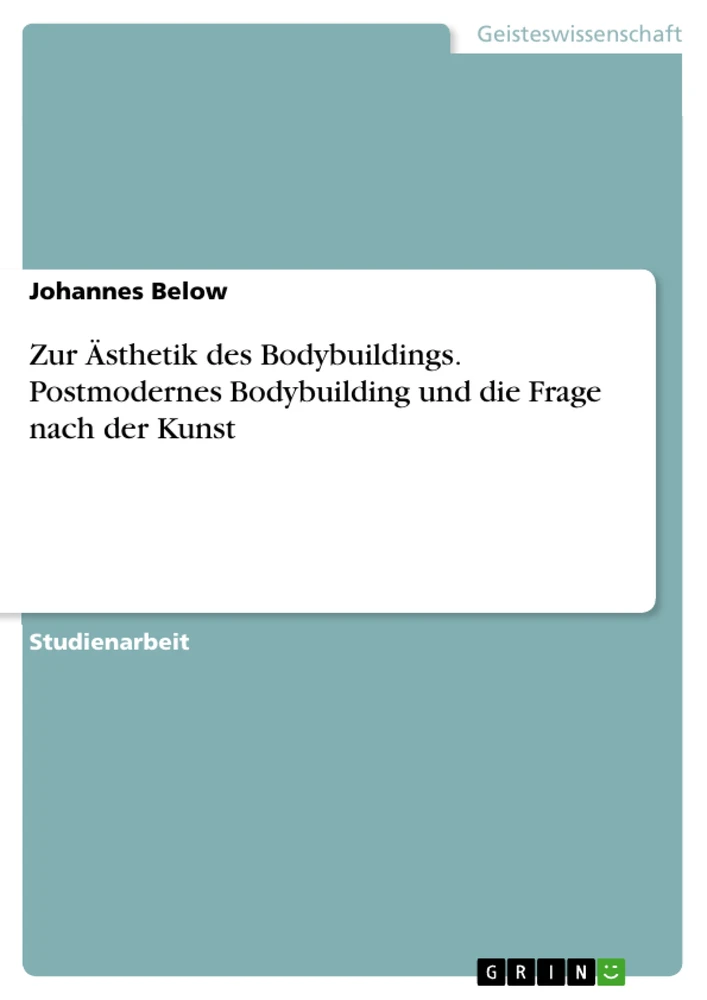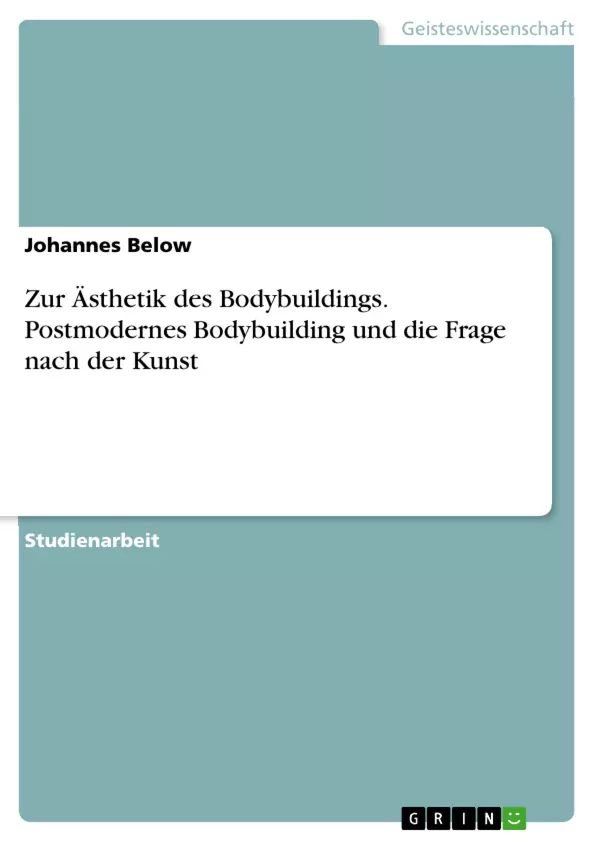Spätestens seit dem Film "Pumping Iron" ist Bodybuilding populär. Wobei: Populär? Populär ist es, sich fit zu halten. Aber Fleischberge, die nur durch Gabe der Wundermittel unserer Pharmaindustrie überhaupt möglich sind? Sieben Mal die Woche pumpen und kein Alkohol, keine Zigaretten und vielleicht noch nicht mal Sex? So schrecklich populär ist Bodybuilding gar nicht. Aber dafür umso verrückter, cooler, artifizieller. Bodybuilding ist eine Kunst, eine kompromisslose Kunst, eine Köperkunst. Und ein bisschen Freak-Show. Genau darum geht es in dieser Hausarbeit.
Angefangen mit einem kleinen historischen Abriss, analysiert der Autor das spezifische Verhältnis von Stasis und Dynamis, das sich im Bodybuilding ausformuliert. Außerdem wird die Frage gestellt, was das eigentlich mit Gender und einem besseren Leben zu tun haben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Genealogie des Bodybuildings
- 2 Sport oder Kunst?
- 3 Zur Ästhetik des Bodybuildings
- 3.1 Hypertrophisches Posing
- 3.2 Kontrastfolien
- 3.3 Ästhetik der Existenz
- 3.4 Boobiebuilders
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen Bodybuilding und untersucht seine Positionierung zwischen Kunst und Sport. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der ästhetischen Aspekte und dem vermeintlichen utopischen Potenzial von Bodybuilding in Bezug auf Genderzuweisungen.
- Historische Entwicklung des Bodybuildings
- Abgrenzung von Bodybuilding und Fitness
- Die ästhetische Dimension des Bodybuildings
- Utopisches Potenzial von Bodybuilding im Hinblick auf Genderrollen
- Bodybuilding als Ausdruck individueller Körpergestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz und das Ziel der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Ambivalenz von Bodybuilding als Abweichung von sozialen Normen und gleichzeitig als Ausdruck einer eigenen Ordnung. Der Autor stellt die Forschungsfrage nach der Definition, Abgrenzung und den Implikationen von Bodybuilding im Vergleich zu anderen Körperpraktiken.
1 Genealogie des Bodybuildings
Das Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln des Bodybuildings, angefangen von der Antike bis zur modernen Zeit. Es wird auf die Entwicklung von Krafttraining, die Bedeutung von Körperlichkeit in der Kulturgeschichte sowie die Rolle von Kraftartist:innen im Zirkus und Varieté eingegangen. Der Autor analysiert die Verbindung von Kraft und Muskeln sowie die gesellschaftliche Wahrnehmung von Bodybuilder:innen als Außenseiter und Freaks.
2 Sport oder Kunst?
Das Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Bodybuilding als sportliche oder künstlerische Tätigkeit zu verstehen ist. Die Analyse zeigt, dass es keine eindeutige Antwort gibt und Bodybuilding zwischen diesen Polen oszilliert. Die ästhetischen Aspekte des Bodybuildings werden in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben.
3 Zur Ästhetik des Bodybuildings
Dieses Kapitel analysiert verschiedene ästhetische Aspekte des Bodybuildings. Unter anderem werden hypertrophes Posing, Kontrastfolien und die Ästhetik der Existenz untersucht. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich Bodybuilding als künstlerische Praxis versteht und wie es Genderzuweisungen und gesellschaftliche Normen überträgt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Bodybuilding, Kunst, Sport, Ästhetik, Gender, Utopie, Körperkultur, Fitness, Hypertrophisches Posing, Kontrastfolien, Ästhetik der Existenz, Boobiebuilders.
Häufig gestellte Fragen
Ist Bodybuilding ein Sport oder eine Kunst?
Die Arbeit zeigt, dass Bodybuilding zwischen beiden Polen oszilliert. Es nutzt sportliche Mittel (Training), verfolgt aber ein ästhetisches Ziel (Körpergestaltung als Kunstwerk).
Was bedeutet „Hypertrophisches Posing“?
Es bezeichnet die bewusste Inszenierung der extrem vergrößerten Muskulatur durch Posen, die den Körper in eine statische, fast skulpturale Form bringen.
Welche Rolle spielt Gender im modernen Bodybuilding?
Die Arbeit untersucht das utopische Potenzial des Bodybuildings, traditionelle Genderrollen zu hinterfragen, etwa durch „Boobiebuilders“ oder die extreme Vermännlichung des weiblichen Körpers.
Wie hat sich Bodybuilding historisch entwickelt?
Die Wurzeln reichen von der antiken Athletik über Kraftartisten im Zirkus bis hin zur modernen Ästhetik, die durch Filme wie „Pumping Iron“ populär wurde.
Was ist die „Ästhetik der Existenz“ im Bodybuilding?
Es beschreibt die totale Unterwerfung des Lebensstils (Ernährung, Verzicht, Training) unter das Ziel der körperlichen Perfektion, was Bodybuilding zu einer kompromisslosen Lebenskunst macht.
- Quote paper
- Johannes Below (Author), 2022, Zur Ästhetik des Bodybuildings. Postmodernes Bodybuilding und die Frage nach der Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305827