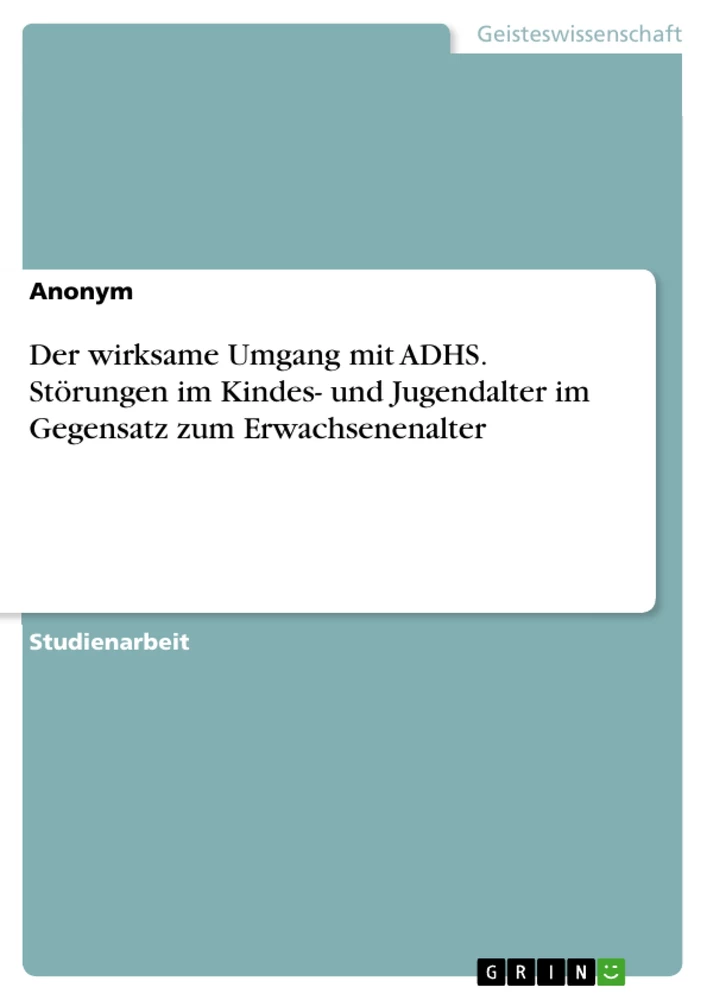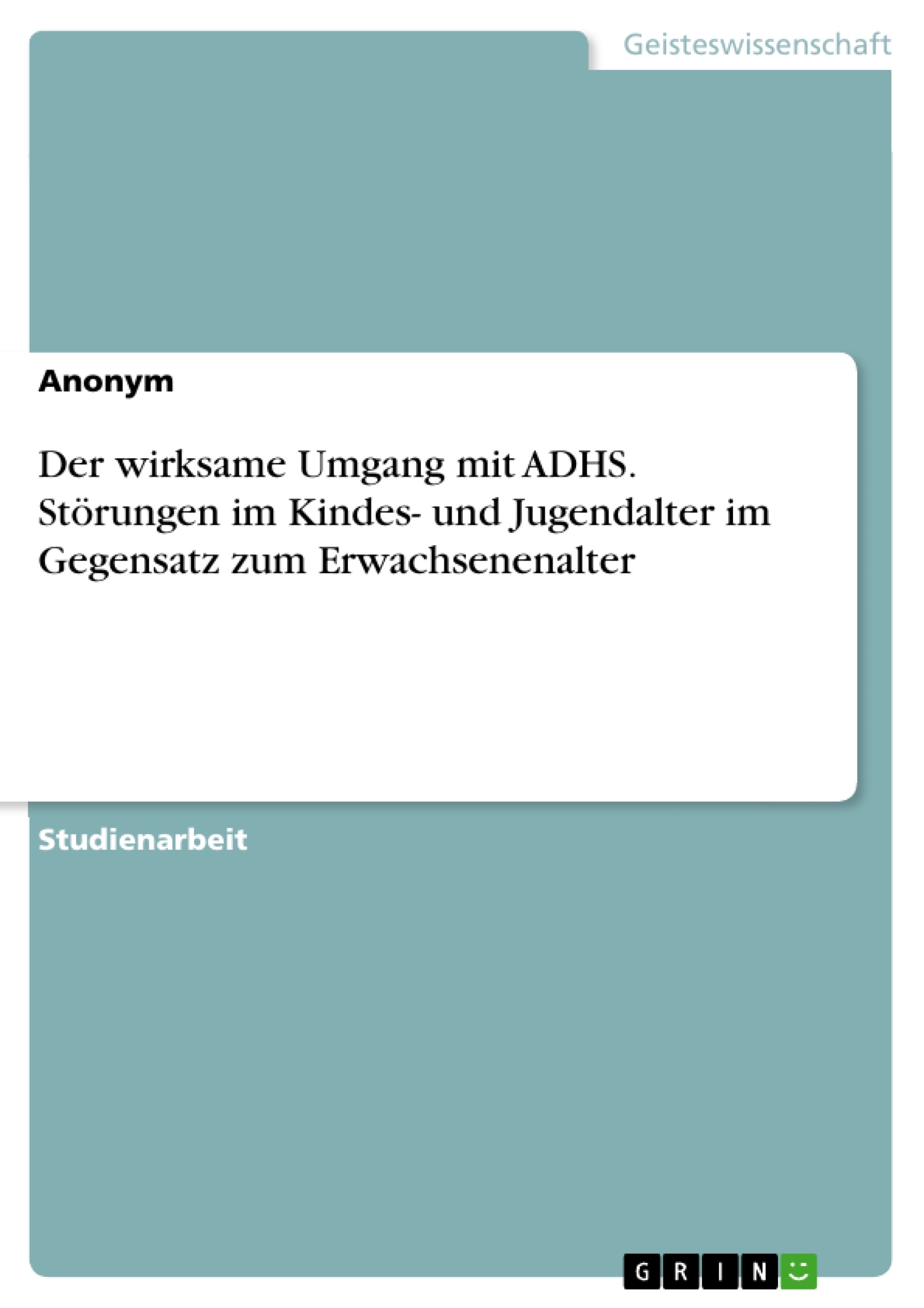Nach dem Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit folgt in dieser Arbeit ein Konzept, welches Ratschläge für ein aktuelles politisches Problemfeld, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) liefert. Zunächst werden hierfür wichtige Störungen des Kindes- und Jugendalters dargestellt, mitsamt den Ursachen und möglichen Therapien. Anschließend wird genauer auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Störungen im Erwachsenenalter eingegangen. Zum Schluss folgt das Konzept zum wirksamen Umgang mit ADHS.
In Deutschland leben circa 13,5 Millionen Kinder und Jugendliche, die noch nicht die Volljährigkeit erreicht haben. Alle jungen Menschen haben in dieser prägenden Lebensphase besondere Herausforderungen zu meistern. Um ihre Entwicklung bestmöglich bewältigen zu können, müssen jedoch einige Bedingungen vorhanden sein. „Politik für, mit und von Jugend“ bedeutet, dass gute Politik für Jugend gemacht wird, gemeinsam mit der Jugend gestalte und die Offenheit für selbstbestimmte Politik von Jugendlichen besteht. Miteinbezogen ist hier auch der Blick auf die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, also allen die gleichen Chancen und Möglichen zu eröffnen. Zu den häufigsten Störungen im Kindes- und Jugendalter gehört die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung, welche mit vielen Beeinträchtigungen der psychosozialen und kognitiven Funktionsfähigkeit einhergeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Störungen mit Beginn im Säuglings- und Kleinkindalter
- Regulationsstörungen
- Bindungsstörungen
- Tiefgreifende Entwicklungsstörung
- Enuresis und Enkopresis
- Störungen mit überwiegendem Beginn im Kindesalter
- Angststörungen
- Zwangsstörung
- Tics
- Hyperkinetische Störungen
- Störungen des Sozialverhaltens
- Umschriebene Entwicklungsstörung
- Störungen mit überwiegendem Beginn im Jugendalter
- Depression
- Essstörung
- Substanzmissbrauch
- Parallelen und Unterschied zu Störungen im Erwachsenenalter
- Konzept: Wirksamer Umgang mit ADHS
- Die Problemsituation
- Möglichkeiten im Umgang mit dem Störungsbild
- Konkrete Umsetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument legt ein Konzept zum Umgang mit ADHS vor, welches auf aktuelle politische Problemfelder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eingeht. Die Zielsetzung besteht darin, die Problematik der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für einen wirksamen Umgang zu geben.
- Wichtige Störungen des Kindes- und Jugendalters
- Ursachen und mögliche Therapien von Störungen im Kindes- und Jugendalter
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Störungen im Erwachsenenalter
- Konzept zum wirksamen Umgang mit ADHS
- Aktuelle politische Problemfelder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Zielsetzung des Dokuments dar. Im zweiten Kapitel werden Störungen mit Beginn im Säuglings- und Kleinkindalter behandelt, wobei Regulationsstörungen, Bindungsstörungen, tiefgreifende Entwicklungsstörungen und Enuresis/Enkopresis im Fokus stehen.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf Störungen mit überwiegendem Beginn im Kindesalter, darunter Angststörungen, Zwangsstörungen, Tics, hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens und umschriebene Entwicklungsstörungen. Die Parallelen und Unterschiede zu Störungen im Erwachsenenalter werden im vierten Kapitel beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich einem Konzept zum wirksamen Umgang mit ADHS, wobei die Problemsituation, Möglichkeiten im Umgang mit dem Störungsbild und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Kinder- und Jugendalter, Regulationsstörungen, Bindungsstörungen, Tiefgreifende Entwicklungsstörung, Angststörungen, Zwangsstörungen, Tics, Hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens, umschriebene Entwicklungsstörung, Depression, Essstörungen, Substanzmissbrauch, Konzept, Intervention, Therapie, politische Problemfelder, Kinder- und Jugendhilfe.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Störungen im Kindes- und Jugendalter?
Zu den häufigsten Störungen gehört die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die oft mit psychosozialen Beeinträchtigungen einhergeht.
Welche Störungen treten typischerweise im Säuglings- und Kleinkindalter auf?
In dieser Phase stehen Regulationsstörungen, Bindungsstörungen sowie tiefgreifende Entwicklungsstörungen im Vordergrund.
Gibt es Unterschiede zwischen ADHS bei Kindern und Erwachsenen?
Ja, die Arbeit beleuchtet spezifische Parallelen und Unterschiede in der Symptomatik und im Umgang mit der Störung je nach Lebensphase.
Welche politischen Aspekte werden in Bezug auf ADHS thematisiert?
Es geht um die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Förderung von Teilhabechancen für betroffene Kinder und Jugendliche.
Welche Störungen beginnen meist erst im Jugendalter?
Dazu zählen insbesondere Depressionen, Essstörungen und Substanzmissbrauch.
Was ist das Ziel des vorgestellten Konzepts?
Das Konzept liefert konkrete Ratschläge und Handlungsempfehlungen für einen wirksamen Umgang mit ADHS in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe.
- Quote paper
- Anonym (Author), Der wirksame Umgang mit ADHS. Störungen im Kindes- und Jugendalter im Gegensatz zum Erwachsenenalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306107