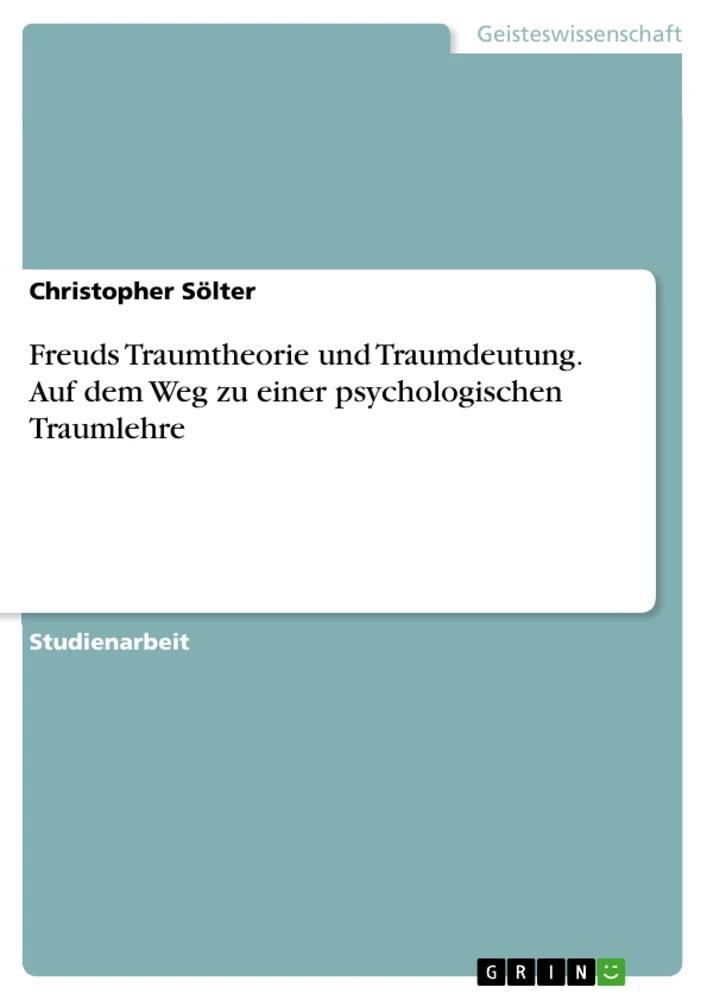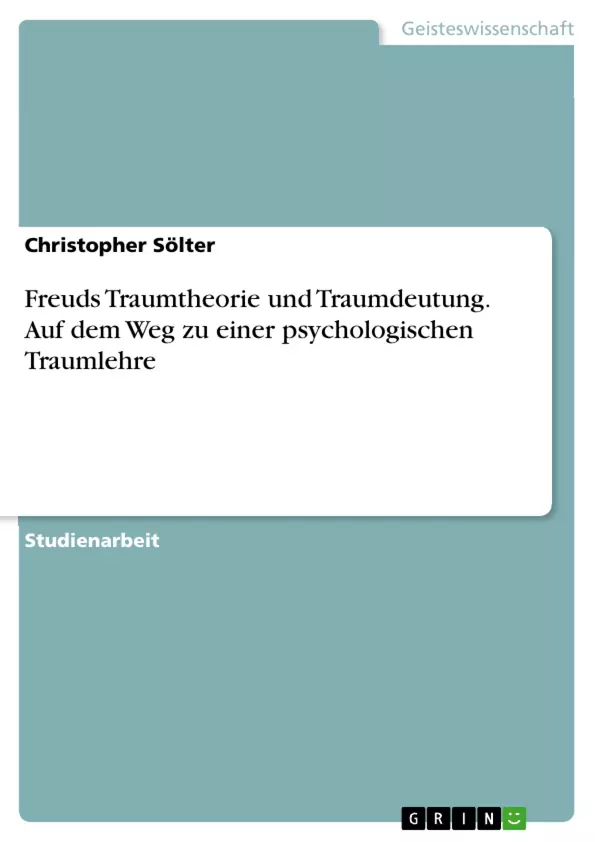Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem hochspannenden Thema „Traum“ aus psychoanalytischer Sicht.
In der Einleitung wird kurz auf die Geschichte von Traumtheorien beziehungsweise Traumdeutungen bis Ende des 19. Jahrhunderts eingegangen und anschließend erläutert, dass Freud das Verdienst zukommt den Traum als subjektives Phänomen und die psychologische Traumdeutung auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt zu haben.
Im 1. Kapitel geht es um die historische Einordnung von Freuds Opus Magnum „Die Traumdeutung“ (1900). Es ist ein epochales Werk für die Psychoanalyse, da die Ergebnisse auf normalpsychologische Vorgänge übertragen werden können und die Psychoanalyse den Schritt von einer therapeutischen Hilfswissenschaft zur Tiefenpsychologie vollzieht. Anschließend wird auf autobiographische Aspekte des Werks sowie Revisionen eingegangen und Freuds Publikationen zum Thema Traum aufgelistet. Ausführlich wird Freuds mutiger Übergang von der Neurologie zur psychologischen Traumtheorie beschrieben: Träume werden Ende des 19. Jahrhunderts von der wissenschaftlichen Welt als sinnloser körperlicher Prozess ohne jeden Wert verstanden.
Im 2. Kapitel wird in das erste (unbewusst, vorbewusst, bewusst) und zweite (Es, Ich, Über-Ich) topographische Modell eingeführt und der Bezug zur Traumtheorie deutlich gemacht. Der Traum bildet den Konfliktzustand dreier Schichten bzw. Instanzen ab. Dieses dynamische Kräfteverhältnis psychischer Prozesse lässt sich am Traum besonders gut erkennen, weshalb für Freud die Traumdeutung der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten darstellt.
Im 3. Kapitel geht es um Traumentstehung, die eng an die Traumfunktion geknüpft ist: Durch die gelockerte Abwehr (Traumzensor) wird Triebansprüchen eine kompromisshafte Wunscherfüllung erlaubt und dem Traum kommt eine Ventilfunktion zu, da er unbewusste Triebregungen abführt. Diese Abfuhr dient dem Zweck des Weiterschlafens, weshalb der Traum als Hüter des Schlafes gilt. Der Traumzensor schützt das Bewusstsein vor Überflutung.
Im 4. Kapitel wird die Traumdeutung als Dechiffrierung beschrieben: Freies Assoziieren soll den manifesten Trauminhalt zurück in latente Traumgedanken formen. Es wird Freuds Herabsetzung des manifesten Trauminhalts aufgezeigt und auf die Verwechslung von Symbolen und Zeichen aufmerksam gemacht. Abschließend wird auf die kontemporäre psychoanalytische Traumdeutung eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung der Traumdeutung
- Revisionen der Traumdeutung
- Einführung in den Inhalt der Traumdeutung
- Freuds Übergang von der Neurologie zur psychologischen Traumtheorie
- Landkarten der Psyche als Modelle der Traumtheorie
- Das erste topographische Modell: unbewusst, vorbewusst und bewusst
- Der Abwehrmechanismus der Verdrängung
- Traumdeutung als Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten
- Das zweite topographische Modell: Ich, Es, Über-Ich
- Das erste topographische Modell: unbewusst, vorbewusst und bewusst
- Traumentstehung und Traumfunktion
- Traumquellen
- Traumzensur und Traumarbeit: Umwandlung latenter Traumgedanken in manifesten Trauminhalt
- Mittel der Traumarbeit: Verdichtung und Verschiebung
- Der Traum als (Versuch einer) Wunscherfüllung
- Der Traum als Hüter des Schlafes
- Traumdeutung: Umwandlung des manifesten Trauminhalts in latente Traumgedanken
- Kritische Auseinandersetzung mit der Freudschen Symbolauffassung
- Annäherung an die kontemporäre psychoanalytische Traumdeutung
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Sigmund Freuds Traumtheorie und -deutung und untersucht die Entwicklung der Traumdeutung von ihren historischen Wurzeln bis hin zur modernen psychoanalytischen Traumdeutung.
- Die historische Entwicklung der Traumdeutung
- Die zentralen Konzepte von Freuds Traumtheorie, wie das Unbewusste, die Traumarbeit und die Traumfunktion
- Die Anwendung der Traumdeutung in der Psychoanalyse
- Die Relevanz von Träumen für das Verständnis der menschlichen Psyche
- Kritische Auseinandersetzung mit Freuds Traumtheorie und ihre Weiterentwicklung in der modernen psychoanalytischen Traumdeutung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Traumdeutung ein und beleuchtet die Bedeutung von Träumen für die Psychoanalyse. Sie stellt Sigmund Freud als Begründer der Psychoanalyse vor und zeigt die historische Entwicklung der Traumdeutung auf, die weit in die Antike zurückreicht.
Das erste Kapitel behandelt die historische Einordnung der Traumdeutung. Es beleuchtet die Revisionen der Traumdeutung durch verschiedene Psychoanalytiker sowie Freuds Übergang von der Neurologie zur psychologischen Traumtheorie.
Das zweite Kapitel widmet sich den Landkarten der Psyche als Modelle der Traumtheorie. Es stellt Freuds topographisches Modell vor, welches das Unbewusste, das Vorbewusste und das Bewusste unterscheidet. Es wird erklärt, wie die Verdrängung als Abwehrmechanismus im Traum zum Ausdruck kommt und wie die Traumdeutung als Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten dient.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Traumentstehung und Traumfunktion. Es beleuchtet die verschiedenen Traumquellen, die Traumzensur und die Traumarbeit, die den latenten Traumgedanken in den manifesten Trauminhalt umwandeln. Das Kapitel zeigt auf, wie die Verdichtung und Verschiebung als Mittel der Traumarbeit eingesetzt werden, um die Traumgedanken zu verschleiern. Des Weiteren wird der Traum als (Versuch einer) Wunscherfüllung sowie als Hüter des Schlafes interpretiert.
Schlüsselwörter
Psychoanalyse, Traumdeutung, Sigmund Freud, Unbewusstes, Verdrängung, Traumarbeit, Traumfunktion, Wunscherfüllung, Traumsymbolik, Moderne psychoanalytische Traumdeutung, Traumforschung
Häufig gestellte Fragen
Warum nannte Freud die Traumdeutung den "Königsweg zum Unbewussten"?
Weil Träume das dynamische Kräfteverhältnis psychischer Prozesse und verdrängte Wünsche im Unbewussten besonders klar widerspiegeln.
Was ist der Unterschied zwischen manifestem und latentem Trauminhalt?
Der manifeste Inhalt ist das, woran man sich erinnert; der latente Inhalt sind die verborgenen Gedanken und Wünsche, die durch die Traumarbeit verschlüsselt wurden.
Wie funktionieren Verdichtung und Verschiebung?
Dies sind Mittel der Traumarbeit: Verdichtung fasst mehrere Elemente zusammen; Verschiebung verlagert die emotionale Bedeutung von wichtigen auf unwichtige Details.
Warum gilt der Traum als "Hüter des Schlafes"?
Der Traum erlaubt eine kompromisshafte Wunscherfüllung, die unbewusste Triebregungen abführt, sodass der Schläfer nicht durch diese Spannungen aufwacht.
Was ist die Aufgabe der Traumzensur?
Die Traumzensur schützt das Bewusstsein davor, von unerträglichen oder verbotenen Triebwünschen überflutet zu werden, indem sie diese entstellt.
- Quote paper
- Christopher Sölter (Author), 2021, Freuds Traumtheorie und Traumdeutung. Auf dem Weg zu einer psychologischen Traumlehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306343