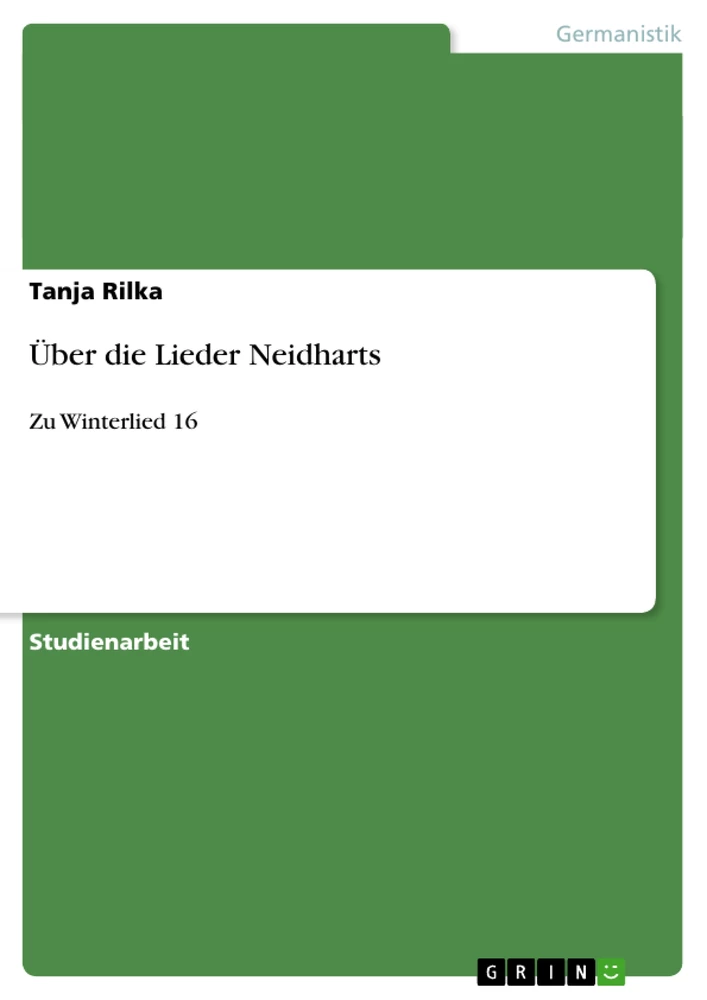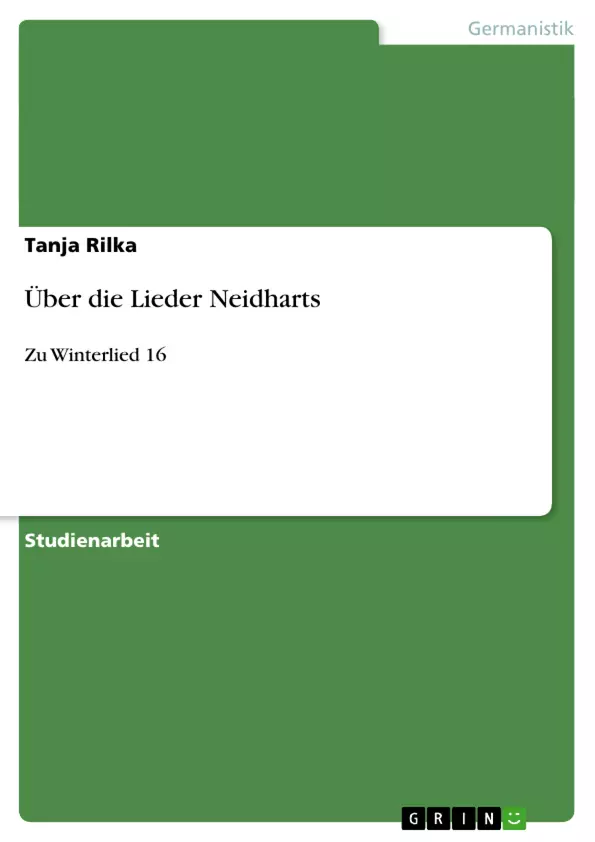Über das Leben von Neidhart ist nur wenig wie z.B. dass er am Hofe von Herzog Friedrich II. in Wien Hofsänger war, bekannt. Jedoch musste Herr Nîthart schon zu seiner Zeit ein berühmter Liederdichter gewesen sein, denn Wolfram von Eschenbach erwähnte ihn bereits in seinem um 1215 entstandenen Willehalm. Seine literarische Schaffensperiode fällt in die Jahren von 1210 bis 1245. Der Name des Sängers, Nîthart, bzw. im neuhochdeutschen Neidhart, ist in vielen Handschriften seiner Lieder und bei vielen anderen Autoren zu finden. Als zweiten Name ist in den Handschriften häufig von Riuwental, bzw. neuhochdeutsch Reuental die Rede. Er ist ein zentraler Ortsname in Neidharts Werk. Dieser fungiert in einigen Liedern aber auch als Beiname einer der Figuren von der im Lied gesprochen wird. In der Deutung des Wortes Riuwental gibt es zwei gegensätzliche Ansätze. Dies ist zum einen der biographische Ansatz, in dem man in Riuwental einen Burgsitz im bairischen, der Heimat Neidharts, sieht, zum anderen gibt es einen metaphorischen Ansatz zur Deutung des Wortes. Hier wird Riuwental zum eine fiktiven Schauplatz im Sinne von „Jammertal“.
Rund 140 Lieder Neidharts sind erhalten. Diese werden in zwei Liedtypen anhand ihres Natureingangs in Sommer- und Winterlieder unterteilt. In den Sommerliedern versuchen zumeist die Bauernmädchen und -frauen den Ritter zum Tanz im Freien zu gewinnen. Oft sind es Streitgespräche zwischen Mutter und Tochter, wem die Gunst des Ritters gehören soll. In jedem Fall wirbt die Frau um den hoch über ihr stehenden Mann. In den Winterliedern steht der Tanz in der Bauernstube im Mittelpunkt. In so genannten Trutzstrophen beschimpfen die dörper den ritter. In den späten Winterliedern, wie zum Beispiel im Winterlied 16, mischt sich Trauer über das Ende der höfischen Welt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- TEXTZEUGEN DES WINTERLIEDS 16
- ÜBERSETZUNG DES WINTERLIEDS 16
- TEXTANALYSE DES WINTERLIEDS 16
- NATUREINGANG
- MINNEDIENST
- DÖRPER
- FRIDRÛNS SPIEGEL
- RESÜMEE
- BIBLIOGRAPHIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Winterlied 16 des mittelalterlichen Minnesängers Neidhart. Ziel ist es, den Text in seiner historischen und literarischen Bedeutung zu analysieren und zu interpretieren. Dabei werden die verschiedenen Textzeugen des Liedes untersucht, die Übersetzung des Textes in die heutige Sprache erörtert und die einzelnen Strophen des Liedes im Kontext der Neidhart-Forschung analysiert.
- Die Bedeutung des Winterlieds 16 im Kontext der Neidhart-Forschung
- Die Analyse der verschiedenen Textzeugen des Liedes
- Die Übersetzung des Liedes in die heutige Sprache
- Die Interpretation der einzelnen Strophen des Liedes
- Die Rolle des Minnesangs in der mittelalterlichen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über das Leben und Werk Neidharts und stellt den Kontext des Winterlieds 16 dar. Das Kapitel "Textzeugen des Winterlieds 16" analysiert die verschiedenen Handschriften, in denen das Lied überliefert ist, und beleuchtet die Besonderheiten der einzelnen Textzeugen. Im Kapitel "Übersetzung des Winterlieds 16" wird eine Übersetzung des Liedes in die heutige Sprache präsentiert, die die sprachlichen Besonderheiten des Mittelhochdeutschen berücksichtigt. Das Kapitel "Textanalyse des Winterlieds 16" analysiert die einzelnen Strophen des Liedes im Detail und beleuchtet die Bedeutung der einzelnen Verse im Kontext der Neidhart-Forschung. Das Kapitel "Resümee" fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Bedeutung des Winterlieds 16 für die Neidhart-Forschung heraus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Winterlied 16, Neidhart, Minnesang, Textzeugen, Übersetzung, Textanalyse, Strophenanalyse, mittelalterliche Literatur, höfische Gesellschaft, bäuerliche Gesellschaft, Minnedienst, Fridrûn, Dörper, Natureingang.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Neidhart?
Neidhart war einer der berühmtesten deutschen Liederdichter des Mittelalters (ca. 1210–1245), bekannt für seine Sommer- und Winterlieder.
Was unterscheidet Sommerlieder von Winterliedern?
Sommerlieder handeln vom Tanz im Freien und dem Werben der Frauen um den Ritter. Winterlieder thematisieren den Tanz in der Bauernstube und oft den Konflikt (Trutz) zwischen Ritter und Bauern (Dörper).
Was bedeutet der Name "Reuental" (Riuwental)?
Es gibt zwei Deutungen: einen realen Burgsitz in Bayern oder einen metaphorischen Schauplatz im Sinne eines "Jammertals".
Wer sind die "Dörper" in Neidharts Werk?
Dörper sind bäuerliche Figuren, die sich oft tölpelhaft oder anmaßend verhalten und in den Liedern mit dem ritterlichen Sänger in Konflikt geraten.
Was ist das Besondere an Neidharts Winterlied 16?
Es mischt den typischen Natureingang mit Elementen des Minnedienstes und spiegelt eine gewisse Trauer über den Verfall der höfischen Welt wider.
- Quote paper
- Tanja Rilka (Author), 2004, Über die Lieder Neidharts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130644