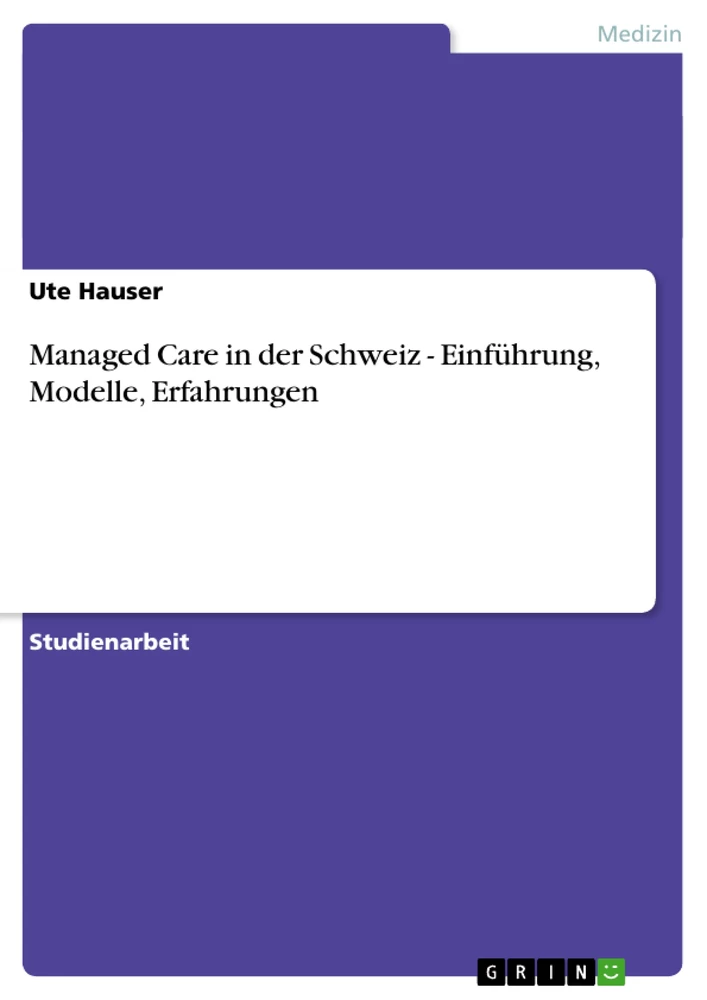Die Schweiz hat im Gesundheitswesen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die Bundesrepublik. Schon seit Mitte der 60er Jahre ist auch dort das Schlagwort der "Kostenexplosion" ein politischer Dauerbrenner. Der Druck, Kosten zu sparen, ist laut MEURER (1999, 200) noch höher als in Deutschland: im Jahr 1995 hatte die Schweiz mit 2.412$ pro Kopf nach den USA (3.701$) die höchsten Gesundheitskosten der Welt, vor Luxemburg und Deutschland (GÜNTERT 1997). Sie verfügt im europäischen Vergleich über die längste durchschnittliche Krankenhaus-Verweildauer und die höchsten Fallkosten, bietet andererseits aber auch die höchste Lebenserwartung für Männer und Frauen (ASCHE in MEURER 1999).
In den bereits aus den USA bekannten Managed-Care-Modellen sah man schon Anfang der 80er Jahre eine Lösung, die sowohl Kostensenkungen, als auch Qualitätsbeibehaltung bzw. -verbesserungen versprach. So führte die Schweiz 1996 mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz (KVG) die ersten Health Maintenance Organizations (HMOs) in Europa ein, ein nicht immer ganz einfaches, aber doch erfolgreiches Unternehmen: die Schweiz hat anhand dieser Modelle Einsparungen von 17 bis 35 Prozent gegenüber Vergleichskollektiven erreicht (MEURER 1999). Wie aber wurde Managed Care in der Schweiz eingeführt? Und welche Modelle brachten die erhofften Erfolge? Antworten darauf sollen in diesem Referat gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zielsetzung und Fragestellung der Hausarbeit
- 3. Vorgehensweise und Quellen
- 4. Definitionen
- 4.1. Managed Care
- 4.2. Managed-Care-Organizations (MCO)
- 5. Das Gesundheitssystem der Schweiz
- 5.1. Grundzüge: zwischen privater und öffentlicher Verantwortung
- 5.2. Ausgangslage für die Einführung von Managed Care
- 6. Die Einführung von Managed Care
- 6.1. Stimmungswandel und erste Versuche
- 6.2. Rechtliche Rahmenbedingungen
- 6.3. Einführung von HMO und Hausarztmodellen
- 7. Entwicklungsstand
- 7.1. Health Maintenance Organizations (HMOs)
- 7.1.1. Zentrale Elemente
- 7.1.2. Größe und Versichertenstruktur
- 7.2. Hausarztmodelle
- 7.2.1. Zentrale Elemente
- 7.2.2. Größe und Versichertenstruktur
- 7.1. Health Maintenance Organizations (HMOs)
- 8. Evaluation und Erfahrungen
- 8.1. Kosten der HMOs und Hausarztnetze
- 8.2. Qualität und Patientenzufriedenheit
- 9. Fazit
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Einführung und Entwicklung von Managed-Care-Modellen in der Schweiz. Sie beleuchtet die Hintergründe, die zu deren Einführung führten, analysiert die wichtigsten Modelle (HMOs und Hausarztmodelle) und evaluiert die erzielten Erfahrungen hinsichtlich Kosten und Qualität.
- Kostensenkung im Schweizer Gesundheitswesen
- Einführung von Managed-Care-Modellen (HMOs und Hausarztmodelle)
- Rechtliche Rahmenbedingungen und deren Einfluss
- Bewertung der Effektivität von Managed Care in der Schweiz
- Vergleich der Modelle HMO und Hausarztmodell
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die hohen Gesundheitskosten in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern und die damit verbundene Notwendigkeit von Kostensenkungsmaßnahmen. Sie führt das Konzept von Managed Care als Lösungsansatz ein und kündigt die Ziele der Arbeit an, nämlich die Einführung, die Modelle und die Erfahrungen mit Managed Care in der Schweiz zu beleuchten. Die hohen Kosten und die lange Verweildauer in Schweizer Krankenhäusern werden als zentrale Probleme identifiziert, die durch die Einführung von Managed Care angegangen werden sollen. Die Schweiz wird als europäisches Land hervorgehoben, das bereits Erfolge mit diesem Modell erzielt hat, mit Einsparungen von 17 bis 35 Prozent.
2. Zielsetzung und Fragestellung der Hausarbeit: Dieses Kapitel definiert die Ziele der Hausarbeit. Es wird der Fokus auf die Struktur des schweizerischen Gesundheitswesens gelegt, die chronologische Einführung von Managed Care unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen erläutert und die beiden Hauptmodelle HMO und Hausarztsystem detailliert vorgestellt, inklusive der Erfahrungen damit. Die strukturierte Vorgehensweise und die klare Zielsetzung werden hier definiert, um den Rahmen der Arbeit zu legen.
3. Vorgehensweise und Quellen: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Quellen und die Methodik der Arbeit. Das Buch „So funktioniert Managed Care“ von Jürg Baumberger wird als zentrale Quelle genannt, ergänzt durch Forschungsberichte des Bundesamts für Sozialversicherung und Fachzeitschriften. Die Autorität der Quellen wird hervorgehoben, insbesondere die langjährige Erfahrung des Autors Baumberger mit der Einführung von Managed Care in der Schweiz.
4. Definitionen: Hier werden die Schlüsselbegriffe "Managed Care" und "Managed-Care-Organizations (MCOs)" definiert. "Managed Care" wird als Sammelbegriff für verschiedene Organisations- und Finanzierungsmodelle beschrieben, die alle das Ziel haben, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Qualität zu verbessern. Die Definition betont die verschiedenen Strategien, wie z.B. die Bündelung von Finanzierung und Leistungserbringung und die Kontrolle des Behandlungsablaufs. MCOs werden im Kontext von HMOs erläutert, wobei der Fokus auf der Eigenleistungserbringung oder der Zusammenarbeit mit vertraglich gebundenen Leistungserbringern liegt.
5. Das Gesundheitssystem der Schweiz: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Schweizer Gesundheitssystem, beleuchtet die Mischung aus privater und öffentlicher Verantwortung und analysiert die Ausgangssituation für die Einführung von Managed Care. Es bildet den Kontext für das Verständnis der Herausforderungen und Chancen, die mit der Implementierung von Managed-Care-Modellen verbunden waren. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der bestehenden Struktur und ihrer Relevanz für die Einführung von Managed Care.
6. Die Einführung von Managed Care: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Einführung von Managed Care in der Schweiz. Es behandelt den Stimmungswandel, die ersten Versuche, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Einführung von HMO und Hausarztmodellen. Es schildert die Entwicklungsschritte und die Herausforderungen, die mit der Umsetzung dieser neuen Modelle verbunden waren, und integriert die verschiedenen Unterkapitel zu einem kohärenten Bild der Einführungsphase.
7. Entwicklungsstand: Dieses Kapitel präsentiert den Entwicklungsstand von HMOs und Hausarztmodellen in der Schweiz, wobei die zentralen Elemente, Größe und Versichertenstruktur beider Modelle detailliert beschrieben werden. Es bietet einen Vergleich und eine Analyse der beiden Modelle, die ihre jeweiligen Stärken und Schwächen aufzeigen und somit einen Einblick in ihre Effektivität geben. Der Abschnitt bietet einen differenzierten Einblick in die verschiedenen Aspekte der beiden Modelle.
Schlüsselwörter
Managed Care, Schweiz, Gesundheitswesen, Kostensenkung, HMOs, Hausarztmodelle, Krankenversicherung, Qualität, Effizienz, Rechtliche Rahmenbedingungen, Kostenexplosion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Einführung und Entwicklung von Managed-Care-Modellen in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Einführung und Entwicklung von Managed-Care-Modellen in der Schweiz. Sie analysiert die Hintergründe, die zu deren Einführung führten, beschreibt die wichtigsten Modelle (HMOs und Hausarztmodelle) und evaluiert die erzielten Erfahrungen hinsichtlich Kosten und Qualität.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Kostensenkung im Schweizer Gesundheitswesen, die Einführung von Managed-Care-Modellen (HMOs und Hausarztmodelle), die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Einfluss, die Bewertung der Effektivität von Managed Care in der Schweiz und einen Vergleich der Modelle HMO und Hausarztmodell.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zielsetzung und Fragestellung, Vorgehensweise und Quellen, Definitionen (Managed Care und MCOs), Das Schweizer Gesundheitssystem, Die Einführung von Managed Care, Entwicklungsstand (HMOs und Hausarztmodelle), Evaluation und Erfahrungen, Fazit und Literaturverzeichnis.
Wie ist die Vorgehensweise der Hausarbeit?
Die Arbeit basiert auf verschiedenen Quellen, darunter das Buch „So funktioniert Managed Care“ von Jürg Baumberger, Forschungsberichte des Bundesamts für Sozialversicherung und Fachzeitschriften. Die Methodik wird im Kapitel "Vorgehensweise und Quellen" detailliert beschrieben.
Was sind HMOs und Hausarztmodelle?
Die Hausarbeit definiert "Managed Care" als Sammelbegriff für verschiedene Organisations- und Finanzierungsmodelle zur Kostensenkung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen. HMOs und Hausarztmodelle werden als konkrete Managed-Care-Modelle detailliert vorgestellt, inklusive ihrer zentralen Elemente, Größe und Versichertenstruktur.
Wie ist der Entwicklungsstand von HMOs und Hausarztmodellen in der Schweiz?
Das Kapitel "Entwicklungsstand" analysiert die Entwicklung von HMOs und Hausarztmodellen in der Schweiz und vergleicht die beiden Modelle hinsichtlich ihrer Effektivität, Stärken und Schwächen.
Welche Ergebnisse werden in Bezug auf Kosten und Qualität präsentiert?
Die Hausarbeit evaluiert die Erfahrungen mit Managed Care in der Schweiz hinsichtlich Kosten (Kosten der HMOs und Hausarztnetze) und Qualität (Qualität und Patientenzufriedenheit). Die Ergebnisse werden im Kapitel "Evaluation und Erfahrungen" präsentiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen zur Effektivität von Managed-Care-Modellen in der Schweiz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Managed Care, Schweiz, Gesundheitswesen, Kostensenkung, HMOs, Hausarztmodelle, Krankenversicherung, Qualität, Effizienz, Rechtliche Rahmenbedingungen, Kostenexplosion.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit listet alle verwendeten Quellen auf.
- Arbeit zitieren
- Ute Hauser (Autor:in), 2002, Managed Care in der Schweiz - Einführung, Modelle, Erfahrungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13065