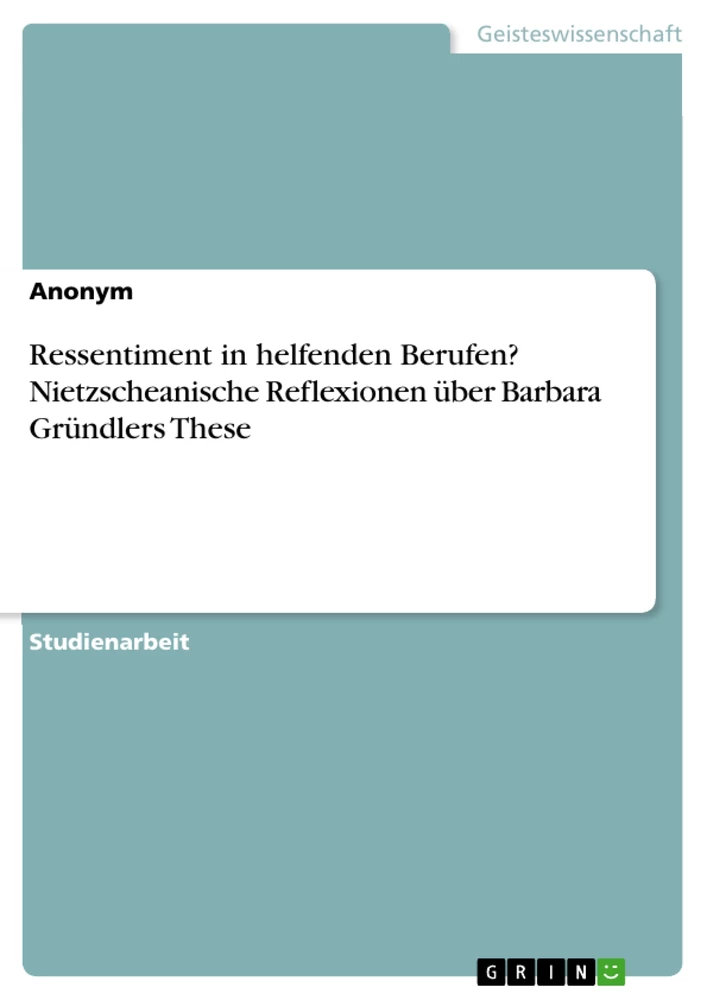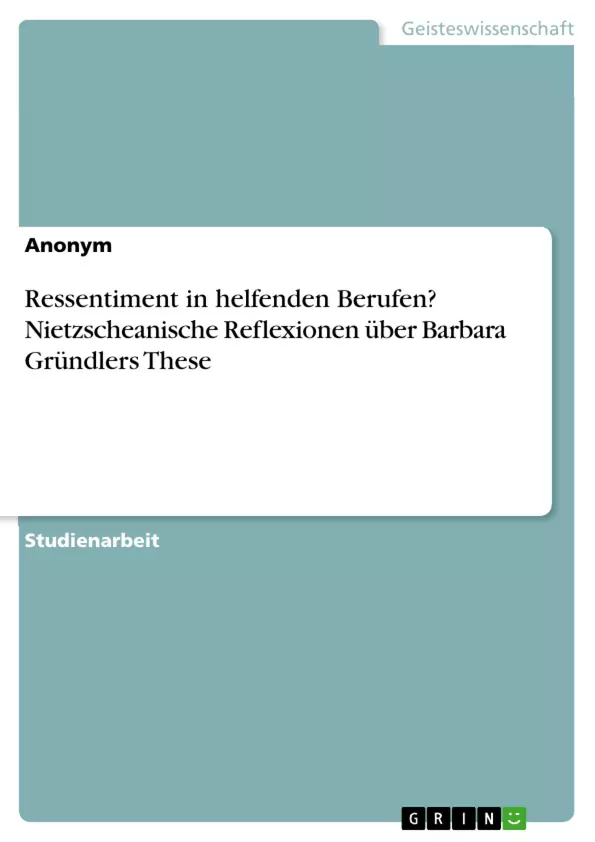Viele der Berufe, in denen Hilfe als Dienstleistung angeboten wird, genießen in Deutschland hohes Ansehen. Sie werden als gute Menschen wahrgenommen, denn sie helfen Menschen. Häufig opfern sie nicht nur ihre Zeit, indem sie am Wochenende, in der Nacht und an Feiertagen arbeiten, sondern sie opfern sich selbst für ihre Mitmenschen auf. Diese Selbstlosigkeit, die jene Leute an den Tag legen, wird als lobende Charaktereigenschaft durch gesellschaftliche Anerkennung gewürdigt. Doch was ist, wenn sich dahinter gar keine zu lobende Charaktereigenschaft verbirgt?
Die Fachberaterin für Psychotraumatologie und Praktische Philosophin Barbara Gründler traf in ihrem Berufsleben auf einige dieser Tugendhaften. Sie entdeckte in manchen Motiven der Helfenden das genaue Gegenteil: ein persönliches Laster. Anhand Nietzsches Analysen der Moral und der Psychologie des Christentums gelang es ihr, die Krankheit einiger Helfenden, das Ressentiment, aus dem seelischen Sumpf ihrer Träger:innen emporzuheben.
In manchen Helfer:innen fand sie den von Nietzsche beschriebenen „asketischen Priester“ wieder. Er ist ein Mischwesen aus Ressentiment und „Willen zur Macht“. Gründlers These ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die Fragestellung, die zugrunde liegt, ist: Welche Merkmale des nietzscheanischen „asketischen Priesters“ weisen die Helfenden des Helfer:innensystems auf?
Da sich Barbara Gründler auf Nietzsches Überlegungen beruft, werden zuerst die theoretischen Ausarbeitungen des Philosophen dargestellt. Dazu gehören seine moralischen Idealtypen, die mit der Analyse des Ressentiments einhergehen.
Im Anschluss daran wird der „asketische Priester“ beschrieben, um diese Überlegungen auf die helfenden Berufe anzuwenden. Dabei wird nicht nur auf Barbara Gründlers Ansätze hierzu eingegangen, sondern auch auf Wolfgang Schmidbauers „Helfer-Syndrom“, welches ein fruchtbarer Boden für das Gedeihen des Ressentiments bietet.
Im Helfen steckt immer ein Machtgefälle, welches von den Helfenden symmetrisch gestaltet werden sollte. Friedrich Nietzsches Überlegungen zum „Willen zur Macht“ bieten eine tiefgründige Analyse von Macht.
Inhaltsverzeichnis
- Helfen als Laster?
- Wille zur Macht
- Das Ressentiment
- Nietzscheanischen Idealtypen der Moral
- Die Logik des Ressentiments
- Der Asketische Priester
- Asketisches Helfen
- Das Helfer:innen-Syndrom
- Von der Nächstenliebe und vom Helfen: Wie aus der Not eine Tugend wird
- Der Wille zum Helfen
- Der Fehlschluss der „Leidens-Causalität“
- Das Ressentiment der helfenden Asket:innen
- Fazit - Wege zum und aus dem Ressentiment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Barbara Gründlers These, dass Ressentiment in helfenden Berufen vorhanden sein kann, und untersucht die Parallelen zu Nietzsches Beschreibung des „asketischen Priesters". Ziel ist es, die Merkmale des „asketischen Priesters“ im Kontext von helfenden Berufen zu identifizieren. Die Arbeit ergründet die psychologischen und moralischen Dimensionen des Helfens und die Rolle des „Willens zur Macht“ in diesem Kontext.
- Die Kritik an der traditionellen Vorstellung von „Helfen“ als rein selbstlosem und tugendhaftem Handeln
- Die Analyse des „Ressentiments“ als ein mögliches Motiv für die Hilfeleistung und dessen Zusammenhang mit dem „Willen zur Macht“
- Die Rolle des „asketischen Priesters“ im Kontext von helfenden Berufen und die Anwendung von Nietzsches Theorien auf den „Helfer:innen-Komplex“
- Die Untersuchung der „Leidens-Causalität“ und ihrer Auswirkungen auf das Helfer:innen-Syndrom
- Die Diskussion über die ethischen und moralischen Aspekte des Helfens und die Auswirkungen von Ressentiment auf die Hilfeleistung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Konzept des „Helfens“ und stellt Barbara Gründlers These zur möglichen Präsenz von Ressentiment in helfenden Berufen vor. Das zweite Kapitel widmet sich der Nietzscheanischen Konzeption des „Willens zur Macht“ und beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext von Machtbeziehungen. Das dritte Kapitel analysiert das Konzept des „Ressentiments“ und zeigt dessen Beziehung zu den moralischen Idealtypen Nietzsches. Das Kapitel beleuchtet die Rolle des „asketischen Priesters“ als einem Mischwesen aus Ressentiment und „Willen zur Macht“. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem „Helfer:innen-Syndrom“ und untersucht die Ursachen und Auswirkungen des „Ressentiments“ auf die Motivation von Helfenden. Es werden verschiedene Aspekte des „Willens zum Helfen“ analysiert und die potenziellen Folgen des Fehlschlusses der „Leidens-Causalität“ diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Ressentiment“, „asketischer Priester“, „Helfer:innen-Syndrom“, „Wille zur Macht“, „Moral“, „Ethik“ und „Leidens-Causalität“. Sie analysiert die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext von helfenden Berufen und untersucht die Auswirkungen von Ressentiment auf die Motivation und das Verhalten von Helfenden.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Nietzsche unter dem 'asketischen Priester'?
Der asketische Priester ist eine Figur, die Ressentiment in Tugend umwandelt. Er nutzt das Leid und die Selbstverleugnung, um Macht über andere Leidende auszuüben, indem er sich als unentbehrlicher Helfer darstellt.
Wie zeigt sich Ressentiment in helfenden Berufen?
Ressentiment kann sich zeigen, wenn Hilfe nicht aus echter Zuneigung, sondern aus einem unbewussten Überlegenheitsgefühl oder der Unterdrückung eigener Bedürfnisse erfolgt, was oft zu einer moralischen Erhöhung des Helfers führt.
Was ist das 'Helfer-Syndrom' nach Wolfgang Schmidbauer?
Es bezeichnet eine psychische Disposition, bei der Menschen versuchen, eigene Minderwertigkeitskomplexe oder Traumata dadurch zu kompensieren, dass sie sich zwanghaft für andere aufopfern und dabei ihre eigenen Grenzen missachten.
Welche Rolle spielt der 'Wille zur Macht' beim Helfen?
Nietzsche sieht im Helfen oft ein Machtgefälle. Der Helfer übt Macht aus, indem er den anderen in der Abhängigkeit belässt oder seine moralische Überlegenheit durch die Hilfeleistung festigt.
Was bedeutet der Begriff 'Leidens-Causalität'?
Dies beschreibt den psychologischen Vorgang, bei dem ein Leidender nach einem Schuldigen für sein Leid sucht. In helfenden Berufen kann dies dazu führen, dass Helfer das Leid anderer instrumentalisieren, um ihre eigene Rolle zu legitimieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Ressentiment in helfenden Berufen? Nietzscheanische Reflexionen über Barbara Gründlers These, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306546