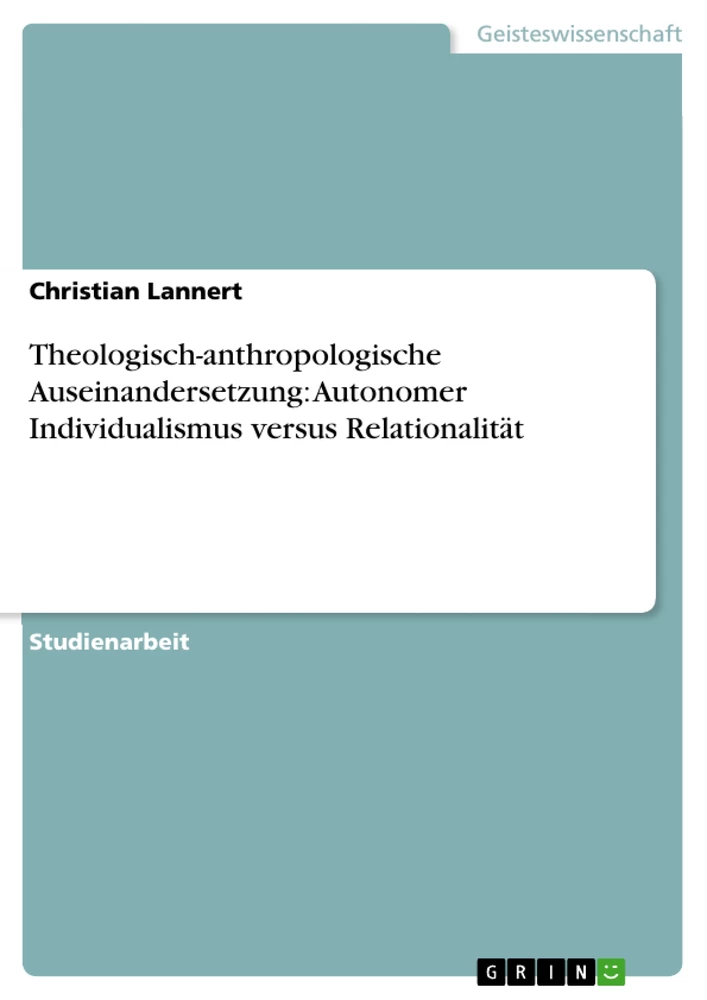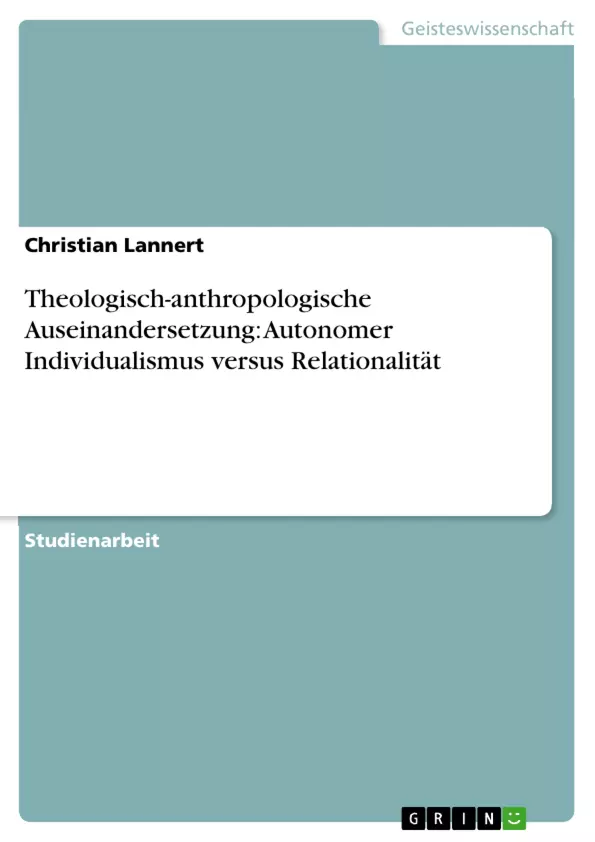Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer Gegenüberstellung des Welt- und Menschenbildes zweier ethischer Sichtweisen: Des Modell des Homo Oeconomicus auf der einen Seite, die Theologische Anthropologie auf der anderen, oder schlagwortartig formuliert: „Autonomer Individualismus versus Relationalität“.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Mensch als durch seine Beziehungen konstituiertes Wesen
- II. 1. Die Relation zwischen Individuum und Gesellschaft
- II. 2. Beziehungen als konstitutives Element des Menschseins
- II. 3. Relationale Phänomene
- III. Die Gottesrelation des Menschen
- III. 1. Die Frage nach dem Ursprung
- III. 2. Der Mensch als ein konstitutiv auf Gott ausgerichtetes Wesen
- IV. Relationalität des Menschen am Beispiel der Wirtschaft.
- IV. 1. Unternehmensethik als Ordnungselement in Ökonomischen Prozessen
- IV. 2 Unternehmensethik am Beispiel der Mitbestimmung der „Arbeiter“
- V. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen dem Modell des Homo Oeconomicus und der theologischen Anthropologie, indem sie den autonomen Individualismus dem relationalen Verständnis des Menschseins gegenüberstellt. Sie beleuchtet, wie unzureichend das Modell des nutzenmaximierenden Individuums das menschliche Handeln erklärt und wie die theologische Anthropologie den Menschen als in Beziehungen verflochtenes Wesen beschreibt.
- Das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft
- Beziehungen als konstitutives Element des Menschseins
- Die Gottesbeziehung als Ursprungsbeziehung
- Relationalität in ökonomisch-wirtschaftlichen Prozessen
- Kritik am Modell des Homo Oeconomicus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: den Gegensatz zwischen dem individualistischen Modell des Homo Oeconomicus und dem relationalen Verständnis des Menschen in der theologischen Anthropologie. Sie skizziert die unzureichende Erklärung menschlichen Handelns durch das rein ökonomische Modell und kündigt die nachfolgende Auseinandersetzung mit dem relationalen Ansatz an, der den Menschen als von Geburt an in Beziehungen eingebundenes Wesen betrachtet. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erläuterung des konstitutiven „in Beziehung sein“ des Menschen vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes zwischen Individuum und Gesellschaft.
II. Der Mensch als durch seine Beziehungen konstituiertes Wesen: Dieses Kapitel untersucht den Menschen als Beziehungswesen. Es beleuchtet die komplexe Relation zwischen Individuum und Gesellschaft, beginnend mit einem kurzen historischen Abriss, der den Wandel des Verständnisses von Individualismus aufzeigt. Es wird argumentiert, dass der Individualismus, obwohl er in der Neuzeit verstärkt in Erscheinung trat, seine Wurzeln im christlichen Verständnis der individuellen Gottesbeziehung hat. Der moderne, abstrakte Individualismus wird als Ergebnis einer Säkularisierung dieses Gedankens interpretiert, der zu einem Antagonismus zwischen Individuum und Gesellschaft führte. Im Gegensatz dazu wird die philosophische Sichtweise präsentiert, welche den Menschen als Gemeinschaftswesen darstellt, dessen individuelle Interessen mit denen der Allgemeinheit harmoniert werden müssen. Schließlich wird der ontologisch grundlegende Aspekt des Verflochtenseins des Menschen mit seiner personalen und nicht-personalen Umwelt hervorgehoben, und die Bedeutung von Beziehungen für die Konstitution des Ichs, im Sinne der „Ich-Du“-Philosophie Martin Bubers, erläutert.
III. Die Gottesrelation des Menschen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gottesbeziehung des Menschen als Ursprungsbeziehung. Es wird die Frage nach dem Ursprung des Menschen untersucht und argumentiert, dass der Mensch als ein konstitutiv auf Gott ausgerichtetes Wesen verstanden werden kann. Dieser Abschnitt vertieft das Verständnis des Menschen als relationales Wesen, indem er die grundlegende Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt stellt und deren Implikationen für das Verständnis des menschlichen Seins erörtert. Die Ausführungen betonen die Bedeutung dieser Beziehung für die gesamte menschliche Existenz und liefern theologische Argumente, um diese zentrale These zu stützen. Die detaillierte Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Ursprung zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Gottesrelation des Menschen zu zeichnen.
IV. Relationalität des Menschen am Beispiel der Wirtschaft.: Dieses Kapitel wendet die vorherigen Ausführungen auf den Bereich der Wirtschaft an. Es untersucht die Relationalität des Menschen im Kontext ökonomisch-wirtschaftlicher Prozesse und kritisiert das Modell des nutzenmaximierenden egoistischen Akteurs als nicht effizient. Es wird die Unternehmensethik als Ordnungselement in ökonomischen Prozessen betrachtet und am Beispiel der Mitbestimmung von Arbeitern veranschaulicht, wie relationale Aspekte zu einem effektiveren und gerechteren Wirtschaftssystem beitragen können. Der Fokus liegt auf der Demonstration, dass ein relationales Verständnis des Menschen auch in wirtschaftlichen Kontexten zu besseren Ergebnissen führt als ein rein individualistisches Modell.
Schlüsselwörter
Theologische Anthropologie, Autonomer Individualismus, Relationalität, Homo Oeconomicus, Individuum, Gesellschaft, Gottesbeziehung, Unternehmensethik, Mitbestimmung, Wirtschaftsethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Gegensatz zwischen dem individualistischen Modell des Homo Oeconomicus und dem relationalen Verständnis des Menschen in der theologischen Anthropologie. Sie zeigt auf, wie unzureichend das Modell des nutzenmaximierenden Individuums das menschliche Handeln erklärt und wie die theologische Anthropologie den Menschen als in Beziehungen verflochtenes Wesen beschreibt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, Beziehungen als konstitutives Element des Menschseins, die Gottesbeziehung als Ursprungsbeziehung, Relationalität in ökonomisch-wirtschaftlichen Prozessen und die Kritik am Modell des Homo Oeconomicus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Menschen als Beziehungswesen, ein Kapitel zur Gottesrelation, ein Kapitel zur Relationalität in der Wirtschaft und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Was wird im Kapitel "Der Mensch als durch seine Beziehungen konstituiertes Wesen" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die komplexe Relation zwischen Individuum und Gesellschaft, den Wandel des Individualismusverständnisses und die Bedeutung von Beziehungen für die Konstitution des Ichs. Es wird der ontologisch grundlegende Aspekt des Verflochtenseins des Menschen mit seiner personalen und nicht-personalen Umwelt hervorgehoben.
Was ist der Fokus des Kapitels "Die Gottesrelation des Menschen"?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Gottesbeziehung als Ursprungsbeziehung und argumentiert, dass der Mensch als ein konstitutiv auf Gott ausgerichtetes Wesen verstanden werden kann. Es erörtert die Implikationen dieser Beziehung für das menschliche Sein.
Wie wird die Relationalität des Menschen im Kontext der Wirtschaft betrachtet?
Das Kapitel zur Wirtschaft kritisiert das Modell des nutzenmaximierenden egoistischen Akteurs und betrachtet die Unternehmensethik als Ordnungselement. Am Beispiel der Mitbestimmung von Arbeitern wird gezeigt, wie relationale Aspekte zu einem effektiveren und gerechteren Wirtschaftssystem beitragen können.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Theologische Anthropologie, Autonomer Individualismus, Relationalität, Homo Oeconomicus, Individuum, Gesellschaft, Gottesbeziehung, Unternehmensethik, Mitbestimmung und Wirtschaftsethik.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die Schlussfolgerung muss aus dem Originaltext entnommen werden, da sie hier nicht explizit angegeben ist. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch Hinweise auf die Argumentationslinie.)
- Arbeit zitieren
- Christian Lannert (Autor:in), 2006, Theologisch-anthropologische Auseinandersetzung: Autonomer Individualismus versus Relationalität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130659