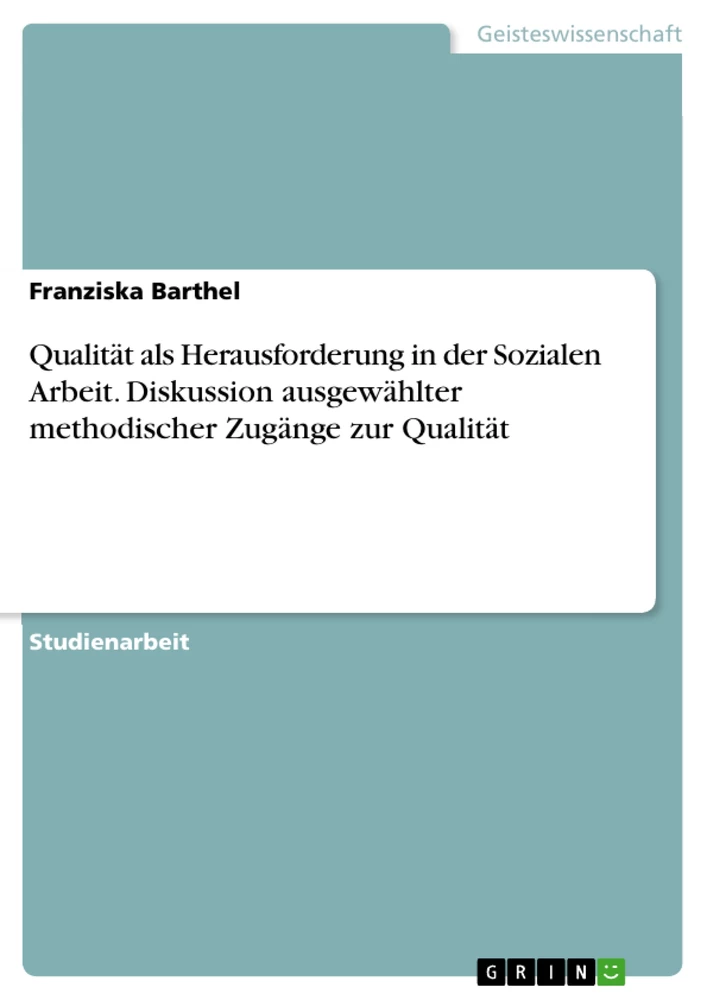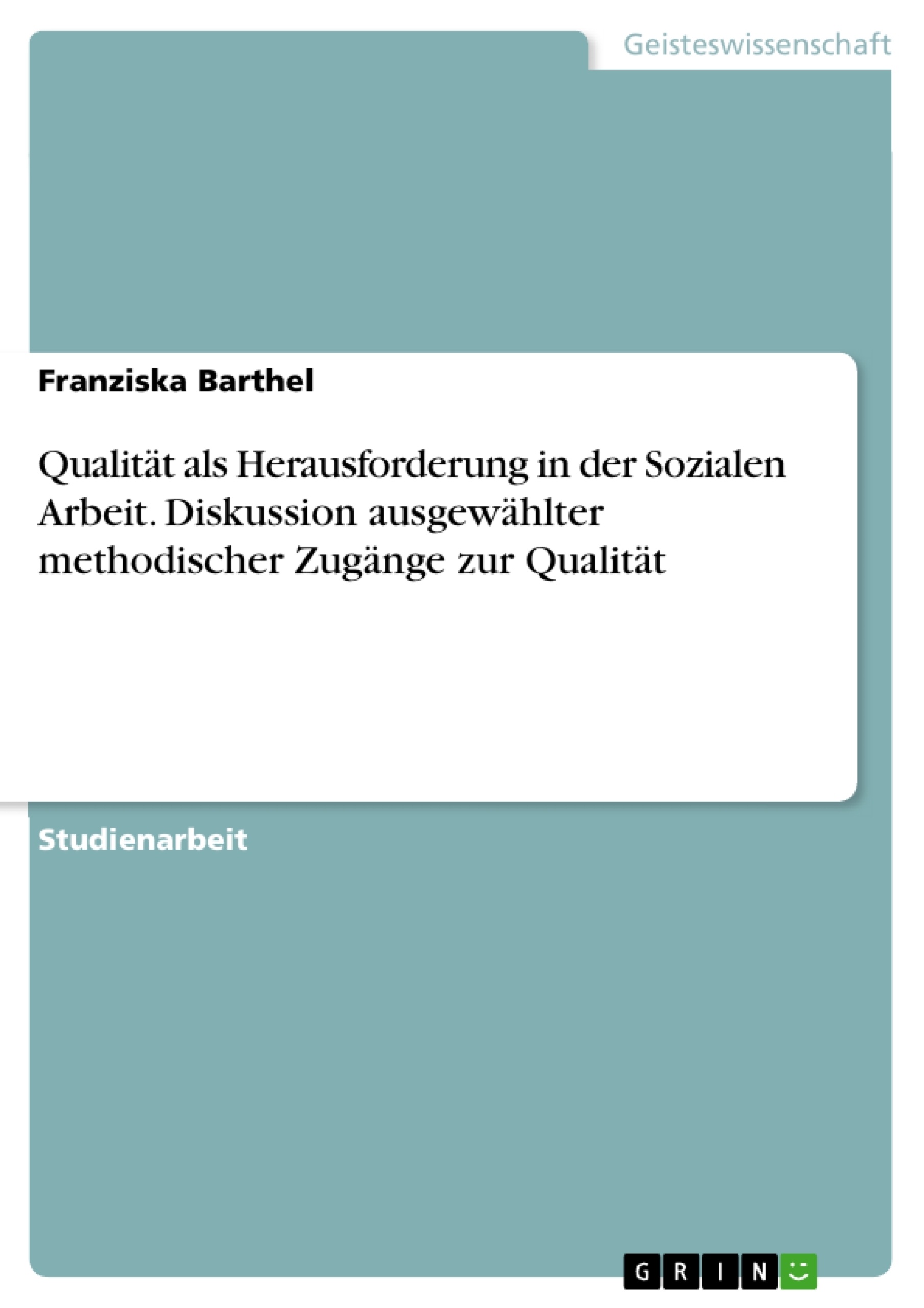In dieser Hausarbeit sollen zunächst einige relevante Schlüsselbegriffe von Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit erläutert werden. Es sollen die beiden grundlegenden Grundmuster der Qualitätsentwicklung - Verfahrensstandardisierung und reflexive Verfahren - erklärt sowie die prägnantesten Unterschiede zwischen ihnen dargelegt werden. Daraus ergibt sich der Kern der vorliegenden Arbeit – wie sichert Schulsozialarbeit ihre „gute Arbeit“? Anhand drei ausgewählter Aspekte zweier Konzepte soll analysiert und diskutiert werden. Es kommen Herangehensweisen und Methodiken sowie Stärken und Schwächen der Standards in der Stadt Freiburg und im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu Sprache.
Wenn man sich der Thematik Qualitätsstandards nähert, sei es bei Objekten oder Prozessen, muss man sich zunächst der Bedeutung des Terminus Qualität bewusst werden „Qualitas“ ist lateinisch und bedeutet „Beschaffenheit“. Es stellt daher zunächst eine wertneutrale Beschreibung eines Gegenstandes oder eines Vorganges dar. Ob der rein semantische Gehalt der Begriffserklärung ausreicht, wird sich folglich noch zeigen.
Über einen längeren Zeitraum hinweg mussten soziale Organisationen ihre Arbeit nicht beurteilen oder ihre Effektivität nachweisen. Etwa seit den 1990er Jahren (u.a. durch die Einführung des New Public Managements, zu Deutsch: Öffentliche Reformverwaltung) werden die Frage der Wirksamkeit und Qualität immer wesentlicher. Diesbezüglich wird von «Wirkungsorientierung» und «Qualitätsorientierung» gesprochen. Mittlerweile müssen viele soziale Organisationen die Qualität ihres Tuns und die Wirksamkeit der Leistungen nach außen legitimieren. Die Ansprüche sind deutlich gestiegen.
Zeitgleich verstärkt sich der Verteilungskampf um die staatlichen finanziellen Mittel. Organisationen, die Unterstützung des Staates angewiesen sind, gelangen unter Druck. Es werden Nachweise über effiziente Nutzung der finanziellen Ressourcen verlangt. Es scheint unumgänglich Konzepte und Instrumenten zu installieren, welche es ihnen ermöglichen, die erwarteten Nachweise „zu liefern“.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Instrumente und Methoden von Qualitätssicherung
- 2.1 Erläuterung von Schlüsselbegriffen
- 2.1.1 Qualität in der Sozialen Arbeit
- 2.1.2 Qualitätsstandards
- 2.1.3 Qualitätshandbuch
- 2.2 Methoden der Qualitätssicherung
- 2.2.1 Qualitätssicherung
- 2.2.2 Qualitätsmanagement
- 2.2.3 Verfahrensstandardisierung
- 2.2.4 Reflexive Verfahren
- 2.1 Erläuterung von Schlüsselbegriffen
- 3 Darstellung, Analyse, Reflexion
- 4 Kritische Diskussion
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Herausforderungen der Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Bereich der Schulsozialarbeit. Sie analysiert verschiedene methodische Zugänge zur Qualitätsentwicklung und diskutiert deren Stärken und Schwächen anhand konkreter Beispiele. Das Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Bedeutung von Qualitätsstandards in der Praxis zu entwickeln.
- Definition und Dimensionen von Qualität in der Sozialen Arbeit
- Methoden der Qualitätssicherung (Verfahrensstandardisierung und reflexive Verfahren)
- Analyse von Qualitätsstandards in der Schulsozialarbeit
- Stärken und Schwächen verschiedener Qualitätsansätze
- Herausforderungen bei der Implementierung von Qualitätsstandards in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit ein und betont die wachsende Bedeutung von Wirkungsorientierung und Qualitätsorientierung im Kontext des New Public Management. Sie erläutert die Notwendigkeit von Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit, besonders im dynamischen Feld der Schulsozialarbeit, wo vielfältige Erwartungen und Anforderungen an die Unterstützungsleistungen bestehen. Der Begriff der Schulsozialarbeit wird kurz definiert und die Notwendigkeit von klaren Vorgaben und Standards für die Erreichung unterschiedlicher Ziele hervorgehoben. Die Arbeit skizziert ihren weiteren Verlauf, der sich auf die Erläuterung von Schlüsselbegriffen, die Analyse ausgewählter Konzepte und die Diskussion deren Stärken und Schwächen konzentriert.
2 Instrumente und Methoden von Qualitätssicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Erläuterung von Schlüsselbegriffen des Qualitätsmanagements in der Sozialen Arbeit. Es definiert den Begriff der Qualität, unterscheidet zwischen deskriptiv-analytischem, normativem, evaluativem und handlungsorientiertem Gehalt und beleuchtet die verschiedenen Perspektiven (adressatenbezogen, organisationsbezogen, fachbezogen). Weiterhin werden die Dimensionen der Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität erläutert. Die Kapitelteile zu Qualitätsstandards und Qualitätshandbüchern setzen die Grundlagen für das Verständnis der im weiteren Verlauf dargestellten Methoden der Qualitätssicherung.
Schlüsselwörter
Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Schulsozialarbeit, Verfahrensstandardisierung, reflexive Verfahren, Qualitätsstandards, Wirkungsorientierung, New Public Management, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit, insbesondere in der Schulsozialarbeit. Sie analysiert verschiedene methodische Ansätze zur Qualitätsentwicklung und bewertet deren Vor- und Nachteile anhand konkreter Beispiele. Ziel ist ein besseres Verständnis der Bedeutung von Qualitätsstandards in der Praxis.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Dimensionen von Qualität in der Sozialen Arbeit; Methoden der Qualitätssicherung (Verfahrensstandardisierung und reflexive Verfahren); Analyse von Qualitätsstandards in der Schulsozialarbeit; Stärken und Schwächen verschiedener Qualitätsansätze; Herausforderungen bei der Implementierung von Qualitätsstandards in der Praxis.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Instrumente und Methoden der Qualitätssicherung, Darstellung, Analyse, Reflexion, Kritische Diskussion und Fazit. Das Kapitel "Instrumente und Methoden der Qualitätssicherung" beinhaltet Unterkapitel zu Schlüsselbegriffen (Qualität in der Sozialen Arbeit, Qualitätsstandards, Qualitätshandbuch) und Methoden der Qualitätssicherung (Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Verfahrensstandardisierung, reflexive Verfahren).
Wie wird Qualität in der Sozialen Arbeit definiert?
Die Hausarbeit beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Begriff der Qualität (adressatenbezogen, organisationsbezogen, fachbezogen) und unterscheidet zwischen deskriptiv-analytischem, normativem, evaluativem und handlungsorientiertem Gehalt. Es werden auch die Dimensionen der Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität erläutert.
Welche Methoden der Qualitätssicherung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Verfahrensstandardisierung und reflexive Verfahren als Methoden der Qualitätssicherung. Es werden deren Stärken und Schwächen im Kontext der Schulsozialarbeit diskutiert.
Welche Rolle spielt das New Public Management?
Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Wirkungsorientierung und Qualitätsorientierung im Kontext des New Public Management für die Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Schulsozialarbeit, Verfahrensstandardisierung, reflexive Verfahren, Qualitätsstandards, Wirkungsorientierung, New Public Management und Evaluation.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
(Das Fazit selbst ist nicht im bereitgestellten Text enthalten. Es wird im letzten Kapitel der Hausarbeit zu finden sein.)
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Bedeutung von Qualitätsstandards in der Praxis der Sozialen Arbeit, insbesondere der Schulsozialarbeit, zu entwickeln.
- Quote paper
- Franziska Barthel (Author), 2022, Qualität als Herausforderung in der Sozialen Arbeit. Diskussion ausgewählter methodischer Zugänge zur Qualität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1307414