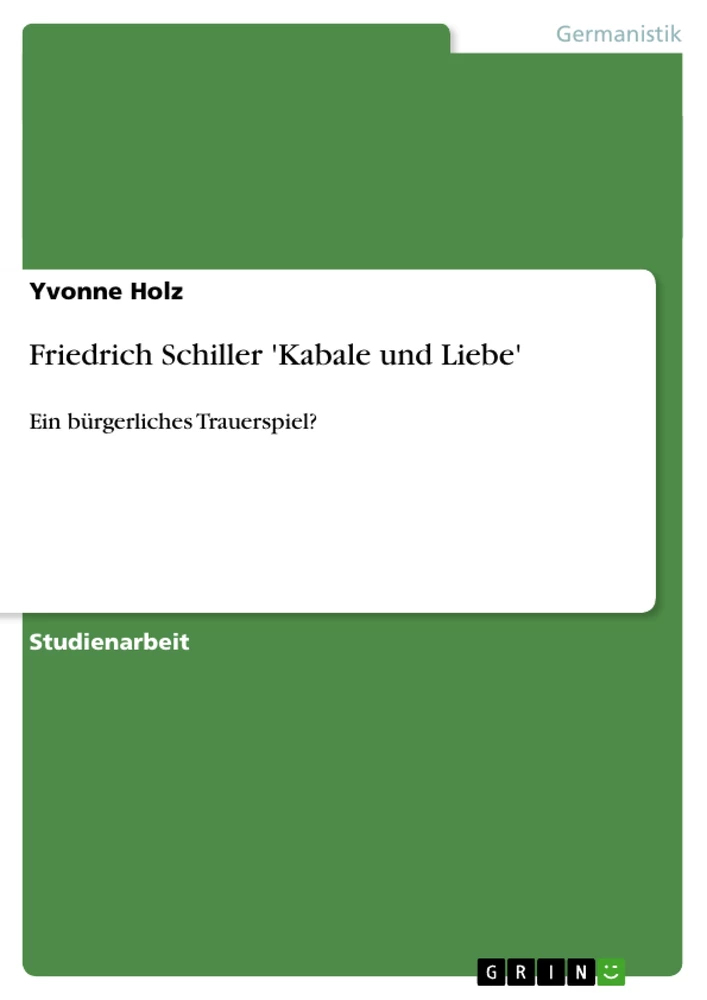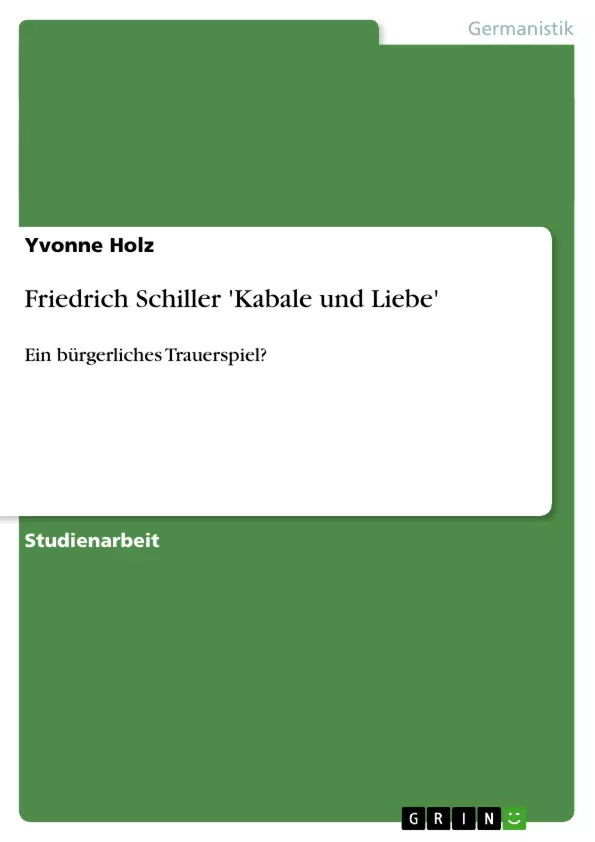Mit seinem Drama Kabale und Liebe (ursprünglich Luise Millerin) nimmt Schiller die publikumswirksame Gattung des bürgerlichen Trauerspiels auf. Schillers Werk erzählt die Geschichte von Luise, einer Bürgerlichen, und Ferdinand, einem Adligen, die sich über die Standesgrenzen hinweg lieben. Da die Beziehung den ehrgeizigen Interessen des Präsidenten (Ferdinands Vater) im Weg steht, wird sie durch eine Intrige getrennt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Werk Schillers unter besonderer Berücksichtigung der, oben bereits erwähnten, Gattung des bürgerlichen Trauerspiels. Dazu erfolgen zunächst eine kurze biographische Einordnung des Stückes sowie die Betrachtung seiner Entstehungsgeschichte. Hierbei werden Fragen nach Entstehungszeit und -zusammenhang geklärt. Die anschließende Analyse und Interpretation befasst sich mit der zentralen Frage: Kabale und Liebe – ein bürgerliches Trauerspiel? Im Rahmen der Analyse wird das Augenmerk auf die Definition und Geschichte sowie eine werkimmanente Untersuchung der gattungstypischen Merkmale der bürgerlichen Tragödie gelegt. Alle analytischen Betrachtungen werden mit konkreten Textbeispielen belegt und veranschaulicht. Ziel der Analyse ist es, Anhaltspunkte und Bedeutungsperspektiven im Rahmen der zentralen Aufgabenstellung zu eruieren. Abschließend wird auf die Rezeption und Kritik der Zeit, Schillers Werk betreffend, eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schiller - ein biographischer Abriss.
- Entstehung des Werkes
- Entstehungszeit...
- Entstehungszusammenhang
- Analyse / Interpretation.
- Das bürgerliche Trauerspiel
- Versuch einer Definition ........
- Geschichte und Wandel...
- Kabale und Liebe als bürgerliches Trauerspiel.....
- Das bürgerliche Trauerspiel
- Rezeption...........
- Abschließende Betrachtung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Friedrich Schillers Drama "Kabale und Liebe" und untersucht, ob es sich um ein bürgerliches Trauerspiel handelt. Die Arbeit beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Werkes, die biographischen Hintergründe Schillers und die gattungsspezifischen Merkmale des bürgerlichen Trauerspiels.
- Die Definition und Geschichte des bürgerlichen Trauerspiels
- Die Analyse der gattungstypischen Merkmale in "Kabale und Liebe"
- Die Rezeption des Werkes in der Zeit Schillers
- Die Bedeutung des Werkes für die heutige Zeit
- Die Rolle der Liebe und der gesellschaftlichen Konventionen in Schillers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung vor: Ist "Kabale und Liebe" ein bürgerliches Trauerspiel? Das zweite Kapitel bietet einen kurzen biographischen Abriss über Friedrich Schiller und seine Lebensstationen bis zum Entstehen des Werkes. Das dritte Kapitel beleuchtet die Entstehungszeit und den Entstehungszusammenhang des Dramas. Es werden die literarischen und zeitgeschichtlichen Einflüsse auf Schillers Werk untersucht, insbesondere die Epoche des Sturm und Drang und die politische Situation in Württemberg. Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse und Interpretation des Werkes im Hinblick auf die Gattung des bürgerlichen Trauerspiels. Es werden die Definition und Geschichte dieser Gattung sowie die gattungstypischen Merkmale in "Kabale und Liebe" untersucht. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Rezeption des Werkes in der Zeit Schillers. Es werden die Reaktionen des Publikums und der Kritik auf das Drama beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das bürgerliche Trauerspiel, Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, Sturm und Drang, Liebe, gesellschaftliche Konventionen, Standesunterschiede, Intrigen, Macht, Moral, Rezeption, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein bürgerliches Trauerspiel?
Es ist eine dramatische Gattung, in der bürgerliche Protagonisten und deren moralische Konflikte im Zentrum stehen, oft im Gegensatz zum Adel.
Worum geht es in Schillers "Kabale und Liebe"?
Das Drama erzählt die tragische Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Luise Miller und dem adligen Ferdinand, die durch eine Intrige zerstört wird.
Welche Rolle spielt die Epoche Sturm und Drang?
Die Epoche beeinflusste Schiller maßgeblich, was sich in der emotionalen Intensität und der Kritik an den absolutistischen Standesgrenzen zeigt.
Wie reagierte das Publikum zur Zeit Schillers auf das Werk?
Das Stück sorgte für großes Aufsehen, da es die korrupten Machtverhältnisse bei Hofe und die moralische Überlegenheit des Bürgertums thematisierte.
Welche gattungstypischen Merkmale sind im Werk zu finden?
Dazu zählen die private Sphäre der Familie, die moralische Integrität der Bürgerlichen und das Scheitern an gesellschaftlichen Konventionen.
- Citation du texte
- Magister Artium Yvonne Holz (Auteur), 2007, Friedrich Schiller 'Kabale und Liebe', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130775