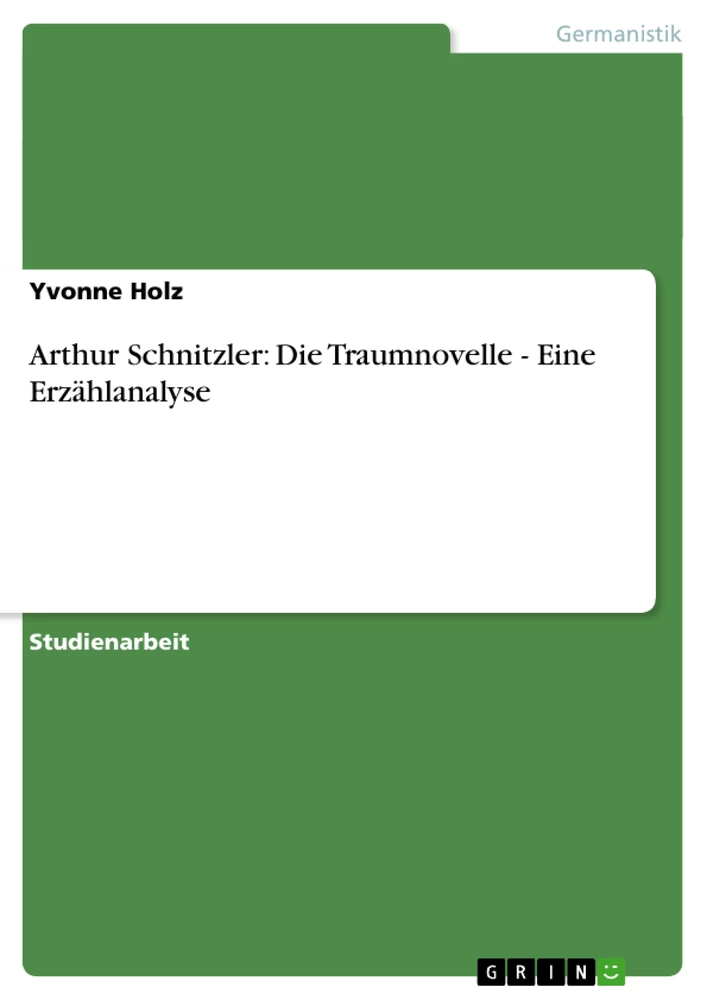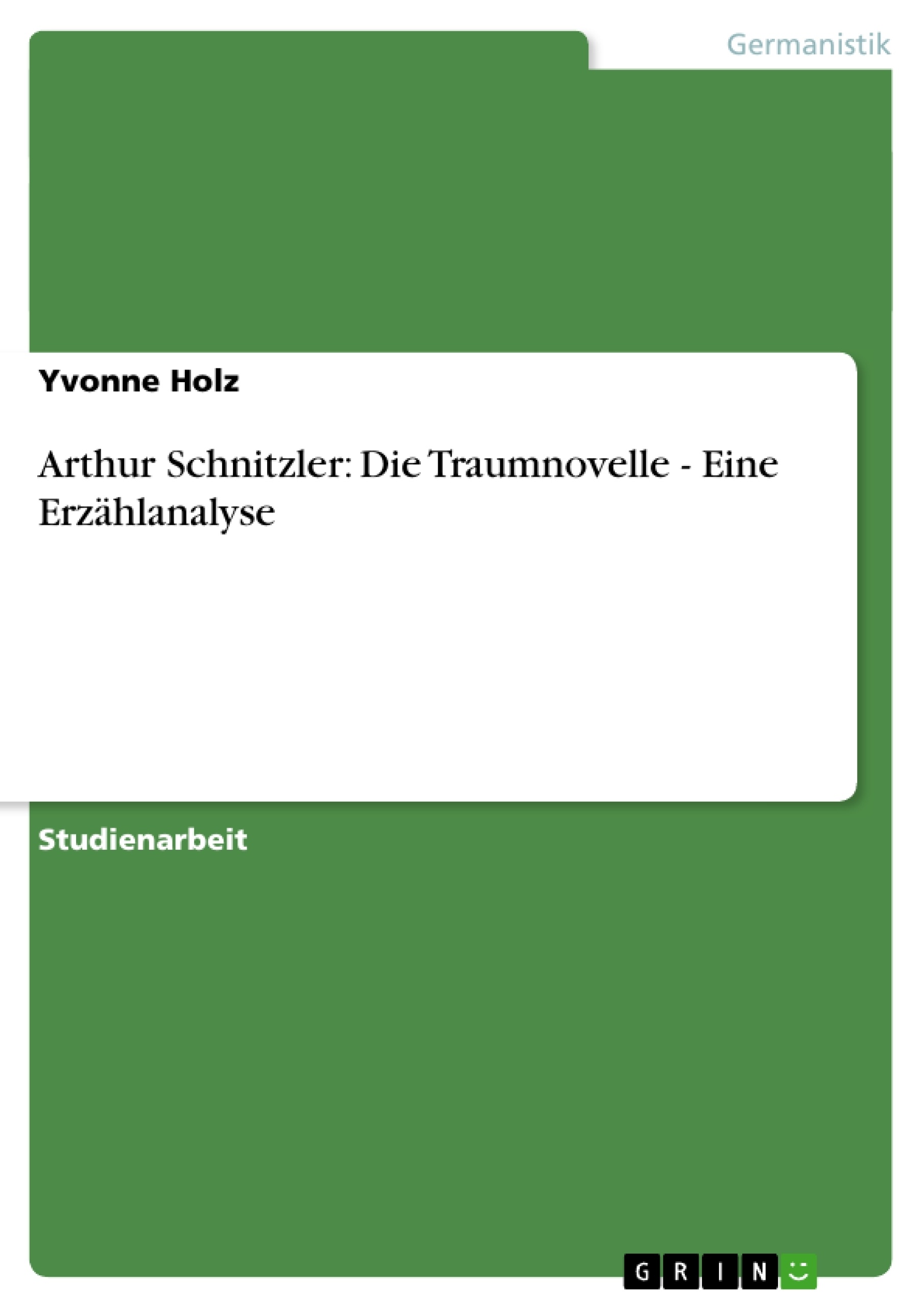Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Arthur Schnitzlers Werk die „Traumnovelle“, welches ein Resultat der jahrelangen Beschäftigung mit der Psychologie, „(...) die Schnitzler schon früh als wesentlich für seine Arbeit ansah (...)“ (Schnitzler 2002, S. 111), ist.
Im Rahmen dieser Analyse wird zunächst die Zeitstruktur der Novelle untersucht. Am konkreten Beispiel sollen hierbei Fragen nach der Ordnung (in welcher Reihenfolge), der Dauer (zeitlicher Umfang) und der Frequenz (Wiederholung) beantwortet werden.
Ferner wird der Begriff des Modus als der Grad der Mittelbarkeit und der Perspektivierung des Erzählten dargelegt. Anschließend soll das Themengebiet der Stimme, als Akt des Erzählens, betrachtet werden (Martinez/Scheffel 2003, S. 30-45).
Ziel der Analyse ist es, Anhaltspunkte und Bedeutungsperspektiven im Rahmen der zentralen Aufgabenstellung: Die Traumnovelle - im Spiegel der Analyse von Zeit, Modus und Stimme zu eruieren. Das zentrale Augenmerk liegt dabei auf der Darstellung der einzelnen Untersuchungskriterien, der Beweisführung anhand von ausgewählten Beispielen sowie der Untersuchung von Auswirkungen und Konsequenzen auf das Werk Schnitzlers.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltsangabe
- Analyse
- Zeit
- Ordnung
- Dauer
- Frequenz
- Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Stimme
- Zeitpunkt des Erzählens
- Ort des Erzählens
- Stellung des Erzählers zum Geschehen
- Subjekt und Adressat des Erzählens
- Zeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und untersucht dabei die Zeitstruktur, den Modus und die Stimme der Erzählung. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Elemente für die Gestaltung der Novelle aufzuzeigen und ihre Auswirkungen auf die Interpretation des Werkes zu beleuchten.
- Zeitstruktur der Novelle
- Modus als Mittelbarkeit und Perspektivierung
- Stimme als Akt des Erzählens
- Bedeutung der Zeitstruktur, des Modus und der Stimme für die Interpretation der Novelle
- Analyse der einzelnen Elemente anhand von Beispielen aus dem Text
Zusammenfassung der Kapitel
Die „Traumnovelle“ spielt in Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte des Arztes Fridolin, seiner Frau Albertine und ihrer Tochter. Die ersten drei Kapitel schildern das gegenseitige Geständnis der Eheleute über ihre gedankliche Untreue, Fridolins Hausbesuch beim alten Hofrat und dessen Tochter Marianne sowie Fridolins Begegnung mit der Prostituierten Mizzi. Das vierte Kapitel beschreibt Fridolins Treffen mit seinem alten Studienkollegen Nachtigall und den Besuch einer „geheimen Gesellschaft“ auf einem Maskenball. In Kapitel fünf berichtet Albertine Fridolin von ihrem Traum. Kapitel sechs zeigt Fridolins Suche nach der Frau, die er als seine „Retterin“ vom Maskenball wahrnimmt, in der Leichenhalle. Das siebte Kapitel endet mit der Versöhnung des Ehepaares.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Traumnovelle, Arthur Schnitzler, Zeitstruktur, Modus, Stimme, Erzählanalyse, Erzählzeit, erzählte Zeit, Ordnung, Dauer, Frequenz, Distanz, Fokalisierung, Zeitpunkt des Erzählens, Ort des Erzählens, Stellung des Erzählers, Subjekt und Adressat des Erzählens.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Arthur Schnitzlers "Traumnovelle"?
Die Novelle erzählt die Geschichte des Arztes Fridolin und seiner Frau Albertine, die sich gegenseitig ihre unterdrückten Sehnsüchte und gedankliche Untreue gestehen, was Fridolin in eine nächtliche Odyssee durch Wien stürzt.
Welche Rolle spielt die Psychologie in diesem Werk?
Schnitzler, selbst Arzt, integrierte tiefenpsychologische Erkenntnisse über das Unbewusste, Träume und verdrängte Begierden in die Handlung.
Was wird unter der "Zeitstruktur" der Novelle analysiert?
Die Analyse untersucht die Ordnung (Reihenfolge), die Dauer (zeitlicher Umfang des Geschehens) und die Frequenz (Wiederholung von Ereignissen) innerhalb der Erzählung.
Was bedeutet der Begriff "Modus" in der Erzählanalyse?
Der Modus bezeichnet den Grad der Mittelbarkeit (Distanz) und die Perspektivierung (Fokalisierung), also aus wessen Sicht und wie unmittelbar das Geschehen dem Leser vermittelt wird.
Was ist das Ziel der Untersuchung von "Stimme" im Text?
Es geht um den Akt des Erzählens selbst: Wer spricht, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und in welcher Beziehung steht der Erzähler zum Geschehen.
- Quote paper
- Magister Artium Yvonne Holz (Author), 2006, Arthur Schnitzler: Die Traumnovelle - Eine Erzählanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130789