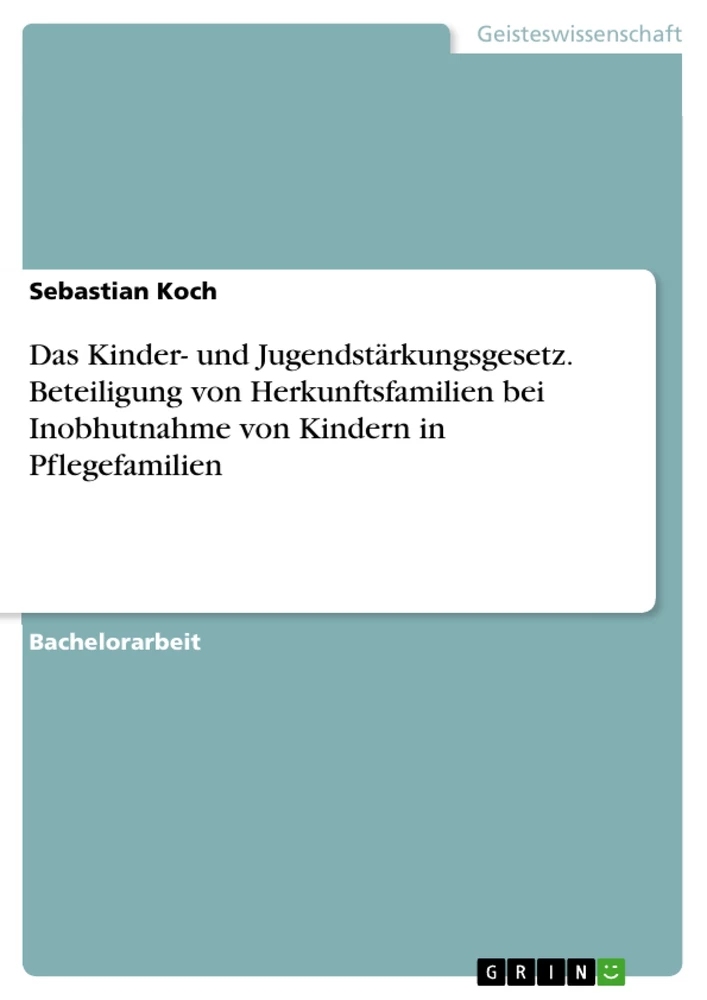Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) und untersucht bestehende Strukturen sowie Hilfen. Es erfolgt eine Darstellung, welche Hilfsangebote im Kyffhäuserkreis aktuell vorliegen und welche neuen Regelungen des KJSG Einfluss darauf nehmen können. Ferner wird untersucht, ob sich die interpersonellen Beziehungen unter den aktuellen Bedingungen der Sars-CoV-2-Pandemie geändert haben. Der Fokus aller Untersuchungen liegt auf der Trias zwischen Pflegekindern, Herkunftsfamilien und Pflegefamilien des Kyffhäuserkreises in Thüringen.
Im ersten Teil wird konkretisiert, welche Auswirkungen das KJSG auf das SGB VIII hat. Dabei werden nur die Paragrafen erläutert, bei denen ein möglicher Zusammenhang zum Pflegekinderwesen des Landratsamtes im Kyffhäuserkreis bestehen könnte.
Im zweiten Teil wird erklärt, wie das Pflegekinderwesen strukturiert ist und welche Pflegeformen rechtlich möglich sind. Ein Kapitel widmet sich bestehenden regionalen Hilfsangeboten der freien Träger als Basis für eine Weiterentwicklung derer oder einer Projektierung neuer Möglichkeiten im Kontext des KJSG. Bestehende wie auch potenziell neue Hilfsangebote werden unter dem Schwerpunkt der Beziehungsstabilisierung der obengenannten Trias untersucht.
Im dritten Teil werden die Forschungsergebnisse zweier Umfragen an Herkunftsfamilien und an Pflegefamilien präsentiert. Zum Erkenntnisgewinn wurden zwei Online-Fragebögen veröffentlicht, die über eine deduktive und quantitative Sozialforschung deskriptiv analysiert und dokumentiert werden. Die Ergebnisse werden anhand sozialarbeiterischer Aspekte untersucht und eingeschätzt. Anschließend werden die Umfrageergebnisse zusammengefasst und die aufgestellten Hypothesen beantwortet. Im vierten Teil werden die neuen Gesetzesänderungen und die Erkenntnisse der Umfrage in die sozialarbeiterische und sozialpädagogische Praxis überführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Gegenstand der Abhandlung
- 1.2 Gliederung und methodisches Vorgehen
- 2 Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
- 2.1 Gender Mainstreaming und Identitäten
- 2.2 Hilfen zur Selbsthilfe
- 2.3 Inter- und Transdisziplinarität / Netzwerkarbeit
- 2.4 Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
- 2.5 Beteiligung Betroffener mit präventiver Wirkung
- 2.6 Die Macht der Sprache
- 2.7 Erweiterung der Beteiligten / Ganzheitlichkeit
- 2.8 Ombudsstellen
- 2.9 Mitgestaltung von Beratungsgesprächen
- 2.10 Verfahrenslotse
- 2.11 Hilfen zur Erziehung
- 2.12 Notsituationen
- 2.13 Individualbetreuung
- 2.14 Inklusion in Tageseinrichtungen
- 2.15 Berücksichtigung von Geschwistern im Hilfeplan
- 2.16 Zuständigkeitsübergang im Hilfeplan
- 2.17 Beratung und Unterstützung von Herkunftsfamilien und Pflegefamilien
- 2.18 Beratung und Unterstützung für Pflegefamilien
- 2.19 Rechte von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien
- 2.20 Abwägung der Verbringung des Kindes in einer Pflegefamilie / Hilfeplan
- 2.21 Nach Beendigung der Hilfen / Hilfeplan
- 2.22 Schutzkonzepte in Einrichtungen
- 2.23 Einrichtungen mit und ohne Betriebserlaubnis
- 3 Das Pflegekinderwesen im Kyffhäuserkreis
- 4 Pflegeformen und zugehörige Hilfen
- 4.1 Vollzeitpflege und mögliche Hilfsformen
- 4.1.1 Hilfen zur Erziehung
- 4.1.2 Eingliederungshilfe
- 4.1.3 Hilfe für junge Volljährige
- 4.1.4 Inobhutnahme
- 4.1.5 Privates Pflegeverhältnis
- 4.1.6 Adoptionspflege
- 4.2 Herausforderungen an Pflege- und Herkunftsfamilien sowie an Fachkräfte
- 4.2.1 Pflegefamilien
- 4.2.2 Herkunftsfamilien
- 4.2.3 Herkunftsfamilien und Herausforderungen an Fachkräfte
- 4.3 Trennung der Kinder von Herkunftsfamilien
- 5 Auswertung der Befragung von Herkunfts- und Pflegefamilien
- 5.1 Forschungsfrage und Hypothesen
- 5.2 Angewandte Methoden
- 5.2.1 Studiendesign und Untersuchungsform
- 5.2.2 Studienpopulation und Stichprobe
- 5.2.3 Erhebungsinstrument
- 5.2.4 Durchführung
- 5.2.5 Datenanalyse
- 5.3 Ergebnisse der Stichproben
- 5.3.1 Lebensalter und eigene Kinder (Pflegefamilie)
- 5.3.2 Berufliche Aktivitäten
- 5.3.3 Kontakt zwischen Pflege- und Herkunftsfamilien
- 5.3.4 Kontaktabbrüche
- 5.3.5 Treffen zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilien
- 5.3.6 Folgen von Treffen
- 5.3.7 Wahrnehmung des Entscheidungsfreiraumes
- 5.3.8 Unterstützungsbedarf in Lebensbereichen
- 5.3.9 Veränderungen der interpersonellen Beziehungen während der Sars-CoV-2-Pandemie
- 5.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse - Diskussion
- 5.5 Beantwortung der Hypothesen
- 5.5.1 Herkunftsfamilien
- 5.5.2 Pflegefamilien
- 5.5.3 Die Auswirkungen des KJSG
- 6 Ableitungen neuer oder ergänzender Hilfen
- 6.1 Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Kyffhäuserkreis
- 6.2 Tätigkeitsfelder
- 6.3 Kontakt zur Herkunftsfamilie
- 6.4 Loyalitätskonflikte
- 6.5 Traumapädagogik und Biografiearbeit
- 6.6 Pädagogische Unterstützungen
- 6.7 Grundlegendes aus dem KJSG
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Beteiligung von Herkunftsfamilien bei der Inobhutnahme von Kindern in Pflegefamilien unter Berücksichtigung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) gelingen kann, um das Wohl der Kinder zu sichern und auszubauen. Die Arbeit analysiert die relevanten Aspekte des KJSG, die für die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien relevant sind, und untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben.
- Das KJSG und seine Relevanz für die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien
- Die Bedeutung der Beteiligung von Herkunftsfamilien für das Wohl der Kinder in Pflegefamilien
- Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien
- Die Rolle von Fachkräften und Einrichtungen in der Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien
- Empirische Befunde zur Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Abhandlung und die methodische Vorgehensweise erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich dem KJSG und seinen relevanten Aspekten für die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien. Es werden Themen wie Gender Mainstreaming, Hilfen zur Selbsthilfe, Inter- und Transdisziplinarität sowie die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien behandelt.
Kapitel 3 beleuchtet das Pflegekinderwesen im Kyffhäuserkreis, während Kapitel 4 verschiedene Pflegeformen und die damit verbundenen Hilfen beschreibt. Im Fokus stehen dabei Vollzeitpflege, Hilfen zur Erziehung und die Herausforderungen an Pflege- und Herkunftsfamilien.
Das fünfte Kapitel analysiert die Ergebnisse einer Befragung von Herkunfts- und Pflegefamilien, die die Forschungsfrage der Arbeit untersucht. Dabei werden verschiedene Aspekte wie das Lebensalter und die Berufstätigkeit der Pflegefamilien, der Kontakt zwischen Pflege- und Herkunftsfamilien und die Wahrnehmung des Entscheidungsfreiraumes betrachtet.
Im sechsten Kapitel werden Ableitungen neuer oder ergänzender Hilfen für Herkunfts- und Pflegefamilien im Kontext des KJSG diskutiert. Die Arbeit endet mit einem Fazit, welches die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), Pflegekinderwesen, Herkunftsfamilien, Pflegefamilien, Beteiligung, Zusammenarbeit, Wohl des Kindes, Herausforderungen, Chancen, empirische Befunde, Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Fachkräfte, Einrichtungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)?
Das KJSG ist eine Reform des SGB VIII, die darauf abzielt, Kinder und Jugendliche zu schützen und die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien zu verbessern.
Warum ist die Beteiligung der Herkunftsfamilie wichtig?
Eine gelungene Beteiligung stabilisiert die Trias aus Pflegekind, Herkunftsfamilie und Pflegefamilie und hilft, Loyalitätskonflikte beim Kind zu minimieren.
Was ist ein „Verfahrenslotse“?
Ein Verfahrenslotse ist eine durch das KJSG neu eingeführte Funktion, die Eltern und Kinder durch die komplexen Verfahren der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe begleitet.
Wie hat die Corona-Pandemie die Beziehungen im Pflegekinderwesen beeinflusst?
Die Arbeit untersucht, ob Kontaktbeschränkungen während der Pandemie zu Kontaktabbrüchen oder veränderten interpersonellen Beziehungen geführt haben.
Welche Rolle spielt die Biografiearbeit für Pflegekinder?
Biografiearbeit hilft dem Kind, seine Geschichte zu verstehen und die Verbindung zu seiner Herkunft positiv in seine Identität zu integrieren.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Koch (Autor:in), 2022, Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Beteiligung von Herkunftsfamilien bei Inobhutnahme von Kindern in Pflegefamilien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1307970