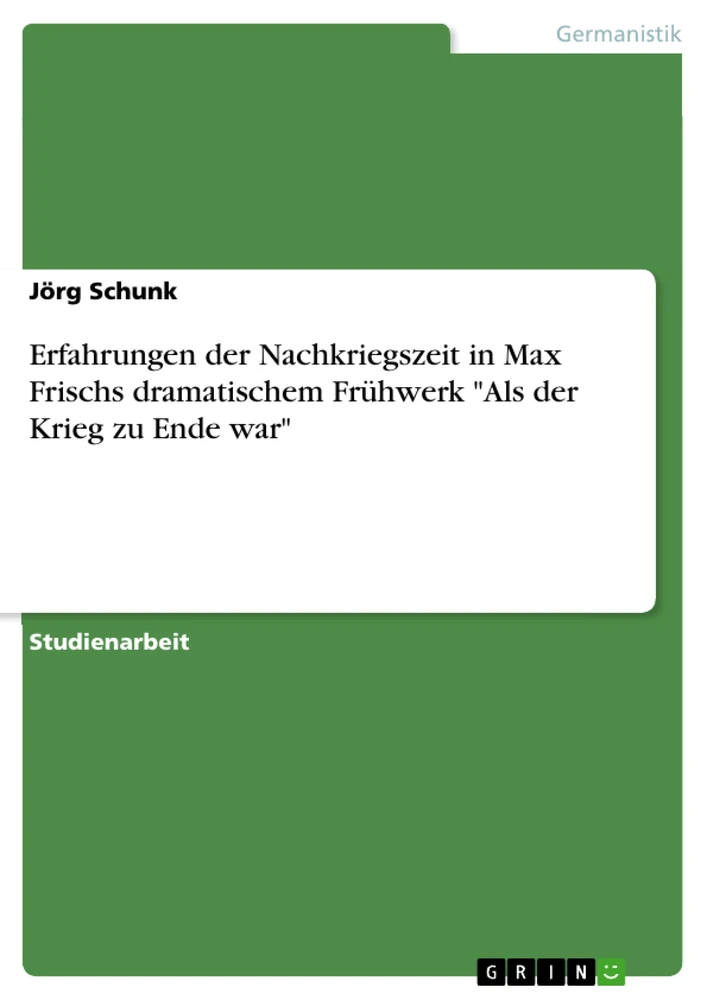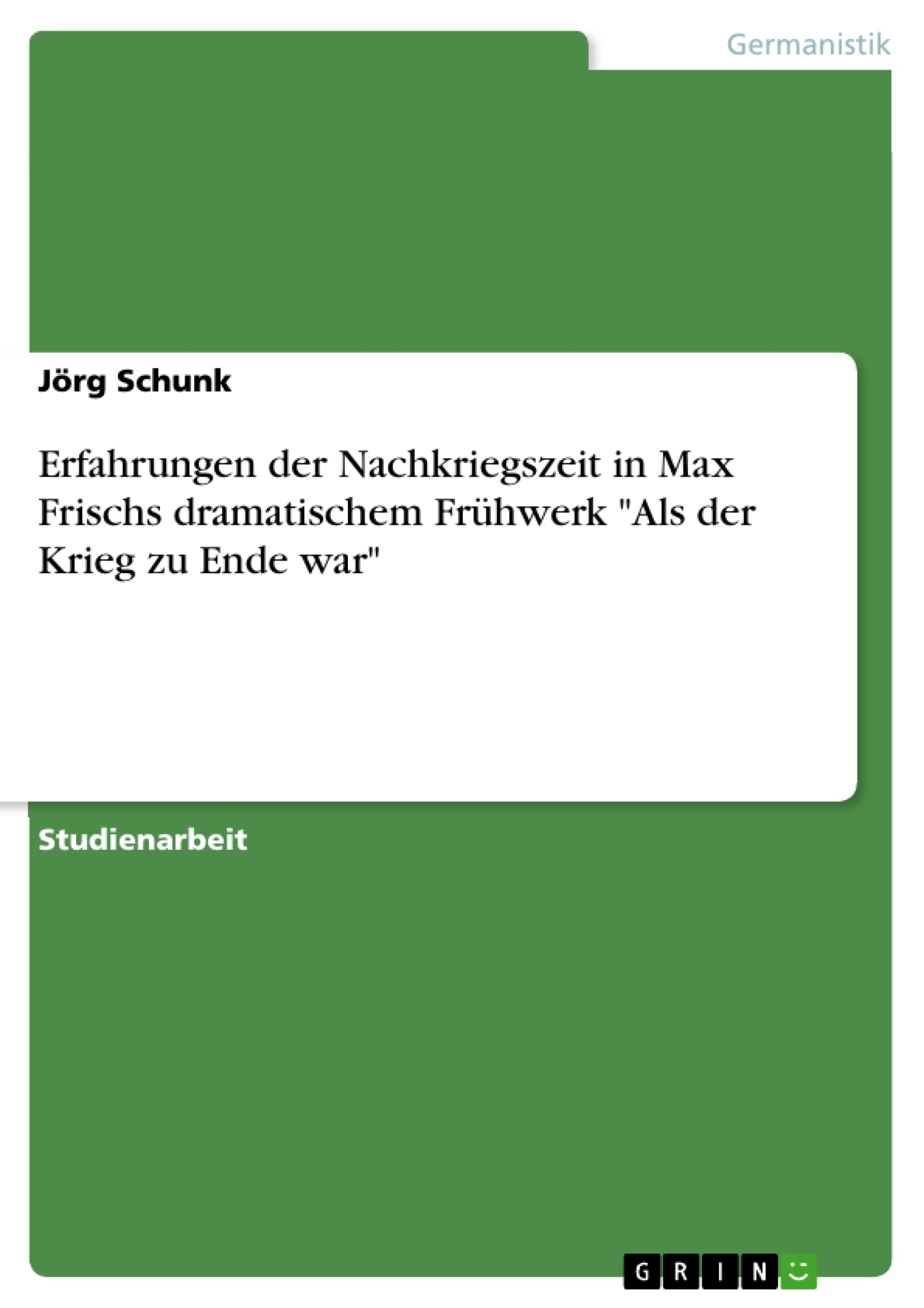Max Frischs dramatisches Frühwerk „Als der Krieg zu Ende war“ gilt als ein historisches Stück. Die Handlungen beruhen auf einer Erzählung der Russenzeit seines Gastwirtes Frank. Die Figuren sowie deren Erlebnisse und Handlungen sind mit Frischs Tagebuch (1946 bis 1949) eng verknüpft oder beruhen auf Erzählungen von seinen Freunden aus Berlin. Die Uraufführung fand am im Januar 1949 im Züricher Schauspielhaus statt.
Die Thematiken der Nachkriegsliteratur ab 1945 wie beispielsweise Holocaust, Trümmer, Armut, Elend, Hunger, Kriegsgefangene, Heimkehrer, Zerstörung, Besatzung, die Frage nach der Schuld und so weiter werden in dieser Hausarbeit aufgegriffen und anhand einer strukturellen Textanalyse hauptsächlich aus Frischs Tagebuch und seinem dramatischen Frühwerk analysiert, interpretiert und erörtert.
Die Struktur dieser Hausarbeit ist folgendermaßen gegliedert: Zunächst werden einzelne Erlebnisse und Verknüpfungen zwischen den beiden Werken beschrieben und thematisiert. Im zweiten Kapitel wird unter Verwendung von weiterer Literatur über die Thematik der Schuld geschrieben. Hier soll an basaler Textgrundlage erklärt werden, wer oder was nun die Schuld trägt. Im Nachwort findet sich, neben einer Literaturliste, ein Anhang, in dem tabellarisch weitere Erlebnisse und Erfahrungen der Nachkriegszeit aus Max Frischs Tagebuch, mit Seitenzahlen und Art und Anmerkungen versehen, festgehalten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erlebnisse aus der Nachkriegszeit 1946-1949.
- 2.1 Zerstörung und Trümmer.
- 2.2 Armut, Elend, Hunger
- 2.3 Holocaust.
- 2.4 Besatzung.
- 2.5 Kriegsgefangene, Heimkehrer.
- 3. Die Schuldfrage.
- 3.1 Definition der Schuld.
- 3.2,,Als der Krieg zu Ende war"
- 4. Nachwort....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Max Frischs dramatisches Frühwerk „Als der Krieg zu Ende war“ im Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie untersucht die Erfahrungen und Erlebnisse des Autors und seiner Zeitgenossen im Hinblick auf die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Dabei werden die Tagebucheinträge Frischs aus der Zeit von 1946 bis 1949 in Beziehung zu den Inhalten des Dramas gesetzt.
- Das Drama als Reflexion der Nachkriegszeit
- Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die deutsche Gesellschaft
- Die Thematik der Schuld und Verantwortung
- Der Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus
- Die Suche nach einem neuen Anfang
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das dramatische Frühwerk „Als der Krieg zu Ende war“ von Max Frisch als historisches Stück vor und erläutert den Kontext der Nachkriegszeit. Der Autor bezieht sich dabei auf die Erlebnisse seines Gastwirtes Frank sowie auf eigene Erfahrungen und Beobachtungen aus seinem Tagebuch der Jahre 1946-1949. Die Thematiken der Nachkriegsliteratur, wie z.B. Holocaust, Trümmer, Armut, Elend, Hunger, Kriegsgefangene, Heimkehrer, Zerstörung, Besatzung und die Schuldfrage, werden in der Einleitung kurz umrissen und als Schwerpunkte der Analyse benannt.
2. Erlebnisse aus der Nachkriegszeit 1946-1949
Dieses Kapitel befasst sich mit den Erfahrungen, die Max Frisch in der unmittelbaren Nachkriegszeit gemacht hat. Es werden einzelne Erlebnisse aus seinem Tagebuch 1946-1949 dargestellt und mit Textpassagen aus dem Stück „Als der Krieg zu Ende war“ verknüpft. Die Themenbereiche, die in diesem Kapitel behandelt werden, umfassen die Zerstörung und die Trümmerlandschaft, Armut und Hunger, die Erfahrungen mit dem Holocaust, die Besatzung und die Rückkehr der Kriegsgefangenen und Heimkehrer.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Max Frisch, „Als der Krieg zu Ende war“, Nachkriegszeit, Tagebuch, Holocaust, Schuld, Verantwortung, Zerstörung, Trümmer, Armut, Elend, Hunger, Besatzung, Kriegsgefangene, Heimkehrer, Berlin, Deutschland, Schweiz.
Worauf basiert Max Frischs Drama „Als der Krieg zu Ende war“?
Das Stück basiert auf Erzählungen über die russische Besatzungszeit und ist eng mit Frischs eigenen Tagebucheinträgen aus den Jahren 1946 bis 1949 verknüpft.
Welche zentralen Themen der Nachkriegszeit werden analysiert?
Die Arbeit behandelt Themen wie Trümmerlandschaften, Hunger, Holocaust, Besatzung, Kriegsgefangenschaft und die Frage nach der Schuld.
Wie wird die Schuldfrage in der Hausarbeit behandelt?
Es wird untersucht, wer oder was die Verantwortung für die Verbrechen trägt, basierend auf einer strukturellen Textanalyse des Dramas.
Welche Rolle spielen die Tagebücher von Max Frisch für diese Arbeit?
Die Tagebücher dienen als authentische Quelle für die Erlebnisse zwischen 1946 und 1949 und werden direkt mit den Szenen des Dramas verglichen.
Wann und wo fand die Uraufführung des Stücks statt?
Die Uraufführung fand im Januar 1949 im Züricher Schauspielhaus statt.