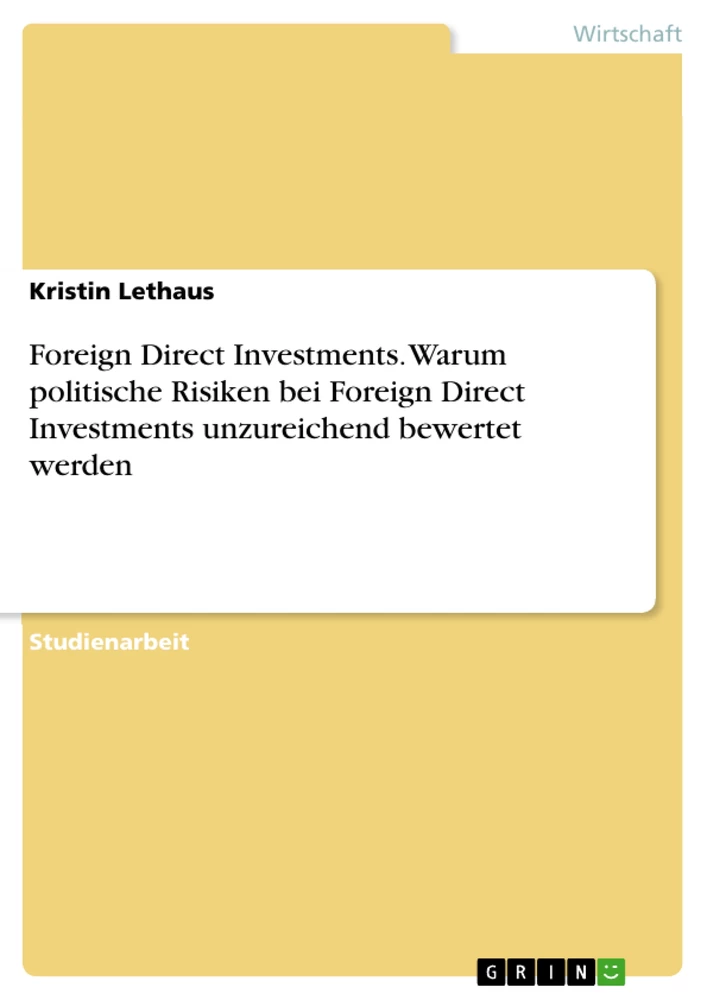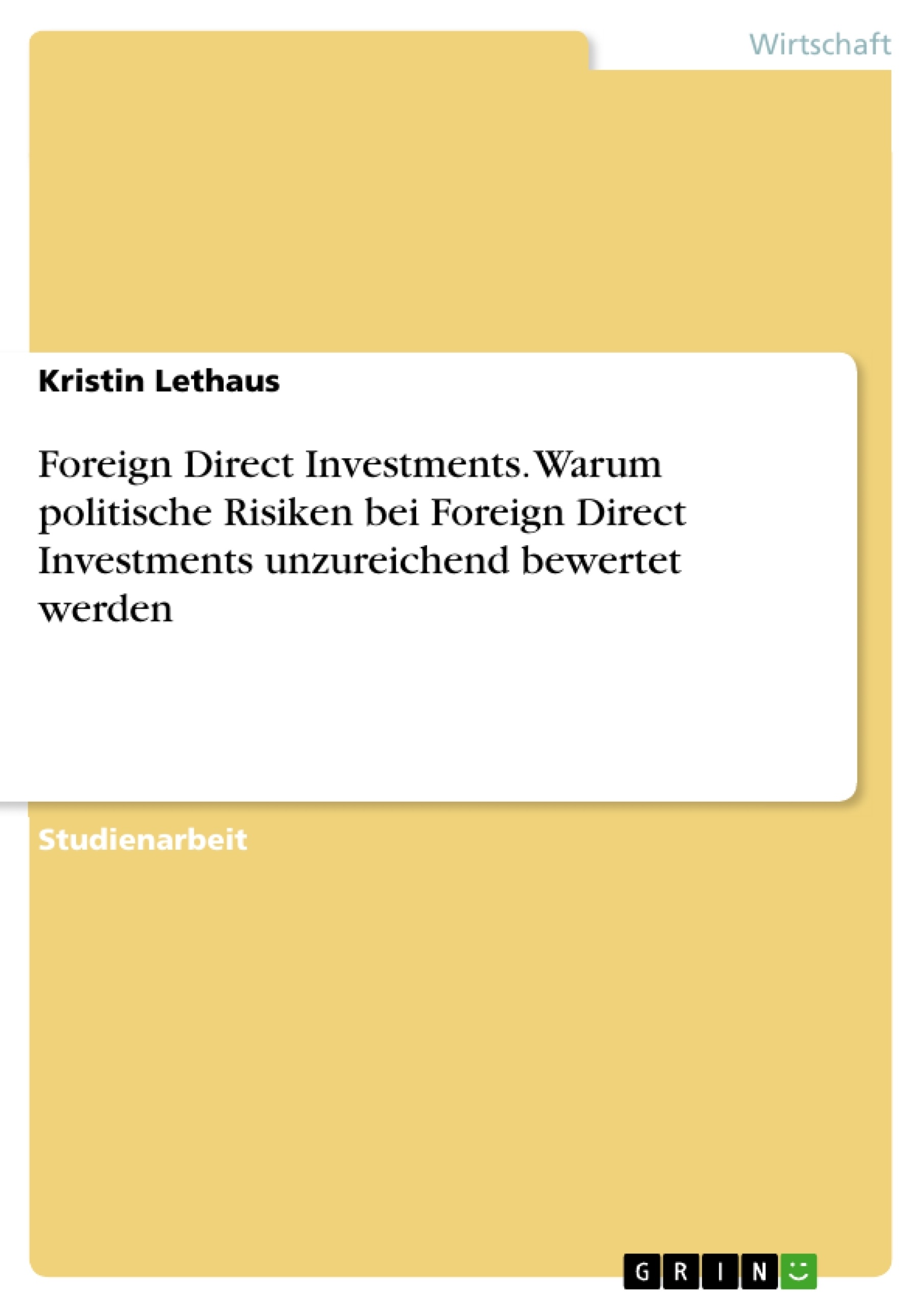Während die Entscheidung für Foreign Direct Investments oftmals von zahlreichen Motiven getrieben wird, beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit den damit verbundenen politischen Risiken. Trotz der hohen Bedeutung politischer Risiken bei ausländischen Direktinvestitionen findet aktuell sowohl in der wissenschaftlichen Betrachtung als auch in der Unternehmenspraxis eine unzureichende ganzheitliche Bewertung statt. Die Sensibilisierung im Umgang mit politischen Risiken soll zu einer ganzheitlichen Bewertungsbasis bei Foreign Direct Investments führen.
Inhaltsverzeichnis
- Vielversprechende Chancen von Foreign Direct Investments?
- Motivbündel seitens der Unternehmen
- Motivbündel seitens des Ziellandes
- Zielkonflikte
- Politische Risiken im Überblick
- Aktuelle politische Risikolage
- Zusammenhang zwischen politischen Risiken und FDIs
- Unzureichende Objektivität der qualitativen Bewertungsfaktoren
- Einflussfaktoren
- Ausprägungsart
- Due Diligence-Aktivitäten
- Die Versuche der quantitativen Bewertung
- Modifizierung zukünftiger Cashflows
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag untersucht die unzureichende Bewertung politischer Risiken bei Foreign Direct Investments (FDIs). Ziel ist es, die Sensibilisierung für diese Risiken zu erhöhen und zu einer ganzheitlicheren Bewertungsbasis für FDI-Entscheidungen beizutragen.
- Chancen und Motive von FDIs für Unternehmen und Zielländer
- Zielkonflikte und politische Risiken bei FDIs
- Qualitative und quantitative Bewertungsmethoden für politische Risiken
- Die Rolle von Due Diligence bei der Risikominderung
- Der Zusammenhang zwischen politischem Risiko und FDI-Stocks
Zusammenfassung der Kapitel
Vielversprechende Chancen von Foreign Direct Investments?: Der Abschnitt beschreibt den weltweiten Anstieg von Foreign Direct Investments (FDIs), insbesondere von grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. Er benennt die Liberalisierung der Kapitalmärkte und die zunehmende globale Integration als begünstigende Faktoren. Die Unvollkommenheit des Heimatmarktes wird als treibende Kraft für FDIs hervorgehoben, die zu einem vielfältigen Motivbündel bei Unternehmen führt, darunter die Reduzierung von Transaktionskosten, Resource Seeking, Market Seeking, Efficiency Seeking und Strategic Asset Seeking. Auch für das Zielland werden Chancen wie steigende Produktionsfaktoren, wirtschaftliche Diversifizierung, positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Verbesserung der Zahlungsbilanz und Know-how-Transfer genannt. Der Abschnitt endet mit der Feststellung, dass das Bild von FDIs durch die zahlreichen Motive zu positiv gezeichnet wird.
Motivbündel seitens der Unternehmen: Dieser Abschnitt detailliert die verschiedenen Motive von Unternehmen für Foreign Direct Investments. Es werden Chancen wie die Reduzierung von Transaktionskosten, die Suche nach Ressourcen (Resource Seeking) durch vertikale Integration, die Erschließung neuer Absatzmärkte (Market Seeking), die Senkung der Produktionskosten (Efficiency Seeking) und die Sicherung strategischer Positionen (Strategic Asset Seeking) erläutert. Als Beispiel wird der Anstieg ausländischer Direktinvestitionen im energieintensiven US-amerikanischen Chemiesektor aufgrund der Fracking-Methode genannt, der einen deutlichen Anstieg des amerikanischen Anteils an weltweiten Greenfield-Investments zeigt.
Motivbündel seitens des Ziellandes: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Vorteile, die ein Zielland durch ausländische Direktinvestitionen erfährt. Es werden der Zuwachs an Produktionsfaktoren, die Etablierung von Produktionsstufen und die damit verbundene wirtschaftliche Diversifizierung als positive Aspekte hervorgehoben. Zusätzliche Vorteile umfassen positive Effekte auf den Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum, eine Verbesserung der Zahlungsbilanz, Technologie- und Know-how-Transfer sowie erhöhte Steuereinnahmen. Die Darstellung betont die positiven Auswirkungen für das Zielland.
Zielkonflikte: Der Abschnitt betont, dass FDIs nicht automatisch Win-win-Situationen sind. Er beschreibt potenzielle Zielkonflikte zwischen dem investierenden Unternehmen und dem Zielland. Beispielsweise kann das Unternehmen auf Kostensenkung abzielen, während das Zielland zusätzliche Steuereinnahmen generieren möchte. Mögliche negative Folgen für das Zielland, wie die Verdrängung einheimischer Unternehmen und Kontrollverlust über die Wirtschaft, werden ebenso thematisiert wie die Länderrisiken (mikro- und makroökonomische sowie wirtschaftspolitische Risiken) für das internationale Unternehmen. Grenzüberschreitende M&As werden als besonders politisch sensibel dargestellt, wobei politische Risiken im Fokus stehen.
Politische Risiken im Überblick: Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über politische Risiken im Kontext von FDIs. Es wird der Unterschied in der Definition von politischen Risiken in der Versicherungswirtschaft (Gefahrenumstände in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und politische Lage) und im Außenhandel (Verlustgefahr aufgrund der politischen Situation im Zielland) verdeutlicht. Aktuelle Beispiele wie die Russland-Ukraine-Krise werden erwähnt, um die Bedeutung der Thematik zu unterstreichen.
Aktuelle politische Risikolage: Dieser Abschnitt beleuchtet die aktuelle weltweite politische Risikolage und ihren Einfluss auf FDI-Inflows. Nordafrika (mit Ausnahme von Sudan und Marokko) wird als Beispiel für sinkende Inflows aufgrund politischer Risiken und sozialer Spannungen genannt. Im Gegensatz dazu werden Länder wie Kuwait und Irak erwähnt, die trotz regionaler Spannungen Rekordwerte erreichten. Der Einfluss politischer Instabilität, am Beispiel Thailands, auf FDI-Projekte wird dargestellt, wobei trotz unterbrochener Projekte ein Anstieg der FDI-Inflows verzeichnet wurde. Eine Weltkarte mit Risikoklassifizierung wird als Quelle für die Darstellung der politischen Risikolage verwendet.
Zusammenhang zwischen politischen Risiken und FDIs: Hier wird die Analyse des Zusammenhangs zwischen politischem Risiko und FDIs mithilfe des Political Risk Index der PRS Group und FDI-Stocks der UNCTAD für das Jahr 2013 beschrieben. Es wird ein signifikanter Zusammenhang zwischen politischem Risiko und FDI Inward Stocks festgestellt, wobei etwa 6,9% der FDI-Stocks durch das politische Risikoniveau erklärt werden können. Die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Risikomanagers bei FDI-Entscheidungen wird betont, um eine ganzheitliche Bewertung unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Risikofaktoren zu gewährleisten.
Unzureichende Objektivität der qualitativen Bewertungsfaktoren: Dieser Teil befasst sich mit der qualitativen Bewertung von politischen Risiken. Es werden sozioökonomische Einflussfaktoren wie das politische System, die politische und ökonomische Integration, die religiöse und ethnische Stabilität, die regionale Sicherheit und die Wirtschaftslage genannt. Die Schwierigkeit einer objektiven Bewertung und die subjektive Basis vieler Beurteilungen werden hervorgehoben. Beispiele wie Diktaturen und häufige Regierungswechsel in Italien werden zur Veranschaulichung der Problematik genannt.
Einflussfaktoren: Dieser Abschnitt listet detailliert sozio-ökonomische Einflussfaktoren auf, die von Risikomanagern bei der Bewertung von politischen Risiken berücksichtigt werden sollten. Diese umfassen das politische System und die Regierungsarbeit, die politische und ökonomische Integration in internationale Organisationen, die religiöse und ethnische Stabilität, die regionale Sicherheit und die Wirtschaftslage. Die Schwierigkeit einer objektiven Bewertung dieser Faktoren wird ebenfalls angesprochen.
Ausprägungsart: Hier werden verschiedene Ausprägungen von politischen Risiken erläutert: Fiskalrisiko, Enteignungsrisiko (einschliesslich "De-facto-Enteignungen"), Transferrisiko, Dispositionsrisiko, (Wirtschafts-)Kriminalitätsrisiko, Terrorismusrisiko und Korruptionsrisiko. Die Diskussion beinhaltet konkrete Beispiele wie die Verstaatlichung der Erdgasförderung in Bolivien und die Problematik latenter Enteignung durch Steuern und Zölle. Die Komplexität der Bewertung dieser Risiken wird hervorgehoben.
Due Diligence-Aktivitäten: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle der Due Diligence bei der Bewertung politischer Risiken. Es wird festgestellt, dass eine risikoadäquate Beurteilung politischer Risiken oft fehlt, obwohl verschiedene Due Diligence-Arten (Financial, Tax, Legal, Market etc.) durchgeführt werden. Die Legal Due Diligence wird als potenzieller Ansatzpunkt für die Berücksichtigung von Länderrisiken genannt, jedoch wird ihre unzureichende Fokussierung auf politische Risiken kritisiert. Die Market Due Diligence wird ebenfalls als relevant erachtet, obwohl die Berücksichtigung der globalen und politischen Umwelt in der Praxis oft vernachlässigt wird.
Die Versuche der quantitativen Bewertung: Dieser Abschnitt betrachtet quantitative Bewertungsmethoden für politische Risiken. Der "Zuschlag aus Risikogründen" bei Auslandsakquisitionen und länderspezifische Ratings werden als Ansätze diskutiert. Klassische Ratings wie der politische Risikoindex der PRS Group und der Business Risk Service des Beri-Instituts werden vorgestellt, aber auch deren Kritikpunkte hinsichtlich subjektiver Kriterien und mangelnder unternehmens- oder branchenspezifischer Informationen werden angesprochen. Die Notwendigkeit einer unternehmensspezifischen Bewertung wird hervorgehoben.
Modifizierung zukünftiger Cashflows: Der letzte Abschnitt behandelt die Modifizierung des Net Present Value (NPV) zur Berücksichtigung politischer Risiken. Die Subtraktion von Versicherungsprämien von den zukünftigen Cashflows und die Modifizierung des Eigenkapitalzinssatzes werden als Ansätze vorgestellt. Die Problematik, dass Versicherungsschutz nicht immer den gesamten Schaden abdeckt, wird angesprochen. Die Modifizierung der Risikoprämie im CAPM-Modell als Reaktion auf aufstrebende Märkte wird erwähnt.
Schlüsselwörter
Foreign Direct Investments (FDIs), politische Risiken, Länderrisiko, Risikomanagement, Due Diligence, qualitative Bewertung, quantitative Bewertung, Political Risk Index, FDI-Stocks, Enteignungsrisiko, Transferrisiko, Regressionsanalyse, Net Present Value, CAPM-Modell.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Unzureichende Bewertung Politischer Risiken bei Foreign Direct Investments
Was ist der Gegenstand dieses Beitrags?
Der Beitrag untersucht die unzureichende Bewertung politischer Risiken bei Foreign Direct Investments (FDIs) und zielt darauf ab, die Sensibilisierung für diese Risiken zu erhöhen und zu einer ganzheitlicheren Bewertungsbasis für FDI-Entscheidungen beizutragen.
Welche Chancen und Motive von FDIs werden behandelt?
Der Beitrag beleuchtet die Chancen von FDIs für Unternehmen (Reduzierung von Transaktionskosten, Ressourcensuche, Markterschließung, Effizienzsteigerung, Sicherung strategischer Positionen) und Zielländer (Produktionsfaktorenzuwachs, wirtschaftliche Diversifizierung, positive Arbeitsmarkteffekte, Zahlungsbilanzverbesserung, Know-how-Transfer). Es wird jedoch betont, dass das Bild der Vorteile oft zu positiv gezeichnet ist.
Welche Zielkonflikte und politischen Risiken bei FDIs werden beschrieben?
Der Beitrag beschreibt potenzielle Zielkonflikte zwischen Unternehmen und Zielländern (z.B. Kostensenkung vs. Steuereinnahmen). Negative Folgen für Zielländer wie die Verdrängung einheimischer Unternehmen und der Kontrollverlust über die Wirtschaft werden ebenso thematisiert wie Länderrisiken (mikro- und makroökonomische sowie wirtschaftspolitische Risiken) für Unternehmen. Grenzüberschreitende M&As werden als besonders politisch sensibel dargestellt.
Wie werden politische Risiken definiert und eingeordnet?
Der Beitrag differenziert zwischen der Definition von politischen Risiken in der Versicherungswirtschaft (Gefahrenumstände in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und politische Lage) und im Außenhandel (Verlustgefahr aufgrund der politischen Situation im Zielland). Aktuelle Beispiele wie die Russland-Ukraine-Krise verdeutlichen die Bedeutung dieser Risiken.
Welche Methoden zur Bewertung politischer Risiken werden diskutiert?
Der Beitrag untersucht sowohl qualitative (sozioökonomische Faktoren wie politisches System, Integration, religiöse und ethnische Stabilität, regionale Sicherheit, Wirtschaftslage) als auch quantitative Bewertungsmethoden (z.B. "Zuschlag aus Risikogründen", länderspezifische Ratings wie der Political Risk Index der PRS Group, Business Risk Service des Beri-Instituts). Die Schwierigkeiten einer objektiven Bewertung und die Notwendigkeit einer unternehmensspezifischen Bewertung werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Due Diligence bei der Risikominderung?
Der Beitrag analysiert die Rolle von Due Diligence (Financial, Tax, Legal, Market etc.) und kritisiert die oft unzureichende Berücksichtigung politischer Risiken. Legal Due Diligence und Market Due Diligence werden als potenzielle Ansatzpunkte genannt, deren Fokus auf politische Risiken jedoch oft fehlt.
Wie kann man zukünftige Cashflows an politische Risiken anpassen?
Der Beitrag schlägt die Modifizierung des Net Present Value (NPV) durch Subtraktion von Versicherungsprämien von zukünftigen Cashflows und die Modifizierung des Eigenkapitalzinssatzes vor. Die Problematik, dass Versicherungsschutz nicht immer den gesamten Schaden abdeckt, und die Modifizierung der Risikoprämie im CAPM-Modell als Reaktion auf aufstrebende Märkte werden ebenfalls angesprochen.
Welche Arten von politischen Risiken werden detailliert beschrieben?
Der Beitrag beschreibt verschiedene Ausprägungen von politischen Risiken: Fiskalrisiko, Enteignungsrisiko (einschließlich "De-facto-Enteignungen"), Transferrisiko, Dispositionsrisiko, (Wirtschafts-)Kriminalitätsrisiko, Terrorismusrisiko und Korruptionsrisiko. Konkrete Beispiele illustrieren die Komplexität dieser Risiken.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen politischen Risiken und FDI-Stocks?
Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen politischem Risiko (Political Risk Index der PRS Group) und FDI-Stocks (UNCTAD, 2013) zeigt einen signifikanten Zusammenhang. Etwa 6,9% der FDI-Stocks können durch das politische Risikoniveau erklärt werden. Die Notwendigkeit eines Risikomanagers für eine ganzheitliche Bewertung wird betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Beitrag?
Schlüsselwörter sind: Foreign Direct Investments (FDIs), politische Risiken, Länderrisiko, Risikomanagement, Due Diligence, qualitative Bewertung, quantitative Bewertung, Political Risk Index, FDI-Stocks, Enteignungsrisiko, Transferrisiko, Regressionsanalyse, Net Present Value, CAPM-Modell.
- Quote paper
- Kristin Lethaus (Author), 2014, Foreign Direct Investments. Warum politische Risiken bei Foreign Direct Investments unzureichend bewertet werden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1308718