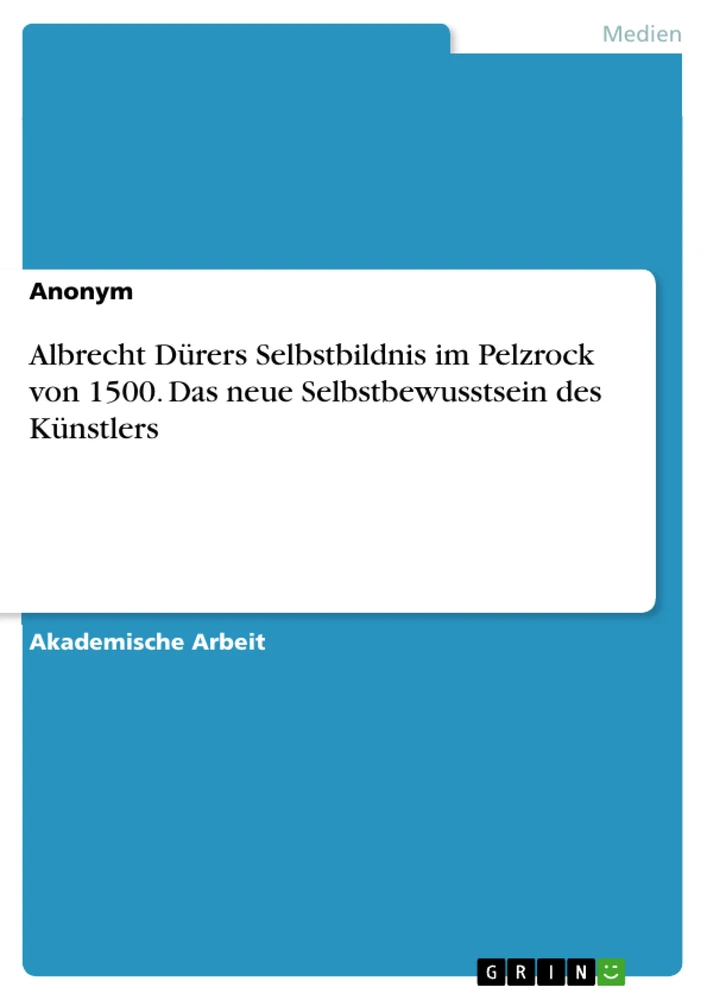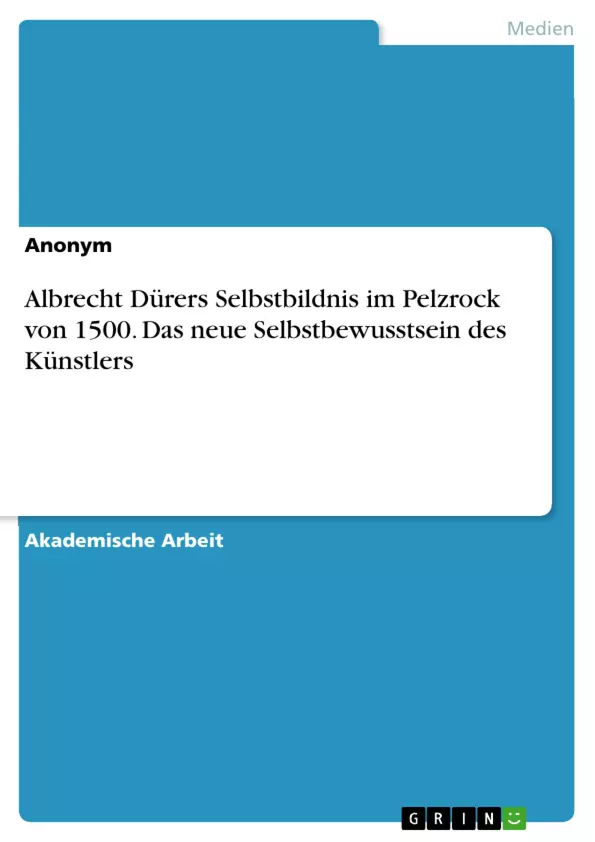Das berühmte Selbstbildnis im Pelzrock von Albrecht Dürer (1471-1528), gemalt im Jahre 1500 in Nürnberg, prägt unsere Vorstellung über den Künstler wie kein anderes Porträt. Es zählt zu den bekanntesten und rätselhaftesten Werken des Malers und der Kunstgeschichte überhaupt. Die ungewöhnliche Selbstporträtierung lässt im Vergleich zu seinen früheren Selbstbildnissen viele Fragen aufkommen. Die neue Art der Darstellung seiner Person vermittelt den Eindruck, dass Dürer einen gesellschaftlich höheren Status als Künstler einfordern möchte. Die vorliegende Arbeit stellt das Selbstbildnis vor und geht der Frage nach, inwiefern diese These bestätigt werden kann. Dabei werden die Antikenbezüge Dürers aufgezeigt, insbesondere die Rolle des antiken Malers Apelles, dessen Tradition er auf den ersten Blick zu verfolgen scheint. Hierbei wird beleuchtet, welche Absichten Dürer damit verfolgt haben könnte. Ebenso wird auf den Wandel des Selbstbewusstseins Dürers eingegangen, welcher im Zusammenhang mit den Veränderungen der Ansichten über den Menschen allgemein, insbesondere der Profession als Künstler, in der Zeitwende 1500 vom Spätmittelalter zur Neuzeit steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Selbstbildnis im Pelzrock
- 2.1 Bildbeschreibung
- 2.1.1 Inschrift
- 2.2 Bildanalyse
- 2.3 Die Antikenbezüge des Gemäldes
- 2.4 Dürer als der neue Apelles
- 2.5 Das neue Selbstbewusstsein Dürers
- 3. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock von 1500. Die Zielsetzung besteht darin, den gesellschaftlichen Statusanspruch Dürers als Künstler zu untersuchen und die Bedeutung der Antikenbezüge im Bild zu beleuchten. Die Analyse fokussiert auf den Wandel des Selbstbewusstseins Dürers im Kontext der Übergangszeit vom Spätmittelalter zur Renaissance.
- Dürers gesellschaftlicher Statusanspruch als Künstler
- Die Rolle der Antikenbezüge im Selbstbildnis
- Der Wandel des Selbstbewusstseins Dürers
- Die Bildbeschreibung und -analyse des Selbstbildnisses
- Die Bedeutung der Inschrift im Bildkontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt das berühmte Selbstbildnis Albrecht Dürers im Pelzrock von 1500 vor. Es wird die Bedeutung des Werkes für die Kunstgeschichte hervorgehoben und die Forschungsfrage formuliert, inwiefern das Bild Dürers Anspruch auf einen höheren gesellschaftlichen Status als Künstler widerspiegelt. Die Arbeit verspricht eine Analyse des Bildes unter Berücksichtigung der Antikenbezüge und des Wandels im Selbstverständnis des Künstlers an der Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit.
2. Das Selbstbildnis im Pelzrock: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des Selbstbildnisses. Die Bildbeschreibung umfasst die Darstellung Dürers als Halbfigur vor dunklem Hintergrund, seine Kleidung (Pelzrock, Hemd), die Lichtsetzung und die minutiöse Darstellung seiner Gesichtszüge. Die Inschrift in lateinischer Sprache wird interpretiert als Ausdruck humanistischer Bildung und des Anspruchs auf einen höheren gesellschaftlichen Status, inspiriert durch die Figur des antiken Malers Apelles. Die Analyse betrachtet die Komposition, die Symbolik der Kleidung und die direkte Ansprache des Betrachters als Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins des Künstlers.
Schlüsselwörter
Albrecht Dürer, Selbstbildnis, Pelzrock, 1500, Renaissance, Antike, Apelles, Selbstbewusstsein, Bildanalyse, Humanismus, Spätmittelalter, Kunstgeschichte, Bildbeschreibung, Inschrift, Gesellschaftlicher Status.
Häufig gestellte Fragen zum Selbstbildnis Dürers im Pelzrock
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock von 1500. Sie untersucht Dürers gesellschaftlichen Statusanspruch als Künstler und die Bedeutung der Antikenbezüge im Bild. Der Fokus liegt auf dem Wandel seines Selbstbewusstseins im Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Bildanalyse, eine Schlussbetrachtung und ein Inhaltsverzeichnis mit Kapitelzusammenfassungen.
Welche Themen werden im Selbstbildnis behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Dürers gesellschaftlicher Statusanspruch als Künstler, die Rolle der Antikenbezüge im Selbstbildnis, der Wandel seines Selbstbewusstseins, die Bildbeschreibung und -analyse, sowie die Bedeutung der Inschrift im Bildkontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Das Selbstbildnis im Pelzrock") mit Unterkapiteln zur Bildbeschreibung (inkl. Inschrift), Bildanalyse, den Antikenbezügen, Dürers Vergleich mit Apelles und seinem neuen Selbstbewusstsein, sowie eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Aspekte des Selbstbildnisses werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Bildbeschreibung (Darstellung, Kleidung, Lichtsetzung, Gesichtszüge), die Interpretation der lateinischen Inschrift, die Komposition des Bildes, die Symbolik der Kleidung, die direkte Ansprache des Betrachters und die Einordnung in den Kontext der Antike und des humanistischen Denkens.
Welche Bedeutung hat die Inschrift im Bild?
Die lateinische Inschrift wird als Ausdruck von Dürers humanistischer Bildung und seinem Anspruch auf einen höheren gesellschaftlichen Status interpretiert, inspiriert durch die Figur des antiken Malers Apelles.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Selbstbildnis Dürers seinen Anspruch auf einen höheren gesellschaftlichen Status als Künstler widerspiegelt und den Wandel seines Selbstbewusstseins im Kontext der Übergangszeit vom Spätmittelalter zur Renaissance verdeutlicht. Die Analyse der Antikenbezüge und die Interpretation der Inschrift unterstützen diese Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Albrecht Dürer, Selbstbildnis, Pelzrock, 1500, Renaissance, Antike, Apelles, Selbstbewusstsein, Bildanalyse, Humanismus, Spätmittelalter, Kunstgeschichte, Bildbeschreibung, Inschrift, Gesellschaftlicher Status.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock von 1500. Das neue Selbstbewusstsein des Künstlers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1308741