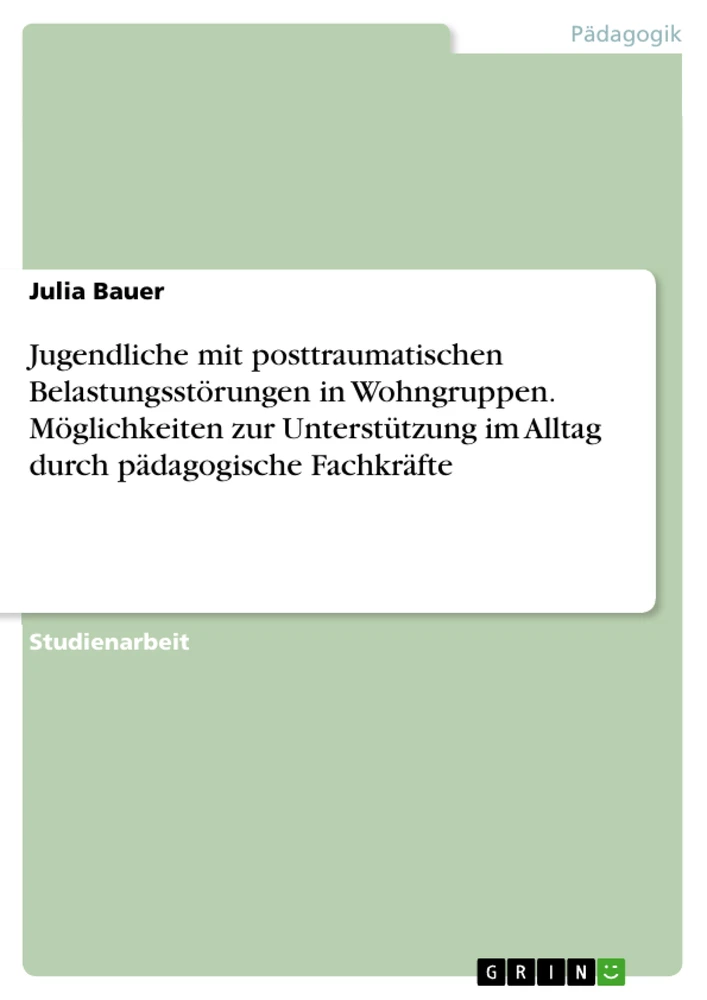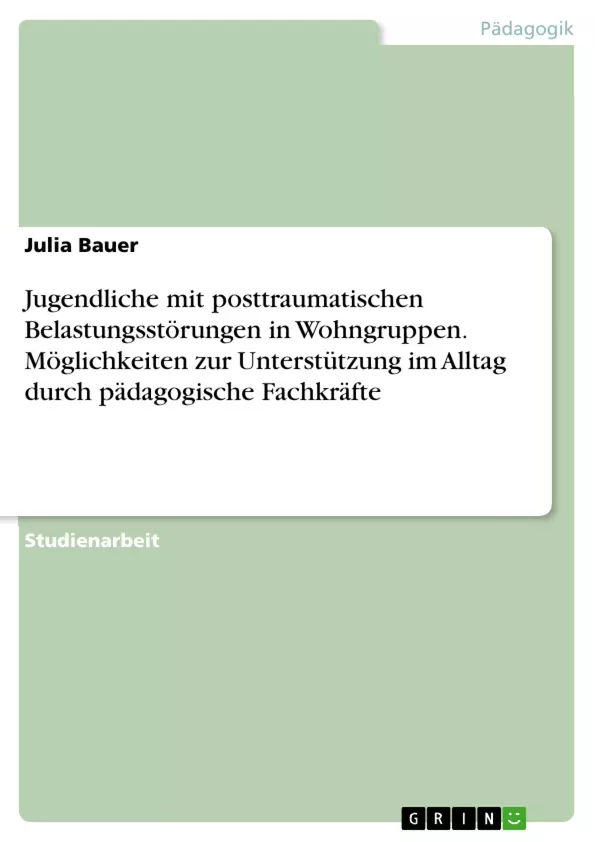Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern pädagogische Fachkräfte Jugendliche mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) in einer Wohngruppe im Alltag unterstützen können.
Im Folgenden werden zunächst die medizinischen Inhalte der posttraumatischen Belastungsstörung näher beleuchtet. Dabei wird auf die Definition, die Symptomatik, Ursachen und Auswirkungen eingegangen. Des Weiteren werden die Diagnose und die Behandlung geschildert. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der pädagogischen Arbeit im Zusammenhang mit dem Störungsbild. Hierbei liegt der Schwerpunkt vor allem bei den Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte und die Unterstützung dieser für Betroffene bei der Alltagsbewältigung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Trauma
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung
- Neurologische Entstehung eines Traumas
- Symptome
- Lebenslange Auswirkungen
- Risikofaktoren
- Diagnose
- Behandlung
- Pädagogische Arbeit im Zusammenhang mit Posttraumatischer Belastungsstörung
- Fallbeispiel
- SAFER Modell in der Wohngruppe
- Traumapädagogik
- Traumasensible Grundhaltung
- Der sichere Ort
- Expertenschaft
- Psychoedukation
- Kooperation mit verschiedenen Instanzen
- Kooperation mit psychologischen und psychotherapeutischen Fachkräften
- Kooperation mit den Eltern
- Kooperation mit anderen Hilfen der Erziehung
- Kooperation im internen Team
- Achtsamkeit als pädagogische Fachkraft
- Sekundärtraumatisierung
- Selbstfürsorge
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern pädagogische Fachkräfte Jugendliche mit einer posttraumatischen Belastungsstörung in einer Wohngruppe im Alltag unterstützen können.
- Definition und Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung
- Neurologische Entstehung eines Traumas
- Risikofaktoren und Auswirkungen der Störung
- Traumasensible Grundhaltung und pädagogische Ansätze
- Kooperation und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei Jugendlichen in Wohngruppen dar und beleuchtet den Mangel an Fachliteratur zu diesem Thema. Die Arbeit fokussiert auf die Unterstützungsmöglichkeiten pädagogischer Fachkräfte.
Im ersten Teil der Arbeit werden medizinische Inhalte der PTBS beleuchtet, beginnend mit der Definition des Begriffs "Trauma". Die Entstehung der PTBS wird erläutert, inklusive der neurologischen Prozesse und der Auswirkungen auf den Betroffenen. Weiterhin werden Symptome, Risikofaktoren, Diagnostik und Behandlung der Störung behandelt.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der pädagogischen Arbeit im Kontext der PTBS. Hier werden das SAFER-Modell in der Wohngruppe vorgestellt und verschiedene Aspekte der Traumapädagogik besprochen, wie z.B. die traumasensible Grundhaltung, der sichere Ort, Expertenschaft, Psychoedukation und die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt das Thema Posttraumatische Belastungsstörung bei Jugendlichen in Wohngruppen, insbesondere die Rolle und Unterstützungsmöglichkeiten pädagogischer Fachkräfte. Wichtige Schlüsselwörter sind: Trauma, Posttraumatische Belastungsstörung, Traumapädagogik, SAFER-Modell, sichere Bindung, Selbstfürsorge, Sekundärtraumatisierung, psychologische und psychotherapeutische Fachkräfte, Kooperation, Wohngruppe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)?
PTBS ist eine psychische Erkrankung, die nach einem traumatischen Erlebnis auftreten kann. Sie äußert sich durch Symptome wie Flashbacks, Albträume und emotionale Taubheit.
Wie können pädagogische Fachkräfte Jugendliche mit PTBS unterstützen?
Fachkräfte unterstützen durch eine traumasensible Grundhaltung, die Schaffung eines „sicheren Ortes“ und die Förderung von Selbstwirksamkeit im Alltag der Wohngruppe.
Was beinhaltet das SAFER-Modell in der Wohngruppe?
Das SAFER-Modell dient als Leitfaden für pädagogisches Handeln, um Sicherheit zu gewährleisten, Affekte zu stabilisieren und eine verlässliche Struktur für traumatisierte Jugendliche zu bieten.
Was bedeutet Psychoedukation im Kontext von Trauma?
Psychoedukation bedeutet, den Betroffenen ihre Symptome und die neurologischen Hintergründe des Traumas verständlich zu erklären, um Scham abzubauen und die Heilung zu fördern.
Warum ist Selbstfürsorge für Fachkräfte in der Traumapädagogik wichtig?
Die Arbeit mit traumatisierten Jugendlichen birgt das Risiko einer Sekundärtraumatisierung. Selbstfürsorge und Achtsamkeit sind notwendig, um die eigene psychische Gesundheit zu erhalten.
Welche Rolle spielt die Kooperation mit Eltern und Therapeuten?
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Wohngruppe, Eltern und Therapeuten ist essenziell, um ein konsistentes Hilfesystem zu schaffen und den Jugendlichen bestmöglich zu stabilisieren.
- Arbeit zitieren
- Julia Bauer (Autor:in), 2022, Jugendliche mit posttraumatischen Belastungsstörungen in Wohngruppen. Möglichkeiten zur Unterstützung im Alltag durch pädagogische Fachkräfte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1308745