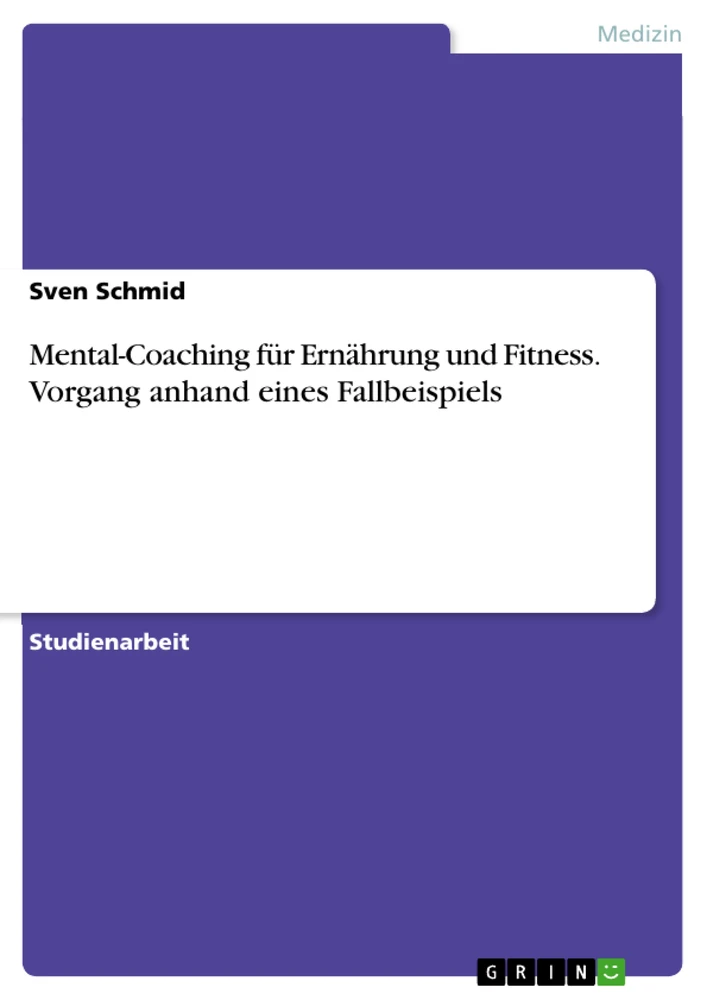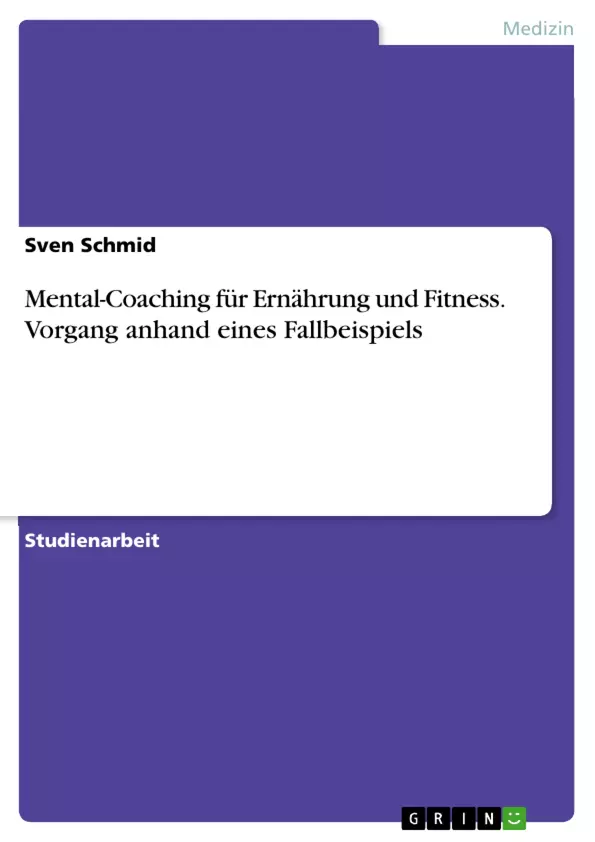In der vorliegenden Arbeit wird erklärt, was bei einem Mental-Coaching passiert und geklärt, mit welchen Erwartungen die beispielhafte Klientin zu mir gekommen ist. Es wird klargemacht, dass wir als Coaches die Aufgabe haben, unsere Klienten so zu helfen/leiten, dass sie selbst auf die Lösung ihrer Probleme kommen und nicht der Coach selbst. Nach den vereinbarten Sitzungen soll der Kunde selbst in der Lage sein, weiter sein Ziel zu verfolgen und zu erreichen. Der Coach dient im Endeffekt als Hilfe zur Selbsthilfe.
Bei der Beispielkundin handelt es sich um Steffi M., eine 45 Jahre alte Frau und Mutter der es schwer fällt abzunehmen, ihr Gewicht zu halten und sich sportlich zu betätigen, um sich wohler und fitter zu fühlen als auch den Alltag besser bewältigen zu können. Sie ist zwar seit einiger Zeit in einem Fitnessstudio angemeldet und hat sich ein Fahrrad zugelegt doch die Motivation verflog schon nach kurzer Zeit. Sie möchte außerdem wieder mit ihren Kindern und ihrem Mann in die Berge gehen zum wandern und möchte das genießen und sich nicht quälen müssen.
Steffi schrieb mir eine Mail worauf kurze Zeit später ein Telefongespräch folgte, in dem sie mir ihr Anliegen schilderte. Darauf habe ich sie zu einem Erstgespräch eingeladen, wofür sie mir auch gleich im Voraus das vereinbarte Honorar überwies. Steffi kommt also zum vereinbarten Termin zum Erstgespräch. Wichtig ist, dass man sich erst einmal gegenseitig kennenlernt. Anschließend soll durch aktives Zuhören, eine wertschätzende Haltung und empathisches Spiegeln ein Draht zueinander (den sogenannten Rapport) aufgebaut werden.
Der Kunde soll im Endeffekt dort abgeholt werden, wo er steht. Beim aktiven Zuhören sollte man nach Bay ehrliches Interesse zeigen, nicht beurteilen und nicht dirigistisch sein. Man soll eine echte Absicht haben den Partner zu verstehen und stets bemüht sein, das Gespräch objektiv sowie kontrolliert zu führen. Oft ist es auch sinnvoll, das Gesagte des Klienten nochmals in eigenen Worten zu wiederholen.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung des Themas und Charakterisierung der Klientin
- Darstellung des Themas und der Beratung
- Planung und Organisation des Coachings
- Darstellung des Ablaufes von fünf Coaching Sitzungen
- Ausführliche Darstellung einer Ausgewählten Sitzung
- Ergebnisbewertung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Mental Coaching im Bereich Ernährung und analysiert die Fallstudie einer Klientin, die Schwierigkeiten mit dem Abnehmen und der sportlichen Aktivität hat.
- Die Herausforderungen der Klientin bei der Gewichtsabnahme und körperlichen Aktivität
- Die Bedeutung des Mental Coachings in der Gewichtsabnahme und Motivationssteigerung
- Die Anwendung des GROW+G-Modells im Coaching-Prozess
- Die praktische Umsetzung des Coachings in Form von fünf Sitzungen
- Die Bewertung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Coaching-Prozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Darstellung des Themas und Charakterisierung der Klientin: Dieses Kapitel stellt die Klientin Steffi M. vor und beschreibt ihre Motivation für das Coaching. Es geht auf ihre Schwierigkeiten mit der Gewichtsabnahme und der sportlichen Aktivität ein und erläutert die Hintergründe ihres Anliegens.
- Planung und Organisation des Coachings: Dieses Kapitel beleuchtet die Planung und Organisation des Coachings. Es werden Themen wie die Anzahl der Sitzungen, die Dauer, der Ort und die Kosten des Coachings behandelt. Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung der Vorgehensweise und der vereinbarten Rahmenbedingungen.
- Darstellung des Ablaufes von fünf Coaching Sitzungen: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der fünf Coaching Sitzungen. Es werden die einzelnen Phasen des GROW+G-Modells vorgestellt und die Methodik der Goal-Setting, des Reality-Checking, der Optionsfindung und der Handlungsplanung erläutert.
Schlüsselwörter
Mental Coaching, Ernährung, Gewichtsabnahme, Motivation, Sport, GROW+G-Modell, Coaching Sitzungen, Zielsetzung, Reality-Checking, Optionsfindung, Handlungsplanung, Klientenorientierung, Selbstwirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Mental-Coaching im Bereich Ernährung?
Das Ziel ist die "Hilfe zur Selbsthilfe". Der Coach leitet den Klienten an, selbst Lösungen für Probleme wie Motivationsmangel oder Schwierigkeiten bei der Gewichtsabnahme zu finden.
Was bedeutet "Rapport" im Coaching-Gespräch?
Rapport bezeichnet den Aufbau eines vertrauensvollen "Drahtes" zwischen Coach und Klient durch aktives Zuhören, Wertschätzung und empathisches Spiegeln.
Was ist das GROW+G-Modell?
Es ist ein strukturiertes Coaching-Modell, das die Phasen Goal-Setting (Zielsetzung), Reality-Checking (Ist-Zustand), Optionsfindung (Möglichkeiten) und Handlungsplanung (Will) umfasst.
Wie läuft ein Erstgespräch beim Mental-Coaching ab?
Im Erstgespräch steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Der Coach hört aktiv zu, zeigt ehrliches Interesse und versucht, die Bedürfnisse des Klienten objektiv zu erfassen.
Warum ist aktives Zuhören für den Coach so wichtig?
Aktives Zuhören stellt sicher, dass der Klient sich verstanden fühlt, nicht beurteilt wird und der Coach die Situation objektiv erfassen kann, um den Klienten richtig "abzuholen".
- Quote paper
- Sven Schmid (Author), 2019, Mental-Coaching für Ernährung und Fitness. Vorgang anhand eines Fallbeispiels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1308821