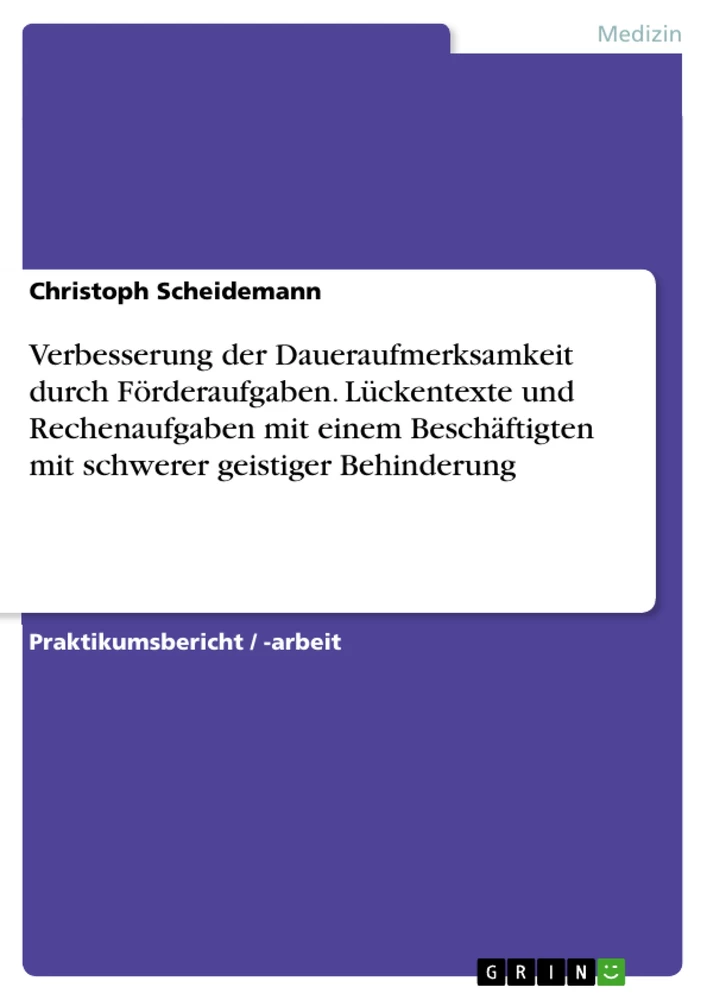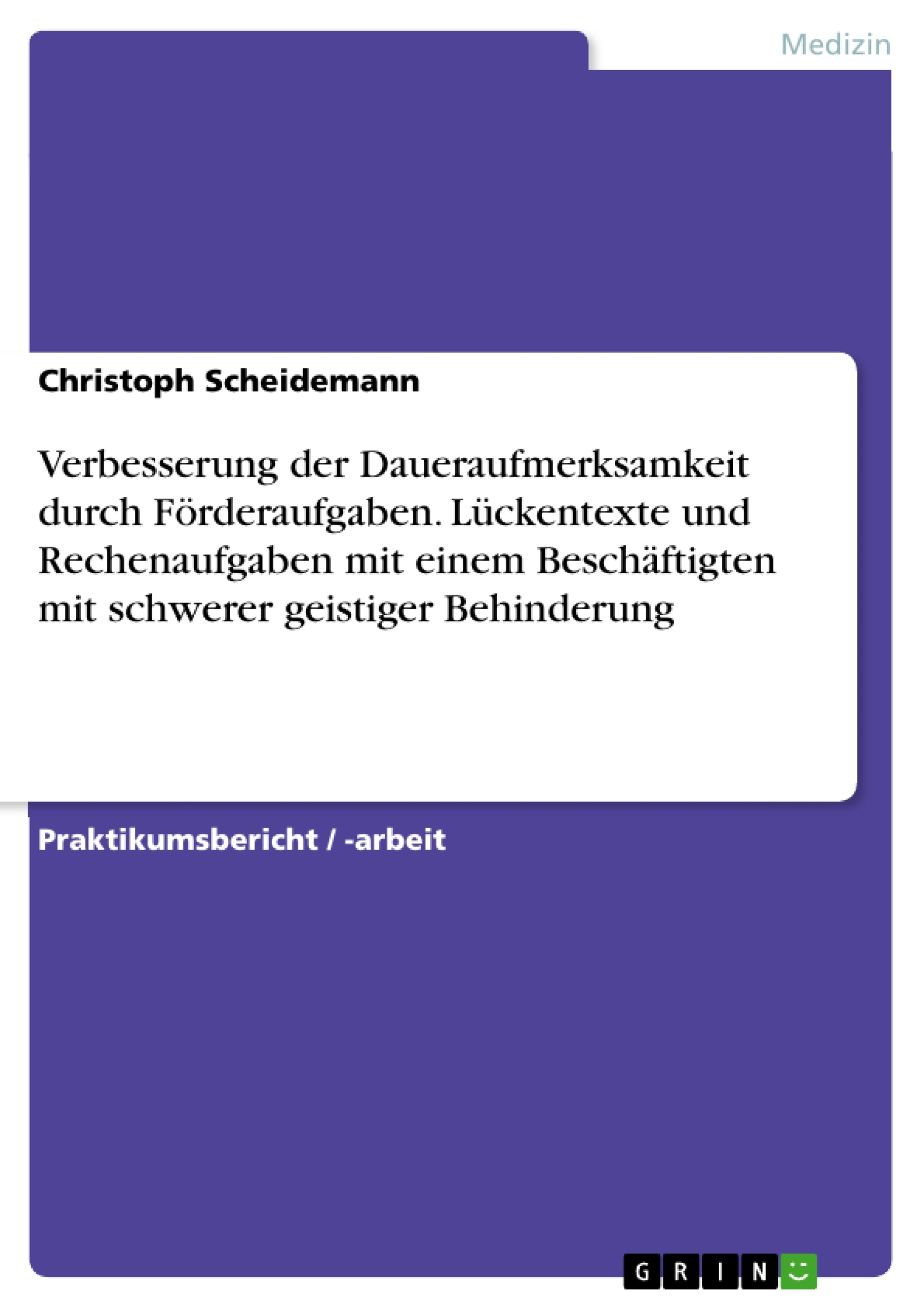Das Thema der Aktivität lautet: Verbesserung der Daueraufmerksamkeit durch Förderaufgaben in einer 1:1 Betreuung mittels einfachen Lückentexten und Rechenaufgaben mit einem Beschäftigten, der eine schwere geistige Behinderung und eine daraus resultierende Konzentrationsschwäche aufweist.
Das Ziel wurde erreicht. Herr M. hat mit Hilfe meiner Unterstützung den Lückentext, die Rechenaufgaben und das Tic-Tac-Toe Spiel zur Verbesserung seiner Daueraufmerksamkeit durchgeführt. Ich würde dieses Ziel noch einmal wählen, da es dem Förderziel von Herrn M. entspricht und man die Aktivität problemlos in den Arbeitsalltag von Herrn M. integrieren kann.
Das erste Förderziel von Herrn M. lautet „Verbesserung der Daueraufmerksamkeit / Konzentrationsvermögen bei einfachen Aufgaben“. Daher bin ich der Meinung, dass ich mein SMART-Ziel passend zu seinen aktuellen Handlungszielen formuliert habe.
Inhaltsverzeichnis
- Reflexion der bedarfsorientierten, zielgerichteten (Förder-)Aktivität
- Ziele
- Situationsanalyse
- Methodisches Handeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Reflexion beschreibt eine Förderaktivität mit einem Beschäftigten (Herr M.), der eine schwere geistige Behinderung und daraus resultierende Konzentrationsschwäche aufweist. Hauptziel war die Verbesserung der Daueraufmerksamkeit durch einfache Lückentext- und Rechenaufgaben in einer 1:1-Betreuung. Die Reflexion analysiert die Wirksamkeit der gewählten Methode, identifiziert Stärken und Schwächen des Vorgehens und zieht Schlussfolgerungen für zukünftige Aktivitäten.
- Verbesserung der Daueraufmerksamkeit bei Herrn M.
- Analyse der Wirksamkeit von 1:1-Förderung bei geistiger Behinderung
- Bewertung der gewählten Methoden (Lückentext, Rechenaufgaben, Spiel)
- Reflexion des methodischen Vorgehens und der Kommunikation
- Identifizierung von Stärken und Schwächen in der Förderaktivität
Zusammenfassung der Kapitel
Reflexion der bedarfsorientierten, zielgerichteten (Förder-)Aktivität: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Förderaktivität: die Verbesserung der Daueraufmerksamkeit bei Herrn M., einem Beschäftigten mit schwerer geistiger Behinderung und Konzentrationsschwäche. Die Aktivität umfasste Lückentext- und Rechenaufgaben in einer 1:1-Betreuung. Die Reflexion analysiert das methodische Vorgehen, die Ergebnisse und zieht Schlussfolgerungen für zukünftige Interventionen. Sie dient der Selbstreflexion und der Optimierung der Fördermaßnahmen für Herrn M.
Ziele: Das gesetzte Ziel, die Verbesserung der Daueraufmerksamkeit durch die Durchführung der vorbereiteten Aufgaben, wurde erreicht. Die Passfähigkeit des SMART-Ziels zu den individuellen Förderzielen von Herrn M. wird hervorgehoben und die einfache Integration der Aktivität in den Arbeitsalltag betont. Die Ausrichtung des Ziels an der Verbesserung der Daueraufmerksamkeit und des Konzentrationsvermögens bei einfachen Aufgaben wird als erfolgreich bewertet.
Situationsanalyse: Dieser Abschnitt beschreibt die Stärken, Schwächen, Ressourcen und Defizite von Herrn M. Seine kognitiven Fähigkeiten werden als Stärke hervorgehoben, während die Konzentrationsschwäche und die Probleme mit der intrinsischen Motivation als Herausforderungen identifiziert werden. Die Analyse dient als Grundlage für die Auswahl der Fördermethoden und die Gestaltung der 1:1-Betreuung. Der Bezug zu seinen Hirnschädigungen aus dem Jahr 2003 wird hergestellt, um den Kontext seiner Behinderung zu verdeutlichen.
Methodisches Handeln: Dieser Teil beschreibt detailliert den Ablauf der Förderaktivität, gegliedert in Hinführungs-, Erarbeitungs- und Abschlussphase. Die positive Reaktion von Herrn M. in der Hinführungsphase wird hervorgehoben. Die Erarbeitungsphase analysiert Fehler in der Kommunikation und im methodischen Vorgehen (z.B. unnötige Fragen statt direkter Aufforderungen). Die positive Reaktion während des Spiels "Tik-Tak-Toe" wird beschrieben und die Bedeutung der 1:1-Betreuung für die Motivation von Herrn M. betont. Die Abschlussphase wird reflektiert, wobei die Bedeutung einer umfassenderen Reflexion mit Herrn M. über die Aktivität hervorgehoben wird. Der gesamte Ablauf wird hinsichtlich der Übergänge zwischen den Phasen und der Angemessenheit von Zeitpunkt, Zeitrahmen und Ort bewertet.
Schlüsselwörter
Daueraufmerksamkeit, Konzentrationsschwäche, geistige Behinderung, 1:1-Förderung, Förderaktivität, Lückentext, Rechenaufgaben, intrinsische Motivation, SMART-Ziel, Reflexion, methodisches Handeln, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Förderaktivität mit Herrn M.
Was ist der Gegenstand dieser Reflexion?
Diese Reflexion beschreibt und analysiert eine 1:1-Förderaktivität mit Herrn M., einem Beschäftigten mit schwerer geistiger Behinderung und Konzentrationsschwäche. Das Hauptziel war die Verbesserung seiner Daueraufmerksamkeit mithilfe von Lückentext- und Rechenaufgaben.
Welche Ziele wurden verfolgt?
Das übergeordnete Ziel war die Verbesserung der Daueraufmerksamkeit bei Herrn M. Die Reflexion bewertet, ob dieses SMART-Ziel erreicht wurde und wie gut es zu den individuellen Förderzielen von Herrn M. passte. Es wird untersucht, wie die Aktivität in den Arbeitsalltag integriert wurde und ob die Ausrichtung auf einfache Aufgaben erfolgreich war.
Wie wurde die Situation von Herrn M. analysiert?
Die Situationsanalyse beschreibt Herrn M.'s Stärken und Schwächen. Seine kognitiven Fähigkeiten werden als Stärke hervorgehoben, während seine Konzentrationsschwäche und die Probleme mit der intrinsischen Motivation als Herausforderungen identifiziert werden. Der Bezug zu seinen Hirnschädigungen aus dem Jahr 2003 wird hergestellt, um den Kontext seiner Behinderung zu verdeutlichen. Diese Analyse dient als Grundlage für die Auswahl der Fördermethoden.
Welche Methoden wurden eingesetzt?
Die Förderaktivität umfasste Lückentext- und Rechenaufgaben sowie ein Spiel ("Tik-Tak-Toe"). Die Reflexion analysiert die Wirksamkeit dieser Methoden und bewertet das methodische Vorgehen, insbesondere die Kommunikation während der einzelnen Phasen (Hinführung, Erarbeitung, Abschluss). Es wird untersucht, ob die gewählten Methoden und der Ablauf (Zeitpunkt, Zeitrahmen, Ort) angemessen waren.
Wie wurde die Förderaktivität strukturiert?
Die Förderaktivität war in drei Phasen gegliedert: Hinführung, Erarbeitung und Abschluss. Die Reflexion beschreibt detailliert den Ablauf jeder Phase und analysiert die Reaktionen von Herrn M. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Kommunikation und das methodische Vorgehen gelegt. Die Bedeutung der 1:1-Betreuung für die Motivation von Herrn M. wird hervorgehoben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Reflexion bewertet, ob das gesetzte Ziel (Verbesserung der Daueraufmerksamkeit) erreicht wurde. Sie identifiziert Stärken und Schwächen des Vorgehens und zieht Schlussfolgerungen für zukünftige Aktivitäten. Die Passfähigkeit des SMART-Ziels zu den individuellen Förderzielen von Herrn M. wird diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Die Reflexion dient der Selbstreflexion und der Optimierung der Fördermaßnahmen für Herrn M. Sie identifiziert Bereiche, in denen das methodische Vorgehen verbessert werden kann (z.B. Vermeidung unnötiger Fragen, bessere Kommunikation). Es wird betont, wie wichtig eine umfassendere Reflexion mit Herrn M. über die Aktivität ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Daueraufmerksamkeit, Konzentrationsschwäche, geistige Behinderung, 1:1-Förderung, Förderaktivität, Lückentext, Rechenaufgaben, intrinsische Motivation, SMART-Ziel, Reflexion, methodisches Handeln, Selbstbestimmung.
- Quote paper
- Christoph Scheidemann (Author), 2022, Verbesserung der Daueraufmerksamkeit durch Förderaufgaben. Lückentexte und Rechenaufgaben mit einem Beschäftigten mit schwerer geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309000