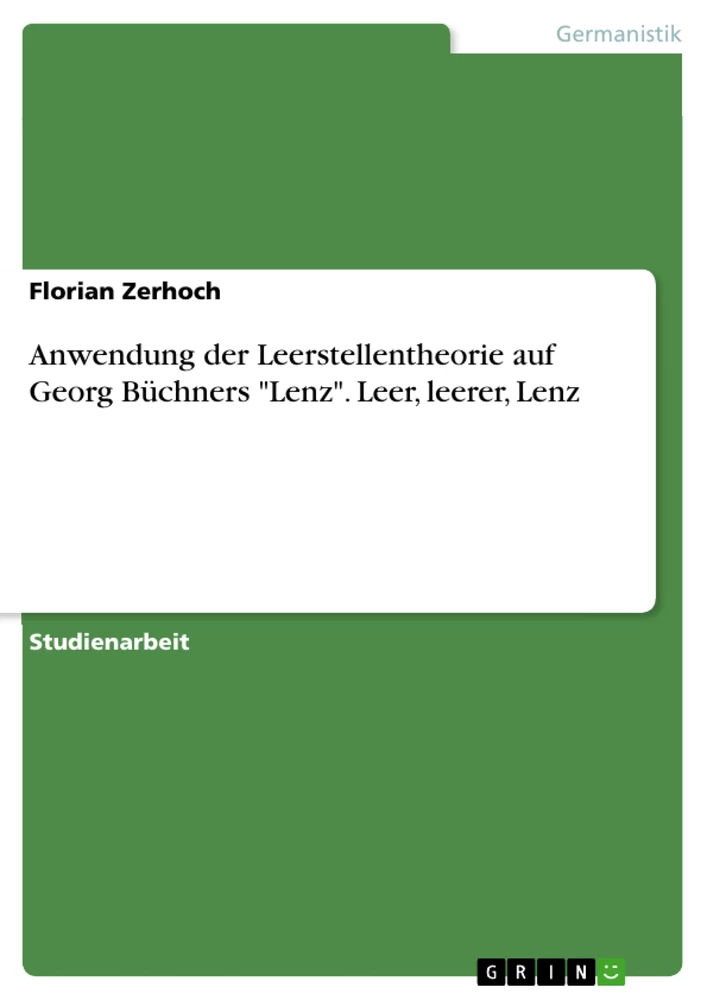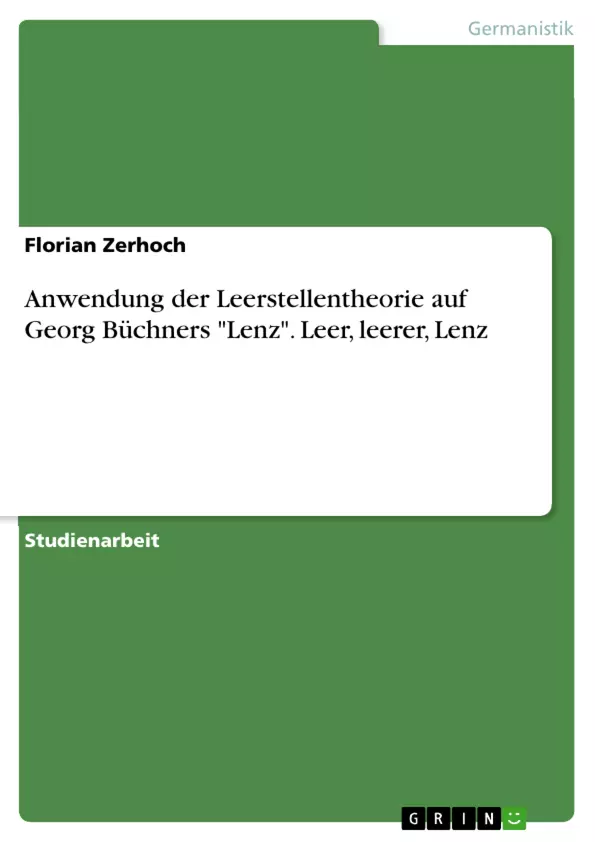Zunächst soll in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen werden, auf welche Bereiche sich das Ausfüllen der Leerstellen in Oberlins Bericht durch Büchner erstreckt und ob diese Ergänzungen eines faktualen Berichtes aus der Realität, im Sinne einer büchnerschen Idealismuskritik, erlaubt sind und welche Form von Ergänzungen nicht. Hier ist vor allem das Kunstgepräch zu beachten, denn die Diskussion über den Idealismus in Zusammenhang mit dem Verhalten von Lenz bildet eine Parallele zu der Leerstellentheorie insofern, als der Idealismus eine idealisierte, d.h. ergänzte, Wirklichkeit zum Kunstgegenstand macht und dem von Lenz präferierten Realismus gegenüberstellt. Lenz lehnt dieses Idealisieren ab, verhält sich aber „im praktischen Leben gerade so […], wie es die im Kunstgespräch angegriffenen Dichter tun, ‚welche die Wirklichkeit verklären wollen‘.“ Diese Diskrepanz zwischen Lenzens theoretischer Meinung und seinem praktischen Verhalten öffnet den Blick für Büchners Kritik an der Kunst der „idealistischen Periode“. Im zweiten Teil werden die von Dotzler vorgeschlagenen Leerstellentypen auf Büchners Lenz angewendet, um einerseits zu überprüfen, ob diese Typen auch auf einen anderen Text anwendbar sind, als auf Goethes Werther, aus dem sie erarbeitet wurden, und zum anderen, um einige neue Leerstellen aufzuzeigen, die nun Büchner seinerseits in der Kausa Lenz lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Leerstellen und Unbestimmtheiten in den Fallbeschreibungen des Lenz
- Durch Büchner ausgefüllte Leerstellen in Oberlins Bericht
- Die Leseraktivierung durch neue Leerstellen im Lenz
- Leerstellen auf schriftmaterialer Ebene
- Formen elliptischer Rede
- Leerstellen, die durch das Ergänzen von Sachverhalten auszufüllen sind
- Unbesetzte Stellen in einem System von Plätzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Anwendung einer Leerstellentheorie auf Georg Büchners „Lenz“ und untersucht, wie Leerstellen in Büchners Text entstehen, welche Auswirkungen sie auf den Leser haben und wie sie die Interaktion zwischen Text und Rezipient ermöglichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Ausfüllung von Leerstellen in Oberlins Bericht durch Büchner und die neuen Leerstellen, die Büchner im Lenz selbst einführt.
- Die Rolle von Leerstellen in der Literatur
- Die Bedeutung der Leseraktivierung durch Leerstellen
- Die Beziehung zwischen Büchners Lenz und Oberlins Bericht
- Die Anwendung der Leerstellentheorie auf Büchners Lenz
- Die Kritik am Idealismus in Büchners Lenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Leerstellentheorie von Ingarden und Iser vor und erläutert die Bedeutung von Leerstellen für die Rezeption eines Textes. Anschließend wird die Verbindung zwischen Büchners Lenz und Oberlins Bericht hergestellt, wobei hervorgehoben wird, dass Büchner einige Leerstellen in Oberlins Bericht ausfüllt und gleichzeitig neue Leerstellen einführt.
Kapitel 2 untersucht die Leerstellen in den Fallbeschreibungen des Lenz. Zunächst wird analysiert, welche Leerstellen Büchner in Oberlins Bericht ausfüllt und welche neuen Leerstellen er im Lenz selbst kreiert. Anschließend werden verschiedene Typen von Leerstellen in Büchners Lenz anhand der Leerstellentheorie von Dotzler analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Leerstellentheorie, insbesondere mit den Begriffen "Leerstelle", "Unbestimmtheit", "Leseraktivierung", "Interaktion", "Text-Rezipient", und "Idealismuskritik". Darüber hinaus werden die Werke von Georg Büchner und Johann Friedrich Oberlin sowie Oberlins Bericht über Jakob Lenz in Waldersbach behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Leerstellentheorie“ in der Literaturwissenschaft?
Sie besagt, dass Texte Unbestimmtheiten (Leerstellen) enthalten, die vom Leser im Akt der Rezeption aktiv ausgefüllt werden müssen.
Wie nutzt Georg Büchner diese Theorie in seinem Werk „Lenz“?
Büchner füllt Leerstellen aus dem historischen Bericht von Oberlin aus, schafft aber gleichzeitig neue Leerstellen, um den Leser zu aktivieren.
Welche Rolle spielt die Idealismuskritik in Büchners „Lenz“?
Büchner kritisiert die idealisierte Darstellung der Wirklichkeit und stellt ihr einen radikalen Realismus gegenüber.
Welche Arten von Leerstellen werden in der Arbeit unterschieden?
Die Untersuchung nennt Leerstellen auf schriftmaterialer Ebene, Formen elliptischer Rede und inhaltliche Unbesetztheiten.
Worauf basiert Büchners Erzählung „Lenz“?
Sie basiert auf dem tatsächlichen Bericht des Pfarrers Johann Friedrich Oberlin über den Aufenthalt des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz im Steintal.
- Arbeit zitieren
- Florian Zerhoch (Autor:in), 2017, Anwendung der Leerstellentheorie auf Georg Büchners "Lenz". Leer, leerer, Lenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309020