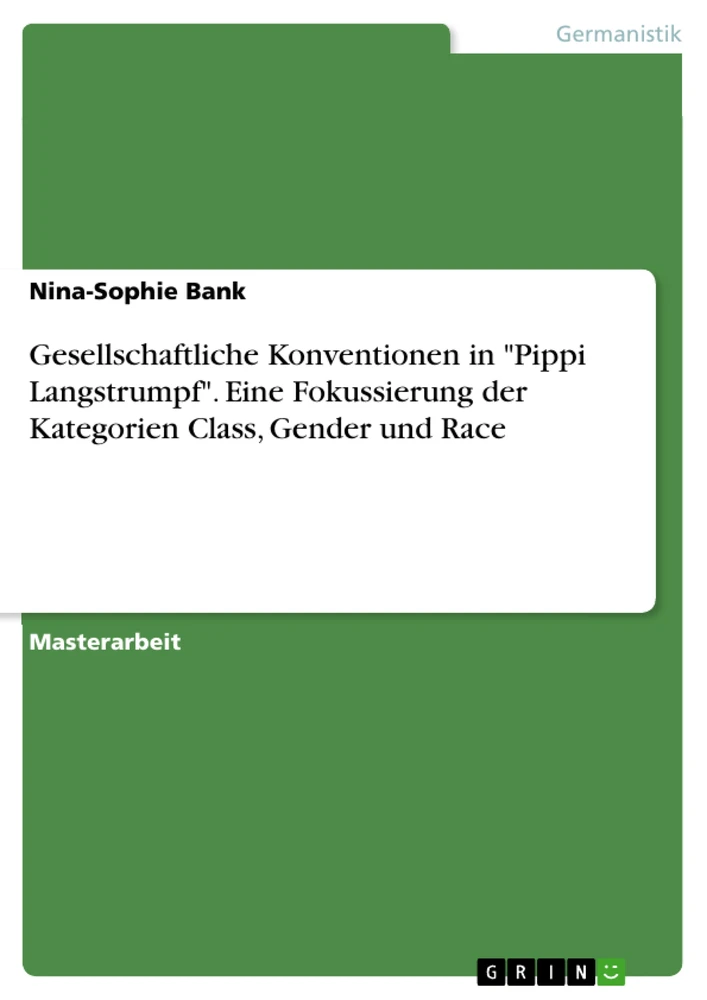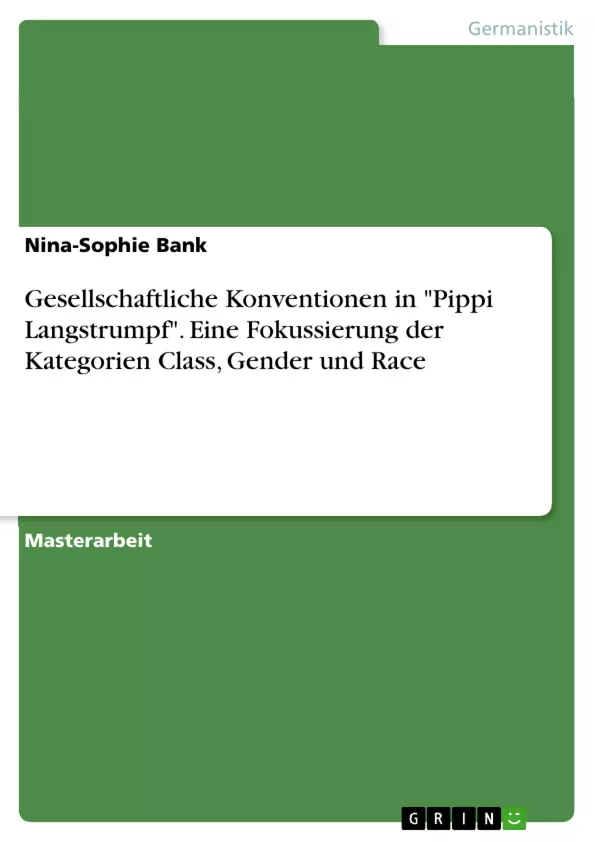In dieser Arbeit werden die Kategorien class, race und gender im Einzelnen, wie auch im Zusammenspiel, in den Romanen um Pippi Langstrumpf betrachtet. Diese Analyse soll als Grundlage fungieren, um die Frage zu beantworten, weshalb Pippi Langstrumpf als Figur überhaupt funktionieren kann. Auch zeigt diese Arbeit, dass das Gesellschaftsbild der damaligen Zeit mit der Figur von Pippi Langstrumpf, trotz der Tabubrüche, übereinstimmt. Damit wird aufgezeigt, dass die Notwendigkeit der Reflektion und Kritik in der heutigen Zeit durchaus gerechtfertigt ist. Dennoch soll verdeutlicht werden, dass Pippi dem Ton ihrer Zeit trotzt, gleichzeitig aber ein Opfer der Mode wurde.
Allgemein lässt sich sagen, dass Pippi Langstrumpf als Sinnbild für Tabubrüche gesehen werden kann. Dementsprechend wird sie zum Beispiel in die Phalanx feministischer Figuren eingeordnet. Sie vertritt vor allem die Ideologie der Ideologienfreiheit. Als sowohl prä- als auch postfeministische Figur kann sie dementsprechend als Symbol für zeitlose Durchsetzungskraft von Frauen gesehen werden, womit sich vor allem Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken einsetzt.
In den 1970er-Jahren wird dann eine Rassismuskritik gegenüber der Figur laut. Die Debatte darüber hat sich bis heute noch nicht vollends beruhigt. Hier plädiert man allerdings nicht für eine Zensur, sondern mehr für eine Reflektion und Integration des Themas innerhalb der Bildungspolitik. Die Figur Pippi Langstrumpf an sich soll als solche bestehen bleiben. Weniger populär ist die Betrachtung der finanziellen Situation und des gesellschaftlichen Status der Figur. Diese gilt es noch auszubauen, da die Kategorien class, race und gender in Pippi Langstrumpf beispiellos ineinandergreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Konzepte
- Kinder- und Jugendliteratur
- Kategorie „class“
- Kategorie „gender“
- Kategorie „race“
- Intersektionalität
- Darstellung der gesellschaftlichen Konventionen in Pippi Langstrumpf
- Gesellschaftliche Konventionen der Kategorie „class“
- Gesellschaftliche Konventionen der Kategorie „gender“
- Gesellschaftliche Konventionen der Kategorie „race“
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung gesellschaftlicher Konventionen in Astrid Lindgrens Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf. Im Fokus stehen die Kategorien „class“, „gender“ und „race“ sowie ihre Interaktion im Kontext der Figur. Ziel ist es, zu verstehen, warum Pippi Langstrumpf trotz ihrer Tabubrüche eine so erfolgreiche und beliebte Figur ist, und wie sie das Gesellschaftsbild der damaligen Zeit widerspiegelt. Dabei wird die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den in der Figur vermittelten Botschaften aufgezeigt.
- Analyse der Kategorie „class“ im Kontext der Figur Pippi Langstrumpf
- Untersuchung der Kategorie „gender“ im Kontext der Figur Pippi Langstrumpf
- Begutachtung der Kategorie „race“ im Kontext der Figur Pippi Langstrumpf
- Intersektionalität der Kategorien „class“, „gender“ und „race“ im Kontext der Figur Pippi Langstrumpf
- Reflektion des Gesellschaftsbildes der Zeit der Entstehung der Figur Pippi Langstrumpf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die Figur Pippi Langstrumpf und ihre Bedeutung für die Emanzipation der Frau beleuchtet. Sie stellt den zeitgeschichtlichen Kontext der Entstehung der Figur vor und diskutiert die Kontroversen um Pippi Langstrumpf in Bezug auf Rassismus. Die Arbeit stellt die Kategorien „class“, „gender“ und „race“ als zentrale Analyseebenen vor und formuliert die Forschungsfrage, warum die Figur Pippi Langstrumpf trotz ihrer Tabubrüche funktioniert.
Das Kapitel „Theoretische Konzepte“ definiert den Begriff der Kinder- und Jugendliteratur und beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Genres. Es werden die Kategorien „class“, „gender“ und „race“ im Detail erläutert sowie das Konzept der Intersektionalität dargestellt.
Das Kapitel „Darstellung der gesellschaftlichen Konventionen in Pippi Langstrumpf“ analysiert die Figur Pippi Langstrumpf im Hinblick auf die drei Kategorien. Es untersucht, wie Pippi Langstrumpf die gesellschaftlichen Konventionen in Bezug auf „class“, „gender“ und „race“ sowohl bricht als auch widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Kinder- und Jugendliteratur, insbesondere der Figur Pippi Langstrumpf. Dabei stehen die Kategorien „class“, „gender“ und „race“ im Vordergrund. Weitere wichtige Begriffe sind Intersektionalität, gesellschaftliche Konventionen, Emanzipation, Tabubruch und die Reflektion des Gesellschaftsbildes der Zeit der Entstehung der Figur.
- Quote paper
- Nina-Sophie Bank (Author), 2020, Gesellschaftliche Konventionen in "Pippi Langstrumpf". Eine Fokussierung der Kategorien Class, Gender und Race, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309051