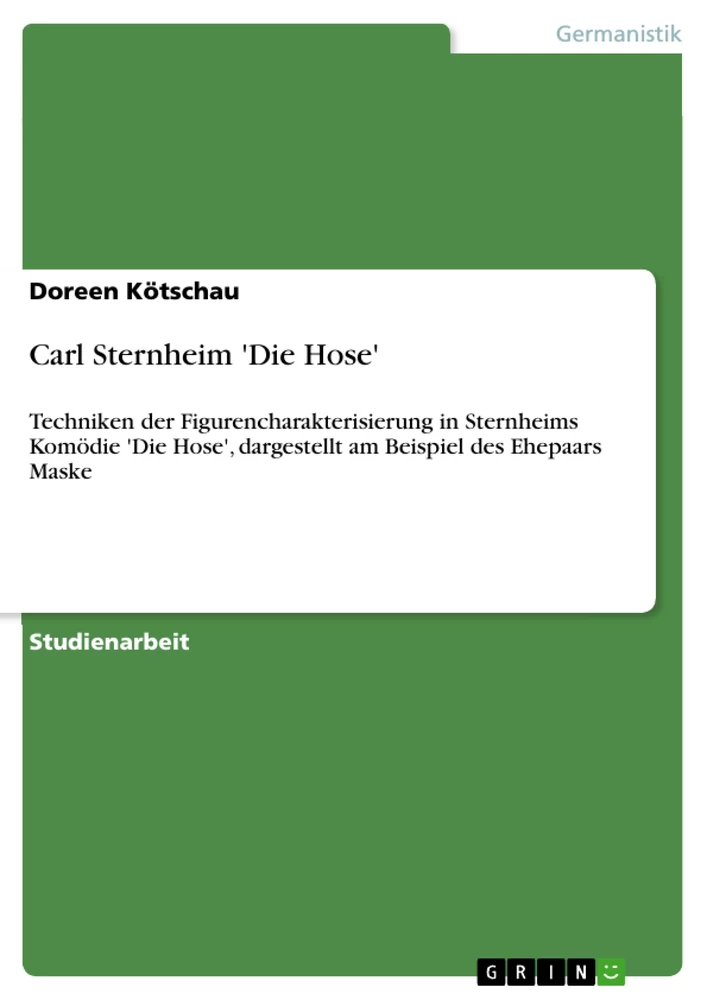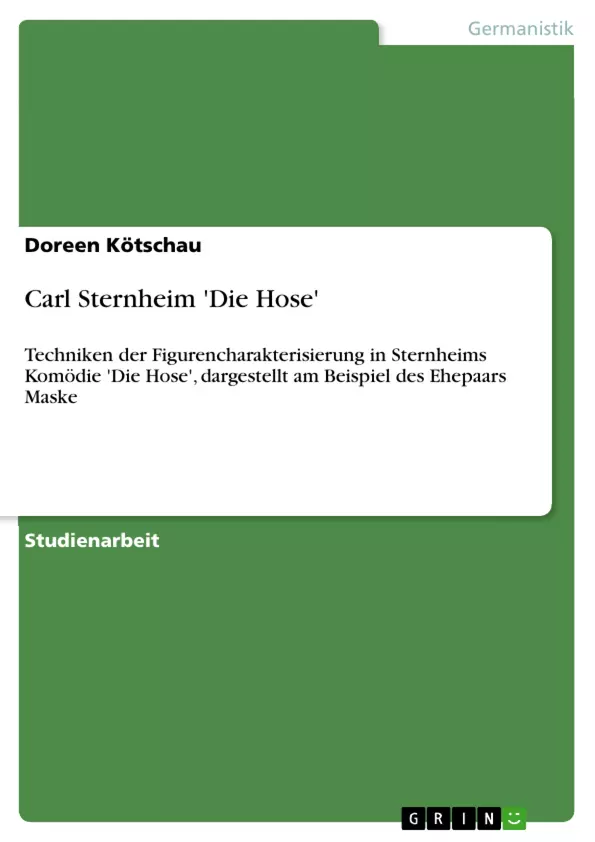„Das bürgerliche Lustspiel ‚Die Hose’ nimmt in Sternheims Werk eine Stellung ein, die [mit] derjenigen des ‚Urteils’ für Kafkas Entwicklung vergleichbar ist.“ Carl Sternheim beginnt am 7. Juli 1909 mit der ersten Niederschrift des bürgerlichen Lustspiels „Der Riese“. Am 1. September 1910 schließt er die Bearbeitung ab und veröffentlicht sie Ende 1910 unter dem Titel „Die Hose“. Max Reinhardt nimmt die Komödie im Oktober 1910 zur Uraufführung im Deutschen Theater an. Der Inhalt: Ein unbescholtenes Bürgerweib, das die ‚Unaussprechlichen’ verliert, wodurch zwei lüsterne Untermieter magnetisch angelockt werden, um ihr den Hof zu machen, und ihr Ehemann, der kleine Beamte Theobald Maske, der seine Neigungen unter der Tarnkappe seiner Unscheinbarkeit zu verbergen gelernt hat, und die Fähigkeit besitzt, aus diesem ‚Unglück’ mehrfach Kapital zu schlagen und wie ein ‚Riese’ den Sieg über sein Weib davonzutragen, dieser Stoff war ganz darauf angelegt, die getarnte Wohlanständigkeit und Prüderie der wilhelminischen Bürger zu schockieren und als Schein zu entlarven.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Techniken der Figurencharakterisierung in Sternheims Komödie „Die Hose“, dargestellt am Beispiel des Ehepaars Maske
- 2.1 Figurale Charakterisierung
- 2.1.1 Explizite figurale Charakterisierung
- 2.1.1.1 Eigenkommentar im Dialog
- 2.1.1.1.a Theobald Maske
- 2.1.1.1.b Luise Maske
- 2.1.1.2 Eigenkommentar im Monolog Luise Maske
- 2.1.1.3 Fremdkommentar im Dialog
- 2.1.1.1 Eigenkommentar im Dialog
- 2.1.2 Implizite figurale Charakterisierung
- 2.1.1 Explizite figurale Charakterisierung
- 2.2 Auktoriale Charakterisierung
- 2.1 Figurale Charakterisierung
- 3. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Techniken der Figurencharakterisierung in Carl Sternheims Komödie „Die Hose“, fokussiert auf das Ehepaar Maske. Ziel ist es, die verschiedenen Methoden der Charakterzeichnung zu analysieren und deren Beitrag zum Verständnis der Figuren und des Gesamtwerks aufzuzeigen.
- Explizite und implizite figurale Charakterisierung
- Auktoriale Charakterisierung
- Analyse der Figuren Theobald und Luise Maske
- Darstellung der ambivalenten Charaktere
- Die Rolle der Sprache in der Charakterisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext von Sternheims „Die Hose“ innerhalb seines Gesamtwerks. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine textanalytische Betrachtung des Ehepaars Maske konzentriert. Die Eingrenzung auf dieses Ehepaar wird begründet, und die verwendete Ausgabe des Werks wird genannt.
2. Techniken der Figurencharakterisierung in Sternheims Komödie „Die Hose“, dargestellt am Beispiel des Ehepaars Maske: Dieses Kapitel analysiert die Techniken der Figurencharakterisierung im Stück. Es unterteilt die Charakterisierung in figurale und auktoriale Verfahren und untersucht explizite sowie implizite Darstellungsweisen. Anhand von ausgewählten Dialogen und Monologen werden die Charaktere Theobald und Luise Maske detailliert untersucht. Die Analyse beleuchtet die individuellen Eigenheiten und die Interaktion beider Figuren, unter Berücksichtigung von sprachlichen Mitteln und handlungsbezogener Charakterisierung.
Schlüsselwörter
Carl Sternheim, Die Hose, Figurencharakterisierung, figurale Charakterisierung, auktoriale Charakterisierung, Theobald Maske, Luise Maske, bürgerliches Lustspiel, Ambivalenz, Sprache, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Techniken der Figurencharakterisierung in Sternheims "Die Hose"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Techniken der Figurencharakterisierung in Carl Sternheims Komödie "Die Hose", mit besonderem Fokus auf das Ehepaar Maske. Es werden explizite und implizite figurale sowie auktoriale Charakterisierungsmethoden untersucht und deren Beitrag zum Verständnis der Figuren und des Gesamtwerks aufgezeigt.
Welche Charakterisierungsmethoden werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl explizite als auch implizite figurale Charakterisierungsmethoden. Explizite Methoden umfassen Eigen- und Fremdkommentare im Dialog und Monolog. Implizite Methoden werden ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich wird die auktoriale Charakterisierung analysiert.
Welche Figuren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Hauptfiguren der Analyse sind Theobald und Luise Maske, das Ehepaar aus Sternheims "Die Hose". Ihre individuellen Charaktereigenschaften und ihre Interaktion miteinander werden detailliert untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Figurencharakterisierung am Beispiel des Ehepaars Maske (unterteilt in explizite und implizite figurale sowie auktoriale Charakterisierung), und eine Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Das Hauptkapitel analysiert verschiedene Aspekte der Charakterzeichnung, einschließlich der Rolle der Sprache.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Analyse?
Die Sprache spielt eine entscheidende Rolle in der Analyse, da sie ein zentrales Mittel der Charakterisierung in Sternheims Stück darstellt. Ausgewählte Dialoge und Monologe werden detailliert untersucht, um die sprachlichen Mittel der Charakterzeichnung aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Carl Sternheim, Die Hose, Figurencharakterisierung, figurale Charakterisierung, auktoriale Charakterisierung, Theobald Maske, Luise Maske, bürgerliches Lustspiel, Ambivalenz, Sprache, Textanalyse.
Welche Ausgabe von "Die Hose" wurde verwendet?
Die verwendete Ausgabe von Sternheims "Die Hose" wird in der Einleitung genannt (obwohl die genaue Ausgabe im bereitgestellten HTML-Code nicht spezifiziert ist).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Methoden der Charakterzeichnung in "Die Hose" zu analysieren und deren Beitrag zum Verständnis der Figuren und des Gesamtwerks aufzuzeigen. Es geht darum, die ambivalenten Charaktere und ihre Darstellung zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Doreen Kötschau (Autor:in), 2009, Carl Sternheim 'Die Hose', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130907